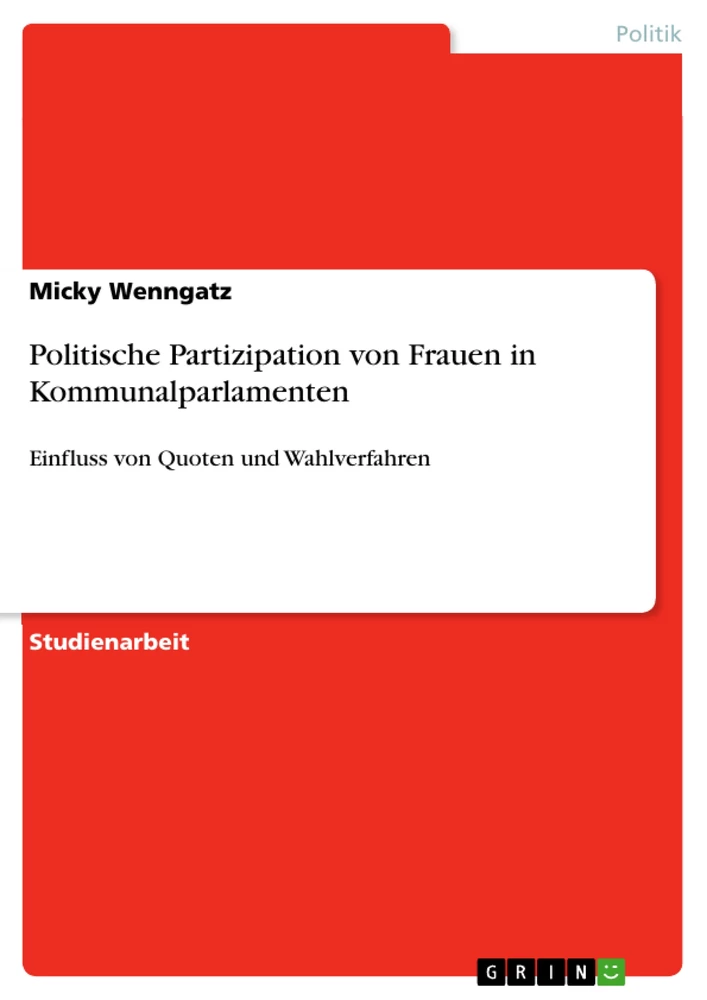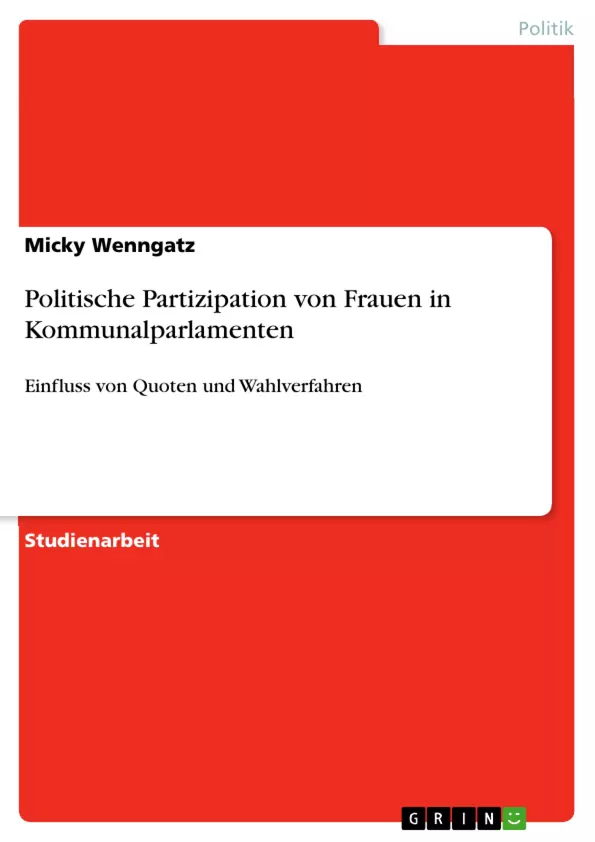Am 19. Januar 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten mal an Wahlen teilnehmen. Damit ist das aktive wie das passive Frauenwahlrecht in Deutschland stolze 90 Jahre alt. Doch der Weg von der formalen Gleichberechtigung von Frauen im Wahlrecht zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen auf der politischen Bühne ist noch lange nicht zu Ende gegangen.
Zwar ist der Anteil der Frauen im Bundestag mit im Jahr 2002 32,2 Prozent (BMFSFJ, 2008) deutlich höher als derjenige im ersten Reichstag 1920 mit 8 Prozent (Paulus, 2007), von einer paritätischen Besetzung des Gremiums kann allerdings auch heute noch nicht die Rede sein.
Ähnlich sieht es noch immer in den Kommunalparlamenten aus. Obwohl in
Artikel 3 GG, Satz 2 folgendes deutlich gemacht wird, „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ wird die Unterrepräsentanz von Frauen in kommunalen Gremien schon bei
einem Vergleich der deutschen Großstädte deutlich (vgl. Holtkamp, 2009).
Berücksichtigt man dann noch die Tatsache, dass Benachteiligung von Frauen sich auf dem Land häufig stärker auswirkt als in der Stadt (vgl. Heepe, 1989), zeichnet sich deutlich ab, dass die oben zitierte Verfassungsnorm mit der für Frauen erlebbaren Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik noch wenig gemein hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Erklärungsmodelle für Unterrepräsentanz von Frauen
- Partizipation
- Quote
- Mandatsrelevanz
- Normative Rahmenbedingungen
- Bayerisches Kommunalwahlrecht
- Nominierungsverfahren
- Quantitative Untersuchung im Vergleich München – Bad Tölz
- Fragestellung und Hypothesen
- Ergebnisse der Stadtratswahlen in Bad Tölz und in München
- Berücksichtigung der Quote
- Der Einfluss des Wahlverfahrens
- Fazit
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Partizipation von Frauen in bayerischen Kommunalparlamenten. Im Fokus steht der Einfluss von Quotenregelungen und Wahlverfahren auf die Repräsentanz von Frauen. Ein Vergleich der Wahlergebnisse zweier Kommunen soll Aufschluss über die Wirksamkeit dieser Faktoren geben.
- Unterrepräsentanz von Frauen in Kommunalparlamenten
- Einfluss von Quotenregelungen auf die Kandidatenaufstellung und Wahlergebnisse
- Auswirkungen verschiedener Wahlverfahren auf die Frauenrepräsentanz
- Vergleichende Analyse der Kommunen München und Bad Tölz
- Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Frauenwahlrechts in Deutschland und stellt die anhaltende Unterrepräsentanz von Frauen in politischen Gremien, insbesondere in Kommunalparlamenten, fest. Sie verortet die Arbeit im Kontext des Artikels 3 GG und begründet das Forschungsinteresse der Autorin an der Fragestellung, inwiefern das bayerische Kommunalwahlrecht und die Quotierung von Wahlvorschlägen die Repräsentanz von Frauen beeinflussen. Die Autorin beschreibt ihre persönlichen Erfahrungen als Mitglied einer politischen Partei und eines kommunalen Parlamentes als Motivation für die Untersuchung.
Allgemeines: Dieses Kapitel skizziert den Rahmen der Arbeit, indem es gängige Theorien und Erklärungsmodelle für die Unterrepräsentanz von Frauen in Kommunalparlamenten einführt. Es definiert den Begriff der Partizipation im Kontext der politischen Repräsentation und grenzt den Quotenbegriff für die Zwecke der Arbeit ein. Zusätzlich wird der Begriff der Mandatsrelevanz erläutert und definiert.
Erklärungsmodelle für Unterrepräsentanz von Frauen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Erklärungsmodelle für die Unterrepräsentanz von Frauen in Kommunalparlamenten. Es werden Faktoren wie der Kandidatenpool (Sozialisation und Abkömmlichkeit von Frauen), die Parteiorganisation (Diskriminierung von Frauen, Nutzen von Quoten) und der Wählermarkt (Diskriminierung durch Wählerinnen und Wähler) betrachtet. Die Autorin diskutiert verschiedene Perspektiven aus der Literatur und hebt die Bedeutung von Wahlrecht, Quotenmodellen und Wahlergebnissen quotierender Parteien hervor.
Partizipation: Dieses Kapitel differenziert zwischen konventioneller und unkonventioneller politischer Partizipation. Der Fokus liegt auf der konventionellen Partizipation, da diese sich direkt auf die Repräsentanz von Frauen auf Wahlvorschlägen und in Kommunalparlamenten auswirkt. Es werden Zahlen zum Frauenanteil in verschiedenen Parteien präsentiert, um den bestehenden Geschlechterunterschied in der Parteimitgliedschaft aufzuzeigen.
Quote: Der Abschnitt erläutert die Quotenregelungen der Grünen und der SPD als Versuche, den Zugang von Frauen zu politischen Ämtern zu erleichtern. Die unterschiedlichen Quotenmodelle (paritätische Quote bei den Grünen und 40-Prozent-Quote bei der SPD) werden beschrieben und der Einfluss von Quoten auf die Aktivierung von Frauen im politischen Prozess wird betrachtet.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Frauen, Kommunalparlamente, Quoten, Wahlverfahren, Repräsentanz, Geschlechtergleichstellung, Bayern, Kommunalwahlrecht, Kandidatenaufstellung, Wahlergebnisse.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Politische Partizipation von Frauen in Bayerischen Kommunalparlamenten
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die politische Partizipation von Frauen in bayerischen Kommunalparlamenten. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von Quotenregelungen und Wahlverfahren auf die Repräsentanz von Frauen. Ein Vergleich der Wahlergebnisse zweier Kommunen (München und Bad Tölz) soll Aufschluss über die Wirksamkeit dieser Faktoren geben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Unterrepräsentanz von Frauen in Kommunalparlamenten, den Einfluss von Quotenregelungen auf die Kandidatenaufstellung und Wahlergebnisse, die Auswirkungen verschiedener Wahlverfahren auf die Frauenrepräsentanz, eine vergleichende Analyse der Kommunen München und Bad Tölz sowie die Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung. Es werden verschiedene Erklärungsmodelle für die Unterrepräsentanz von Frauen analysiert, der Begriff der Partizipation definiert und unterschiedliche Quotenmodelle (z.B. bei Grünen und SPD) beschrieben.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quantitative Untersuchung im Vergleich zwischen München und Bad Tölz, um die Fragestellungen zu beantworten. Sie analysiert Wahlergebnisse und berücksichtigt dabei den Einfluss von Quotenregelungen und Wahlverfahren. Zusätzlich werden theoretische Erklärungsmodelle und Literaturanalysen herangezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Allgemeines, Erklärungsmodelle für Unterrepräsentanz von Frauen, Partizipation, Quote, Mandatsrelevanz, Normative Rahmenbedingungen, Bayerisches Kommunalwahlrecht, Nominierungsverfahren, Quantitative Untersuchung im Vergleich München – Bad Tölz, Fragestellung und Hypothesen, Ergebnisse der Stadtratswahlen in Bad Tölz und in München, Berücksichtigung der Quote, Der Einfluss des Wahlverfahrens, Fazit und Schlussbemerkung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit und die Schlussbemerkung der Arbeit werden im Detail im letzten Kapitel präsentiert und fassen die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung und der Analyse der Einflussfaktoren zusammen. Es wird eine Bewertung der Wirksamkeit der untersuchten Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Politische Partizipation, Frauen, Kommunalparlamente, Quoten, Wahlverfahren, Repräsentanz, Geschlechtergleichstellung, Bayern, Kommunalwahlrecht, Kandidatenaufstellung, Wahlergebnisse.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant beschreibt. Diese Zusammenfassung erleichtert es dem Leser, den Inhalt der Arbeit zu überblicken.
Welche Rolle spielt die persönliche Erfahrung der Autorin?
Die Autorin beschreibt ihre persönlichen Erfahrungen als Mitglied einer politischen Partei und eines kommunalen Parlamentes als Motivation für die Untersuchung. Diese Erfahrungen liefern einen Kontext für ihre Forschung.
Welche Quotenmodelle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere die Quotenregelungen der Grünen (paritätische Quote) und der SPD (40-Prozent-Quote) und deren Einfluss auf die Frauenrepräsentanz.
Wie werden die Begriffe Partizipation und Mandatsrelevanz definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff der Partizipation im Kontext der politischen Repräsentation und grenzt den Quotenbegriff ein. Zusätzlich wird der Begriff der Mandatsrelevanz erläutert und definiert (genaue Definitionen sind im Text nachzulesen).
- Arbeit zitieren
- Micky Wenngatz (Autor:in), 2009, Politische Partizipation von Frauen in Kommunalparlamenten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154334