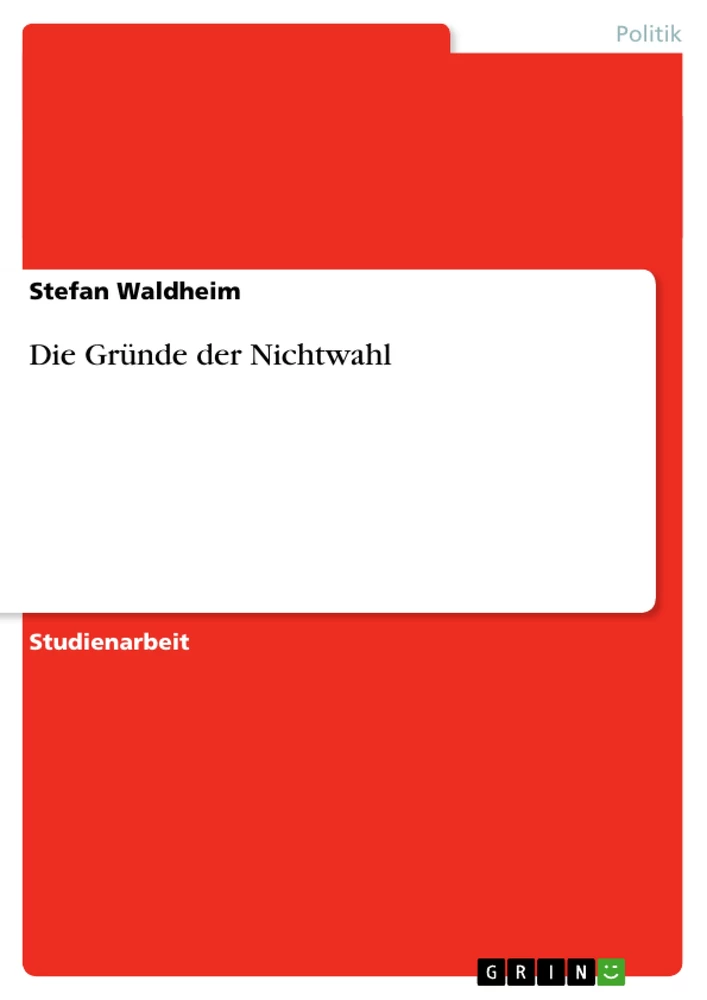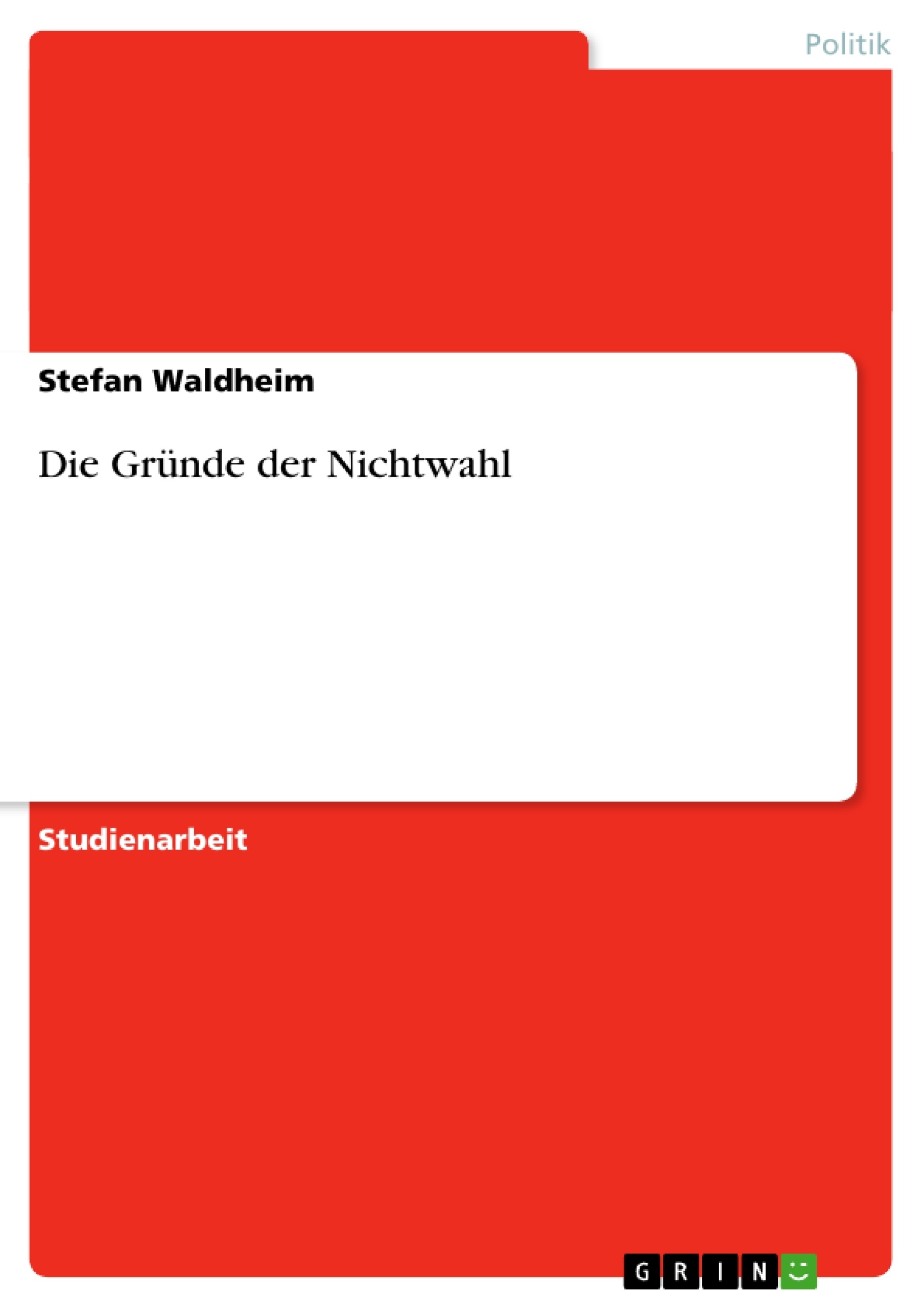Seit Anfang der 80er Jahre geht die Wahlbeteiligung auf allen Ebenen
kontinuierlich zurück. Noch in den 70er Jahren wurden Rekordbeteiligungen bei
den Bundestagswahlen von bis 91,1% (1972) erreicht, während es 1998 nur noch
82,2 %1 waren. Als Hochzeit politischer Partizipation gilt die Zeit zwischen dem
Ende der 70er und dem Anfang der 80er Jahre. Die Bundesrepublik Deutschland
galt im internationalen Vergleich als Musterbeispiel für eine hohe
Wahlbeteiligung. Als Gründe der Nichtwahl sah man bis dato eine persönliche
Verhinderung sowie Krankheit und vermutete die Nichtwähler zumeist unter den
gesellschaftlichen Randgruppen und Minderheiten. Eine solche quantitative
Reduktion auf nur wenige Erklärungsmuster ist in der heutigen Forschung zum
Wählerverhalten, welche sich mit einem Anteil von etwa 20% an Nichtwählern
auseinandersetzt, nicht mehr möglich.2 Da davon ausgegangen werden kann, dass
der Bestandteil der „Nichtwahlfähigen“3, also unfreiwilligen Nichtwählern auch
heute noch prozentual einen geringen Anteil ausmacht, müssen die maßgeblichen
entsprechenden Gruppen in anderen Bereichen vermutet werden. Wer nicht
wählen geht, tut dies oft in Folge einer bewussten Entscheidung. Worauf ist dieser
Entschluss begründet? Es stellen sich also vor allem die Fragen, wer sich der
Wahl enthält und warum dies geschieht.
Die spezifischen persönlichen Eigenschaften einer Person spielen bezüglich ihres
Wahlverhaltens eine signifikante Rolle. Dementsprechend soll auch erörtert
werden, in welchem Zusammenhang die Phänomene Politik-, Politiker- und
Parteienverdrossenheit mit diesen Merkmalen stehen und welche Gruppen dies
betrifft. Welche Rolle spielt außerdem die individuelle wirtschaftliche und soziale
Lage und welche natürlichen Determinanten beeinflussen das Wahlverhalten
insofern, dass eine Wahlenthaltung resultiert?
1 Vgl. Korte, Karl-Rudolf: Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2000, S. 99.
2 Vgl. Kleinhenz, Thomas: Die Nichtwähler. Ursachen der sinkenden Wahlbeteiligung in
Deutschland, Opladen 1995, S. 15.
3 Eilfort, Michael: Die Nichtwähler. Wahlenthaltung als Form des Wahlverhaltens, Paderborn u.a.
1994, S. 54, zit. nach Senti, A.: Die Nichtwähler in Zürich. in: Züricher Statistische Nachrichten;
1926, Heft 4.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die stratifikatorischen Unterschiede in der Gruppe der Nichtwähler
- Der Einfluss des Sozioökonomischen Status (SÖS) auf die Wahlbeteiligung
- Der Bildungsgrad
- Der Beruf und das Einkommen
- Teilfazit
- Individuelle Eigenschaften der Gruppe der Nichtwähler
- Das Geschlecht
- Das Alter
- Der Einflussbereich der Konfession und Kirchenbindung
- Soziale Integration und Randgruppen
- Teilfazit
- Der Einfluss des Sozioökonomischen Status (SÖS) auf die Wahlbeteiligung
- Kategorien von Nichtwählern
- Unechte Nichtwähler
- Grundsätzliche Nichtwähler
- Konjunkturelle Nichtwähler
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Nichtwahl in Deutschland. Ziel ist es, die Gründe für die sinkende Wahlbeteiligung zu analysieren und die stratifikatorischen Unterschiede in der Gruppe der Nichtwähler zu untersuchen. Dabei werden sowohl sozioökonomische Faktoren wie Bildungsgrad, Beruf und Einkommen als auch individuelle Merkmale wie Geschlecht, Alter und Konfession berücksichtigt.
- Stratifikatorische Unterschiede bei Nichtwählern
- Einfluss des Sozioökonomischen Status (SÖS) auf die Wahlbeteiligung
- Individuelle Eigenschaften von Nichtwählern
- Kategorien von Nichtwählern
- Gründe für die Wahlentscheidung Nicht zu wählen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Nichtwahl ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der sinkenden Wahlbeteiligung in Deutschland dar. Das zweite Kapitel befasst sich mit den stratifikatorischen Unterschieden in der Gruppe der Nichtwähler. Es werden die Einflüsse des Sozioökonomischen Status, insbesondere der Bildungsgrad, Beruf und Einkommen, auf die Wahlbeteiligung untersucht. Des Weiteren werden auch individuelle Merkmale wie Geschlecht, Alter und Konfession sowie die soziale Integration der Nichtwähler beleuchtet.
Das dritte Kapitel geht auf verschiedene Kategorien von Nichtwählern ein. Hier werden unechte Nichtwähler, grundsätzliche Nichtwähler und konjunkturelle Nichtwähler unterschieden und ihre jeweiligen Merkmale erläutert. Die Hausarbeit wird mit einem Kapitel zu den Schlussfolgerungen abgeschlossen. Hier werden die Erkenntnisse aus der Analyse zusammengefasst und Schlussfolgerungen für das zukünftige Wahlverhalten gezogen.
Schlüsselwörter
Nichtwahl, Wahlbeteiligung, Sozioökonomischer Status, Bildungsgrad, Beruf, Einkommen, Geschlecht, Alter, Konfession, Soziale Integration, Randgruppen, Unechte Nichtwähler, Grundsätzliche Nichtwähler, Konjunkturelle Nichtwähler.
Häufig gestellte Fragen
Warum sinkt die Wahlbeteiligung in Deutschland seit den 1970er Jahren?
Die Wahlbeteiligung sank von Rekordwerten wie 91,1 % (1972) auf etwa 82,2 % (1998). Gründe hierfür sind nicht mehr nur persönliche Hinderungsgründe, sondern zunehmend bewusste Entscheidungen gegen eine Wahl, oft motiviert durch Politik-, Politiker- oder Parteienverdrossenheit.
Welchen Einfluss hat der sozioökonomische Status (SÖS) auf das Wahlverhalten?
Der sozioökonomische Status, bestehend aus Bildungsgrad, Beruf und Einkommen, spielt eine signifikante Rolle. Personen mit höherem Bildungsgrad und sicherem Einkommen neigen eher zur Wahlteilnahme als wirtschaftlich schwächere Gruppen.
Was unterscheidet "unechte" von "echten" Nichtwählern?
Unechte Nichtwähler sind Personen, die aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse wie plötzlicher Krankheit oder persönlicher Verhinderung nicht wählen können. Echte Nichtwähler treffen hingegen eine bewusste Entscheidung gegen die Stimmabgabe.
Wer sind konjunkturelle Nichtwähler?
Konjunkturelle Nichtwähler entscheiden sich je nach politischer Situation oder Attraktivität der Kandidaten und Themen einer spezifischen Wahl, ob sie teilnehmen oder nicht. Sie sind nicht grundsätzlich gegen das Wählen eingestellt.
Welche Rolle spielt das Alter bei der Wahlbeteiligung?
Das Alter gilt als natürliche Determinante. Statistisch gesehen gibt es Unterschiede in der Wahlbeteiligung verschiedener Altersgruppen, wobei oft junge Erwachsene und sehr alte Menschen niedrigere Beteiligungsraten aufweisen als mittlere Altersgruppen.
Was versteht man unter grundsätzlichen Nichtwählern?
Grundsätzliche Nichtwähler lehnen die Teilnahme an Wahlen prinzipiell ab. Dies kann aus einer tiefen Systemkritik oder einer dauerhaften Entfremdung vom politischen Prozess resultieren.
- Quote paper
- M.A. Stefan Waldheim (Author), 2002, Die Gründe der Nichtwahl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15441