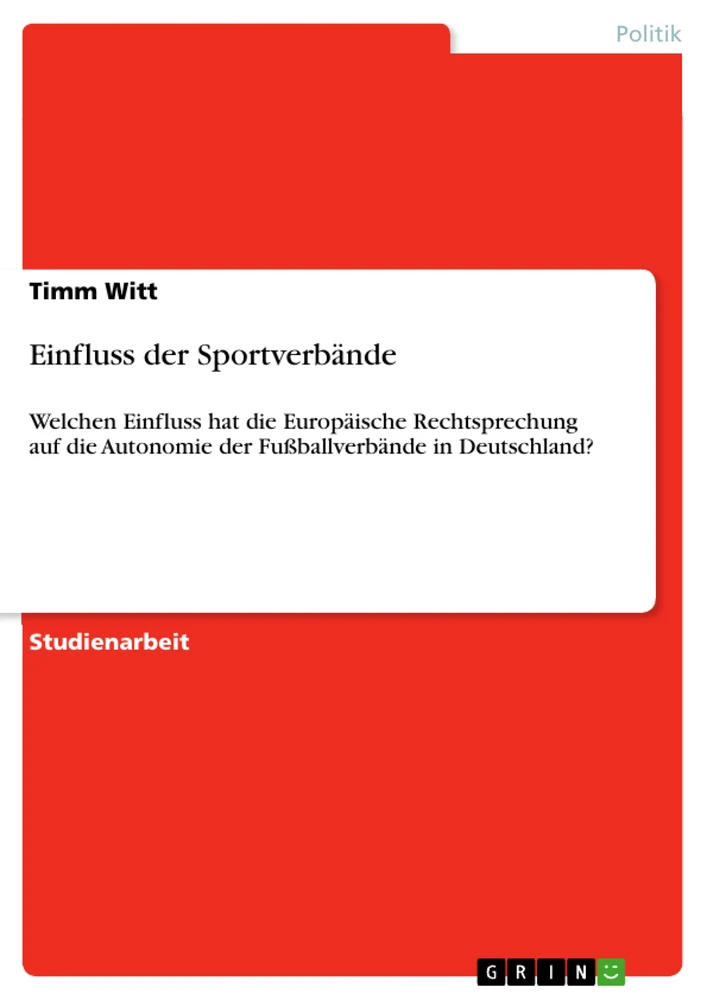In Deutschland tritt der Staat keinesfalls als Organisator und Leiter des Sports auf, welcher sämtliche Dinge des Sports betreffend von oben nach untern bestimmen wollte. Die Beziehung zwischen Staat und Sport ist gerade umgekehrt von unten nach oben strukturiert. Dabei garantiert das Grundgesetz die Autonomie von Sportverbänden und -vereinen, die sich selbst verwalten können und sollen und aus diesem Grund als unabhängig gelten. Diese Selbstverwaltungsgarantie wird durch das Prinzip der Subsidiarität bestätigt, wonach der Staat nur dann mit materiellen und/oder ideellen Förderungsmaßnahmen eingreift oder legislativ tätig wird, falls die eigenen Kräfte der Sportverbände und -vereine nicht ausreichen oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung es erfordern.
Während in den Anfangsjahren des modernen Sports (50er und 60er Jahre) der Einfluss des staatlichen Rechts sehr begrenzt war und lediglich in Einzelfällen bzgl. des Strafrechts oder zivilen Schadenersatzrechts zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit eine Rolle spielte, änderte sich dieses im Zuge der sukzessiven Kommerzialisierung des Sports. Je mehr der Sport zum Wirtschaftssektor avancierte, desto eher und notwendiger musste sich die Beurtei-lung des Sportbetriebs an normative Maßstäbe des materiellen Rechts orientieren.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, inwieweit die den Sportverbänden gewährte Autonomie im Rahmen der Rechtsfindung und -setzung nicht nur nationalrechtliche Grenzen zu beachten hat, sondern sich auch an die Gewährleistung und Anforderungen des europäischen Gemeinschaftsrechts orientieren muss.
Zur Beantwortung dieser Frage wird der Deutsche Fußballbund exemplarisch als weltweit mitgliedsstärkster Fußballverband näher beleuchtet. Zunächst finden eine allgemeine Begriffsabgrenzung und eine Beschreibung der Verwaltung und Organisation deutscher Sportver-bände statt. Anschließend wird speziell auf die Organisation und Interdependenzen der Fußballverbände eingegangen und anhand von ausgewählten Urteilssprüchen der Einfluss natio-naler und internationaler Rechtsprechung auf den DFB kenntlich gemacht. Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsabgrenzung und Organisation deutscher Sportverbände
- 2.1. Begriffsabgrenzung Verbände
- 2.2. Die Verwaltung und Organisation im Sportsystem
- 2.2.1. Die öffentliche Sportverwaltung
- 2.2.2. Selbstverwaltung des Sports
- 2.2.3. Das Ein-Verbands-Prinzip
- 2.2.4. Verbandsautonomie
- 3. Das Verhältnis zwischen europäischer Politik und Rechtsprechung und den Fußballverbänden
- 3.1. Organisation und Interdependenzen der Fußballverbände
- 3.1.1. Die FIFA (Fédération Internationale de Football Association)
- 3.1.2. Die UEFA (Union of European Football Associations)
- 3.1.3. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) e.V.
- 3.1.4. Die Liga - Fußballverband e. V. (Ligaverband)
- 3.1.5. Die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL)
- 3.2. Der Einfluss der nationalen und internationalen Rechtsprechung auf die Fußballverbändepolitik in Deutschland
- 3.2.1. Der Fall Bosman/Das Bosman-Urteil
- 3.2.2. Konfliktäre Beziehung zwischen der Zentralvermarktung der Fernsehrechte und Art. 81 EGV
- 4. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss europäischer Rechtsprechung auf die Autonomie deutscher Fußballverbände. Sie beleuchtet das Spannungsfeld zwischen der Selbstverwaltung im Sport und den Anforderungen des europäischen Gemeinschaftsrechts. Der Deutsche Fußballbund (DFB) dient als Fallbeispiel.
- Die Autonomie deutscher Sportverbände
- Die Rolle des europäischen Rechts im Sport
- Der Einfluss des Bosman-Urteils
- Die Organisation und Struktur deutscher Fußballverbände
- Die Kommerzialisierung des Sports und deren rechtliche Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beziehung zwischen Staat und Sport in Deutschland ein. Sie betont die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie von Sportverbänden und die zunehmende Bedeutung des europäischen Rechts im Kontext der Kommerzialisierung des Sports. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie weit die Autonomie der Verbände durch europäisches Recht eingeschränkt wird, wobei der DFB als Fallbeispiel dient. Die Methodik der Arbeit wird skizziert, die eine Begriffsabgrenzung, die Analyse der Organisationsstruktur der Fußballverbände und die Betrachtung relevanter Rechtsprechung umfasst.
2. Begriffsabgrenzung und Organisation deutscher Sportverbände: Dieses Kapitel liefert zunächst eine Abgrenzung des Begriffs „Verband“ im Kontext des deutschen Sports. Anschließend wird die Organisation des deutschen Sportsystems detailliert beschrieben, wobei die öffentliche Sportverwaltung, die Selbstverwaltung der Sportverbände, das Ein-Verbands-Prinzip und die Verbandsautonomie im Mittelpunkt stehen. Das Kapitel verdeutlicht die komplexe Struktur und die Interdependenzen zwischen verschiedenen Ebenen und Akteuren im deutschen Sport. Der Fokus liegt auf der Selbstverwaltung als zentralem Prinzip des Systems und der damit verbundenen Autonomie der Verbände.
3. Das Verhältnis zwischen europäischer Politik und Rechtsprechung und den Fußballverbänden: Dieses Kapitel analysiert die Interdependenzen zwischen nationalen und internationalen Fußballverbänden (FIFA, UEFA, DFB, Ligaverband, DFL) und untersucht den Einfluss europäischer Rechtsprechung auf deren Politik. Besonderes Augenmerk wird auf das Bosman-Urteil gelegt, das die Transferregeln im Fußball revolutionierte und die Autonomie der Verbände in Frage stellte. Der Konflikt zwischen der Zentralvermarktung von Fernsehrechten und dem europäischen Wettbewerbsrecht wird beleuchtet. Zusammenfassend wird der Einfluss europäischer Rechtsprechung auf die Entscheidungsfreiheit der deutschen Fußballverbände umfassend dargestellt.
Schlüsselwörter
Verbandsautonomie, Europäisches Recht, Sportrecht, Fußball, Deutscher Fußball Bund (DFB), Bosman-Urteil, Kommerzialisierung des Sports, Selbstverwaltung, Europäische Union, Wettbewerbsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss Europäischer Rechtsprechung auf die Autonomie Deutscher Fußballverbände
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss europäischer Rechtsprechung auf die Autonomie deutscher Fußballverbände, insbesondere den Deutschen Fußball-Bund (DFB), im Spannungsfeld zwischen Selbstverwaltung im Sport und europäischem Gemeinschaftsrecht. Sie analysiert die Auswirkungen der Kommerzialisierung des Sports auf die Entscheidungsfreiheit der Verbände.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Autonomie deutscher Sportverbände, die Rolle des europäischen Rechts im Sport, den Einfluss des Bosman-Urteils, die Organisation und Struktur deutscher Fußballverbände (FIFA, UEFA, DFB, Ligaverband, DFL), die Kommerzialisierung des Sports und deren rechtliche Implikationen, sowie das Verhältnis zwischen nationaler und internationaler Rechtsprechung und der Fußballverbandspolitik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsabgrenzung und Organisation deutscher Sportverbände (inkl. öffentlicher Sportverwaltung, Selbstverwaltung, Ein-Verbands-Prinzip und Verbandsautonomie), ein Kapitel zum Verhältnis zwischen europäischer Politik und Rechtsprechung und den Fußballverbänden (inkl. Bosman-Urteil und Zentralvermarktung von Fernsehrechten), und eine zusammenfassende Schlussbetrachtung.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit zeigt den umfassenden Einfluss europäischer Rechtsprechung auf die Entscheidungsfreiheit deutscher Fußballverbände auf. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen der traditionellen Selbstverwaltung im Sport und den Anforderungen des europäischen Rechts ergeben, insbesondere im Kontext der Kommerzialisierung des Fußballs.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Verbandsautonomie, Europäisches Recht, Sportrecht, Fußball, Deutscher Fußball Bund (DFB), Bosman-Urteil, Kommerzialisierung des Sports, Selbstverwaltung, Europäische Union und Wettbewerbsrecht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und die Methodik erläutert. Es folgen Kapitel, die die Begriffe definieren, die Organisationsstrukturen der Fußballverbände beschreiben und die relevante Rechtsprechung analysieren. Die Arbeit endet mit einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung.
Welche Rolle spielt das Bosman-Urteil?
Das Bosman-Urteil wird als ein zentraler Punkt der Arbeit betrachtet, da es die Transferregeln im Fußball revolutionierte und die Autonomie der Verbände erheblich einschränkte. Der Fall wird detailliert analysiert.
Wie wird die Organisation des deutschen Sportsystems dargestellt?
Das deutsche Sportsystem wird in seiner komplexen Struktur dargestellt, mit Fokus auf die Interdependenzen zwischen öffentlicher Sportverwaltung und Selbstverwaltung der Verbände, sowie das Ein-Verbands-Prinzip und die Bedeutung der Verbandsautonomie.
- Arbeit zitieren
- Timm Witt (Autor:in), 2010, Einfluss der Sportverbände, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154508