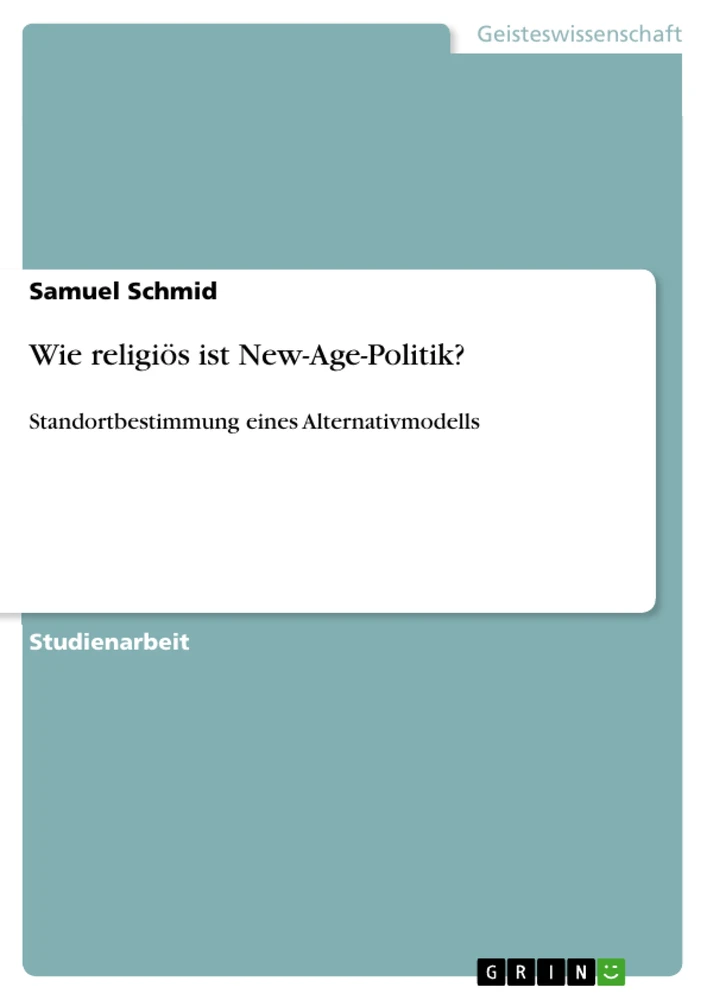Religion verfällt, Religion wird bedeutungslos, Religion stirbt – so der Tenor der säkularen europäischen Moderne. Besonders in der Politik habe Religion nichts (mehr) verloren, die Bereiche sind getrennt. Umso erstaunlicher scheint es, wenn – statt christlicher Parteien oder islamischem Fundamentalismus, die ja durchaus politisch bedeutend sind – unkonventionelle Religion wie New Age scheinbar plötzlich auf die politische Bühne tritt, ja explizit Spiritualität
mit Politik verknüpfen will. So tun dies etwa ‚Die Violetten – für spirituelle Politik„ in Deutschland und bald auch ‚Integrale Politik„ (zurzeit noch ein Verein) in der Schweiz, beides Parteien, die aus New-Age-Strömungen entstanden sind. Was aber ist New-Age-Politik? Und
inwiefern ist sie religiös und spirituell oder politisch und säkular?
Diese Arbeit möchte die wichtigsten Stossrichtungen des New-Age-Paradigmas beschreiben und dessen politische Dimensionen aufzeigen. Die beiden Bereiche von Religion bzw. New-Age-Spiritualität und Politik sowie ihre Berührungspunkte werden an einem empirischen
Fallbeispiel eines Parteiprogramms (‚Integrale Politik„) analysiert. Es wird gefragt, inwiefern New-Age-Politik ‚religiös-spirituell„ und inwieweit sie ‚politisch-säkular„ ist. Oder kurzum: Wie religiös ist New-Age-Politik? Das Interesse gilt also weniger der Typisierung der Partei, sondern dem Problem, inwiefern Religion identifizierbar ist in begrifflichen Gehalten, durch die bestimmte Ausprägungen von Religiosität als derart bedeutsam ausgewiesen werden, dass
sie nicht einfach unter allgemeinere Begriffe wie Kultur oder Werte gefasst werden können.
Roter Faden der Argumentation wird eine Kette von Anknüpfungspunkten sein: Religion / New-Age-Spiritualität – Bewusstseinswandel – Paradigmenwechsel – Kulturkritik / Moral / Ethik / Werte – Politik. Jeder Begriff führt durch eine gewisse Modifikation, Interpretation
und Konsequenz zum nächsten: Religion wird umgeformt in die Spiritualität des New Age, welches wiederum Bewusstseinswandel und einen Paradigmenwechsel, verbunden mit fundamentaler Kulturkritik, propagiert. Dies führt zu einer Moral, einer Ethik und zu Werten, die
schliesslich in der Formulierung politischer Inhalte und Ziele münden. So gelangt man gemäss meinem Vorschlag in diesem Kontext von Religion bis zur Politik.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Religion und Politik: Theoretische Perspektiven
- Renaissance der Religionen?
- Was ist Religion – was ist Politik?
- Der Begriff der Religion
- Der Begriff der Politik
- Interferenzen
- Theoretische Überlegungen zu New Age
- Der New-Age-Komplex: Übersicht und Spezifikation
- Das New-Age-Paradigma
- Grundzüge der New-Age-Politik
- Forschungsdesign
- ,Integrale Politik“ – eine Standortbestimmung
- Zur Bedeutung von, integral
- Integrales Welt- und Menschenbild
- Integrale politische Ordnung
- Integrale Wirtschaftsordnung
- Integrale Bildung, Erziehung und Kultur
- Wissenschaft und Forschung
- Gesundheit und Gesundheitswesen
- Friedensförderung und Sicherheitspolitik
- Binnenleben und Kultur der integralen Politik
- Fazit
- Auswertung der Inhaltsanalyse
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die politische Dimension des New-Age-Paradigmas und analysiert, inwiefern sich religiöse bzw. spirituell motivierte Inhalte in politischen Konzepten wiederfinden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob und wie sich New-Age-Politik als „religiös-spirituell“ oder „politisch-säkular“ verstehen lässt. Die Untersuchung greift auf ein empirisches Fallbeispiel eines Parteiprogramms zurück, um diese Frage zu beleuchten.
- Das Verhältnis von Religion und Politik im Kontext der Säkularisierung
- Der New-Age-Komplex und seine politische Dimension
- Die Analyse von ,Integrale Politik' als Fallbeispiel für New-Age-Politik
- Die Frage nach der religiösen Substanz in politischen Konzepten
- Der Zusammenhang zwischen Religion, Bewusstseinswandel, Paradigmenwechsel und politischer Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Untersuchung dar. Sie beleuchtet die besondere Bedeutung von New Age in der politischen Landschaft und die damit verbundenen Fragen nach der Verbindung von Spiritualität und Politik.
- Kapitel 2 beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Religion und Politik, insbesondere im Kontext der Säkularisierungsthese. Es werden unterschiedliche Begriffsdefinitionen von Religion und Politik erörtert und die Frage der Interferenz zwischen beiden Bereichen untersucht.
- Kapitel 3 widmet sich dem New-Age-Paradigma und seinen theoretischen Grundlagen. Es werden die wichtigsten Strömungen des New Age beschrieben und die politischen Dimensionen des Paradigmas aufgezeigt.
- Kapitel 4 skizziert das Forschungsdesign der Untersuchung und erläutert die verwendeten Methoden und die Operationalisierung der zentralen Begriffe. Es wird ein empirisches Fallbeispiel, ,Integrale Politik', vorgestellt, das als Grundlage für die Inhaltsanalyse dient.
- Kapitel 5 analysiert das Parteiprogramm von ,Integrale Politik' und untersucht, inwiefern sich religiös-spirituelle Elemente in politischen Konzepten und Zielen widerspiegeln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen New-Age-Politik, Religion, Politik, Säkularisierung, Spiritualität, Bewusstseinswandel, Paradigmenwechsel, Kulturkritik, Werte, Integralismus, ,Integrale Politik', Inhaltsanalyse, Empirie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist New-Age-Politik?
Es handelt sich um politische Strömungen, die explizit Spiritualität mit Politik verknüpfen und einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel durch Bewusstseinswandel anstreben.
Ist New-Age-Politik religiös oder säkular?
Die Arbeit analysiert diese Grenzziehung und fragt, inwiefern religiöse Inhalte in politischen Programmen identifizierbar sind oder ob sie unter Begriffe wie Werte und Kultur fallen.
Was ist die Partei „Integrale Politik“?
In der Arbeit dient „Integrale Politik“ (Schweiz) als empirisches Fallbeispiel, um die Umsetzung von New-Age-Spiritualität in konkrete politische Forderungen zu untersuchen.
Welche Rolle spielt der „Bewusstseinswandel“ in diesem Konzept?
Der Bewusstseinswandel gilt als Voraussetzung für einen Paradigmenwechsel, der wiederum zu neuen ethischen Werten und schließlich zu veränderten politischen Zielen führt.
Wie wird das Verhältnis von Religion und Politik theoretisch eingeordnet?
Die Untersuchung setzt sich mit der Säkularisierungsthese auseinander und prüft, ob wir eine Renaissance der Religionen in unkonventioneller Form erleben.
- Quote paper
- Samuel Schmid (Author), 2010, Wie religiös ist New-Age-Politik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154547