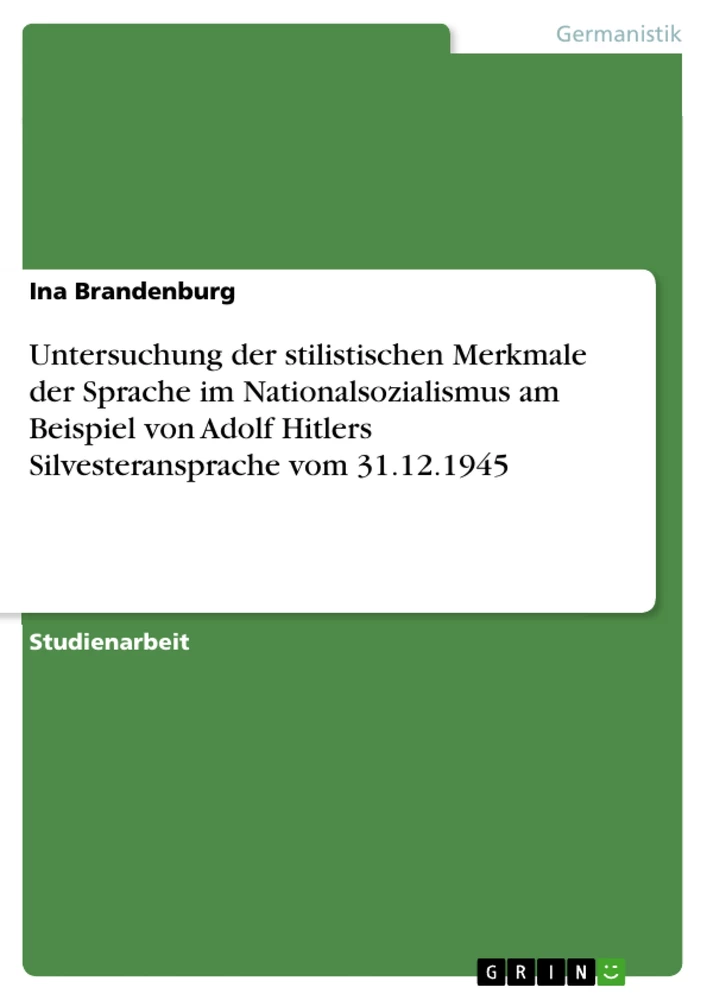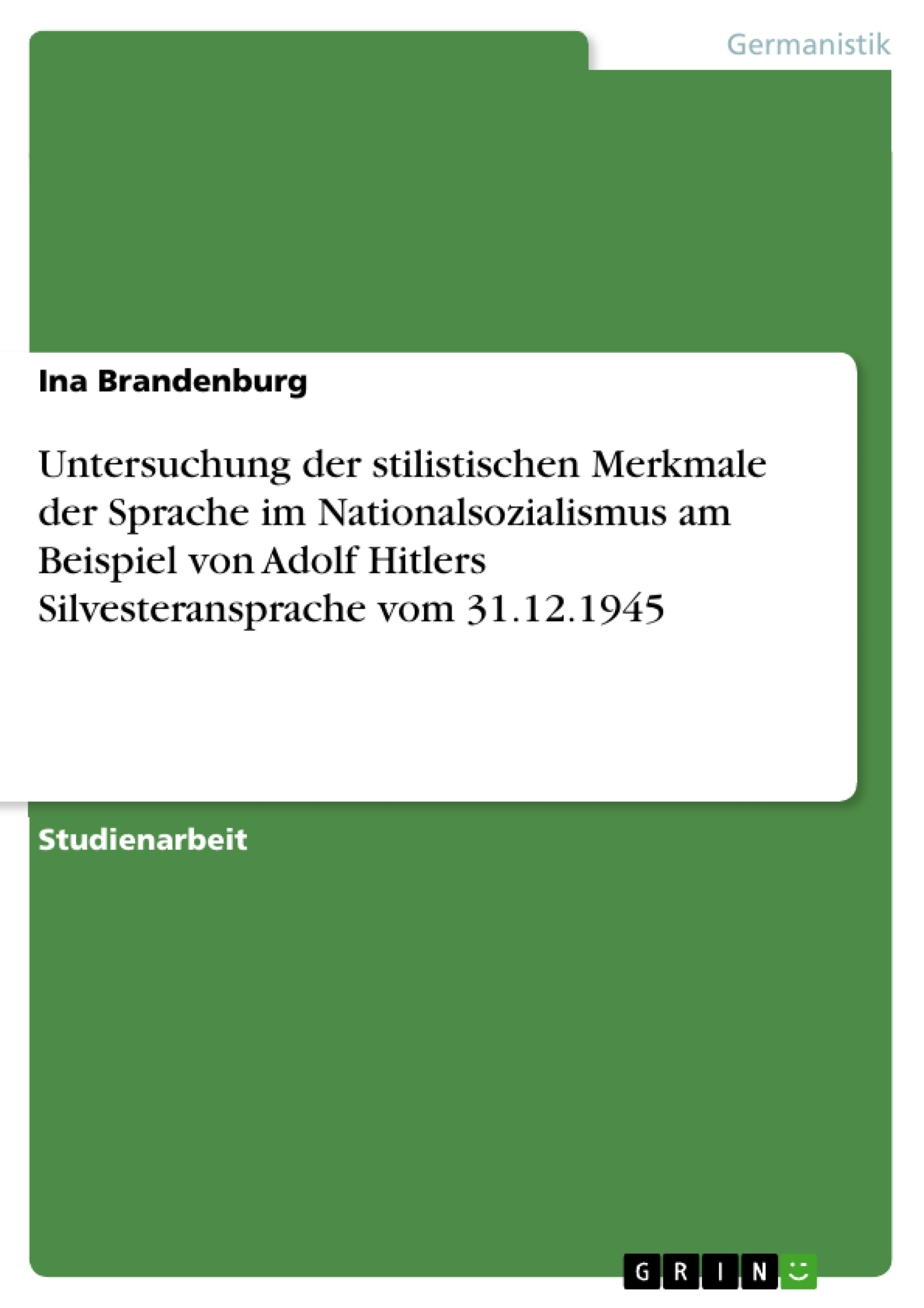Die Niederlage der deutschen Armee und andauernde Bombenangriffe der Briten lassen die Stimmung der Deutschen im Jahr 1943 auf einen Nullpunkt sinken. Dennoch lässt sich die Bevölkerung, durch die von Goebbels vorgetragene Propagandarede im Berliner Sportpalast am 18.02.1943, von der Forderung nach totalem Krieg vorbehaltlos mitreißen.
Angesichts dieses Ereignisses drängt sich die Frage auf, wie ein einzelner Mensch allein durch Worte solche Überzeugungskraft ausüben kann.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich aus diesem Grund mit einigen prägnanten stilistischen Merkmalen der Sprache im Nationalsozialismus und ihren Auswirkungen. Zunächst sollen spezifische Stilmerkmale im Überblick herausgestellt werden um diese dann im Folgenden auf Adolf Hitlers Silvesteransprache vom 31.12.1944 anzuwenden und zu belegen. Ferner soll abschließend die Debatte um die Existenz einer Sprache des Nationalsozialismus aufgegriffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Stilistische Merkmale der Sprache im Nationalsozialismus
- Häufige Verwendung von Vokabeln
- Einsatz von Metaphern
- Umdeutungen und Umwertungen
- Superlativischer Stil
- Religiöse Stilelemente
- Kompositionen und Derivationen
- Euphemismen
- Vorüberlegungen zur Analyse der Silvesteransprache Adolf Hitlers
- Analyse der Silvesteransprache Adolf Hitlers vom 31.12.1944
- Diskussion um die Existenz einer Sprache des Nationalsozialismus
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die stilistischen Merkmale der Sprache im Nationalsozialismus anhand von Adolf Hitlers Silvesteransprache 1944. Ziel ist es, spezifische stilistische Mittel zu identifizieren und deren Wirkung zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Debatte um die Existenz einer eigenständigen nationalsozialistischen Sprache.
- Stilistische Mittel der nationalsozialistischen Propaganda
- Analyse der rhetorischen Strategien in Hitlers Silvesteransprache
- Die Wirkung von Sprache auf die Bevölkerung im Nationalsozialismus
- Die ideologischen Funktionen von Sprache
- Die Debatte um den Begriff "Sprache des Nationalsozialismus"
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt den Kontext der Arbeit, ausgehend von der desolaten Stimmung in Deutschland 1943 und dem Einfluss von Goebbels' Propaganda. Es wird die Frage aufgeworfen, wie Hitler durch Worte solche Überzeugungskraft erlangte. Die Arbeit fokussiert auf stilistische Merkmale der NS-Sprache und deren Anwendung in Hitlers Silvesteransprache 1944, sowie auf die Debatte um eine spezifische NS-Sprache.
Stilistische Merkmale der Sprache im Nationalsozialismus: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über charakteristische stilistische Merkmale der nationalsozialistischen Sprache. Es analysiert die Verwendung volkstümlicher Vokabeln, einfacher Satzstrukturen, emotional aufgeladener Schlagworte, und die politische Instrumentalisierung alltäglicher Wörter. Es wird betont, dass die NS-Sprache nicht eine völlig neue Sprache war, sondern bereits bestehende Wörter ideologisch umdeutete und umfunktionierte, und dass sie sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich manifestierte.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Sprache, Stilistik, Propaganda, Adolf Hitler, Silvesteransprache, Rhetorik, Metaphern, Wortbedeutung, Ideologie, Volkssprache.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Silvesteransprache Adolf Hitlers
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die stilistischen Merkmale der Sprache im Nationalsozialismus anhand der Silvesteransprache Adolf Hitlers aus dem Jahr 1944. Sie untersucht spezifische stilistische Mittel, deren Wirkung und die Debatte um die Existenz einer eigenständigen nationalsozialistischen Sprache.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt stilistische Mittel der nationalsozialistischen Propaganda, die rhetorischen Strategien in Hitlers Silvesteransprache, die Wirkung der Sprache auf die Bevölkerung, die ideologischen Funktionen von Sprache und die Debatte um den Begriff "Sprache des Nationalsozialismus". Konkret werden Aspekte wie die Verwendung von Vokabeln, Metaphern, Umdeutungen, Superlative, religiöse Elemente, Kompositionen, Derivationen und Euphemismen analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält ein Vorwort, ein Kapitel zu den stilistischen Merkmalen der Sprache im Nationalsozialismus, ein Kapitel zu Vorüberlegungen zur Analyse der Silvesteransprache, die Analyse der Silvesteransprache selbst, eine Diskussion um die Existenz einer Sprache des Nationalsozialismus und eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Identifizierung und Analyse spezifischer stilistischer Mittel in der Sprache des Nationalsozialismus, insbesondere in Hitlers Silvesteransprache 1944. Es soll die Wirkung dieser Mittel untersucht und die Debatte um eine eigenständige nationalsozialistische Sprache beleuchtet werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Nationalsozialismus, Sprache, Stilistik, Propaganda, Adolf Hitler, Silvesteransprache, Rhetorik, Metaphern, Wortbedeutung, Ideologie, Volkssprache.
Wie wird die Silvesteransprache analysiert?
Die Analyse der Silvesteransprache konzentriert sich auf die stilistischen Mittel, die Hitler einsetzt, um seine Botschaft zu vermitteln. Es wird untersucht, wie er Sprache als Werkzeug der Propaganda nutzt und welche Wirkung dies auf die Zuhörer hatte.
Gibt es ein Fazit oder eine Zusammenfassung?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse zusammenfasst und die Forschungsfragen beantwortet.
Was wird im Vorwort beschrieben?
Das Vorwort beschreibt den Kontext der Arbeit, die Stimmung in Deutschland 1943, den Einfluss von Goebbels' Propaganda und die Frage nach Hitlers Überzeugungskraft durch Worte. Es wird der Fokus der Arbeit auf die stilistischen Merkmale der NS-Sprache und die Debatte um eine spezifische NS-Sprache erläutert.
Wie wird die NS-Sprache charakterisiert?
Die NS-Sprache wird als nicht völlig neu, sondern als Umdeutung und Umfunktionierung bestehender Wörter charakterisiert. Es werden volkstümliche Vokabeln, einfache Satzstrukturen und emotional aufgeladene Schlagworte als charakteristisch genannt. Ihre Manifestation im öffentlichen und privaten Bereich wird betont.
- Citar trabajo
- Ina Brandenburg (Autor), 2008, Untersuchung der stilistischen Merkmale der Sprache im Nationalsozialismus am Beispiel von Adolf Hitlers Silvesteransprache vom 31.12.1945, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154562