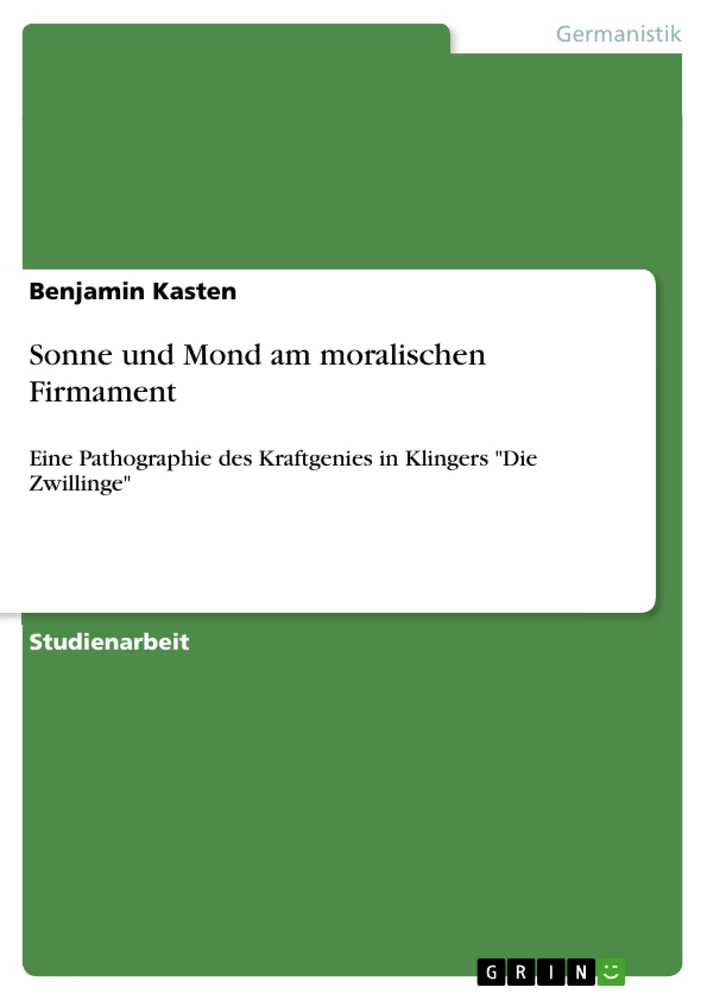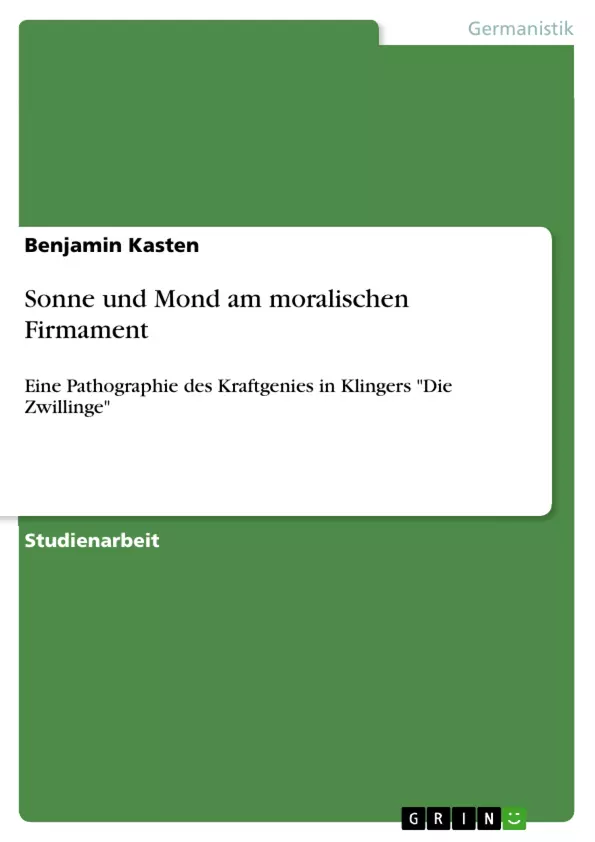"Vernunft und Gefühl sind die Sonne und der Mond am moralischen Firmament. Immer nur in der heißen Sonne würden wir verbrennen; immer nur im kühlen Mond würden wir erstarren."
Die schlichte Schönheit dieses Gleichnisses von Friedrich Maximilian Klinger verschweigt nur allzu mildstimmend den stürmischen Zwist, aus dem das Harmoniebewusstsein des Dichters erst hervorgehen konnte. Der Zwist meint die Kontroverse um das angemessene Moralkonzept in einer Zeit des Umbruchs und deutet auf die literarische Strömung des Sturm und Drang.
Vor allem in Klingers frühem, 1776 veröffentlichten Drama Die Zwillinge wird in programmatischer Weise das Aufeinanderprallen von Gefühl und Vernunft, von Empirismus und Rationalismus in der Spätaufklärung, zum entscheidenden geistigen und gesellschaftlichen Ereignis erhoben. Die Ethiken beider philosophischer Schulen jedoch sind mit Mängeln behaftet; ihre Bestrebungen nach absoluter Geltung sind verfehlt.
In Die Zwillinge wird das Opfer dieser mangelbehafteten Moralkonzepte, das junge Kraftgenie Guelfo, zugleich deren Ankläger. Um die Opferfunktion Guelfos zu konkretisieren, werden in einem ersten Schritt, zunächst am Text, einige pathologische Indikatoren zusammengetragen, die dann die Grundlage für das Deutungspotential des entstellten Genies bilden. Unter systemtheoretischen Gesichtspunkten und unter der Prämisse der Reziprozität von Gesellschaft und philosophischen Ideen, soll beschrieben werden, dass im Drama Die Zwillinge die entstandene moralische Desorientierung über die Pathologisierung des Genies gekennzeichnet ist. Um die moralische Desorientierung zu belegen, schließt sich eine sprachphilosophisch und tugendethisch orientierte Untersuchung der konzeptionellen Mängel des Rationalismus an, die, wie gezeigt wird, über die Pathologisierung Guelfos angeklagt werden. Im Anschluss, unter gleich bleibender philosophischer Methodik und unter Berücksichtigung sozialgeschichtlicher Prozesse, soll gezeigt werden, inwieweit die empiristisch beeinflusste Empfindsamkeit die konzeptionellen Mängel des Rationalismus aufheben kann und worin ihre ethischen Grenzen liegen. Das Ziel der Arbeit soll sein, eine Deutung darin auszumachen, dass das Genieideal von Klinger in der Hauptfigur Guelfo gezielt entstellt wurde, um den Absolutheitsanspruch unvollständiger Moralkonzepte und die moralische Desorientierung der Spätaufklärung, polemisch zu thematisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Pathologische Indikatoren im Dramentext
- Das Deutungspotential des pathologisierten Geniekonzepts
- Die repressive Vernunft
- Die Negierung der emotionalen Repression
- Die Negierung des Bündnisses zwischen Vernunft und Tradition
- Die motivationalen Ressourcen der Emotionen
- Die Negation des empfindsamen Kompromisses
- Das begrenzte Gefühlskonzept
- Die repressive Vernunft
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Klingers Drama „Die Zwillinge“ und analysiert die Darstellung des Kraftgenies Guelfo. Ziel ist es, die Pathologisierung Guelfos als Kritik an den unvollständigen Moralkonzepten der Spätaufklärung zu interpretieren. Die Arbeit beleuchtet den Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl und untersucht, wie dieser Konflikt in Guelfos Charakter und Handeln zum Ausdruck kommt.
- Die Pathologisierung des Genieideals in Klingers „Die Zwillinge“
- Der Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl in der Spätaufklärung
- Die Kritik an den Mängeln rationalistischer und empiristischer Moralkonzepte
- Die Darstellung von emotionaler Repression und deren Folgen
- Guelfos Opferfunktion und seine Rolle als Ankläger mangelhafter Moralkonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat Klingers, das den zentralen Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl im Drama „Die Zwillinge“ vorwegnimmt. Sie führt in die Thematik des Sturm und Drang ein und skizziert die zentrale These der Arbeit: Die Pathologisierung des Genies Guelfo dient als Kritik an den unvollständigen Moralkonzepten der Spätaufklärung. Der Fokus liegt auf der Analyse der Opferfunktion Guelfos und der Untersuchung der konzeptionellen Mängel des Rationalismus und Empirismus.
Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die sich mit verschiedenen Aspekten der Pathologisierung Guelfos auseinandersetzen. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die Identifizierung pathologischer Indikatoren im Text, indem er Guelfos Verhalten und seine inneren Konflikte analysiert. Der zweite Abschnitt untersucht das Deutungspotential dieses pathologisierten Geniekonzepts. Er erörtert die repressive Vernunft und die Grenzen der Empfindsamkeit. Der Abschnitt analysiert die konzeptionellen Mängel des Rationalismus und untersucht, inwieweit die empiristisch beeinflusste Empfindsamkeit diese Mängel ausgleichen kann und wo ihre ethischen Grenzen liegen. Die Analyse basiert auf systemtheoretischen Gesichtspunkten und der Prämisse der Reziprozität von Gesellschaft und philosophischen Ideen. Es wird argumentiert, dass die moralische Desorientierung der Spätaufklärung sich in der Pathologisierung des Genies manifestiert.
Schlüsselwörter
Sturm und Drang, Klinger, Die Zwillinge, Guelfo, Genie, Pathologisierung, Vernunft, Gefühl, Empfindsamkeit, Rationalismus, Empirismus, Moralkonzept, Spätaufklärung, moralische Desorientierung, Opferfunktion, psychische Erkrankung.
Häufig gestellte Fragen zu Klingers "Die Zwillinge"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Drama "Die Zwillinge" mit dem Fokus auf die Darstellung des Kraftgenies Guelfo. Im Zentrum steht die Interpretation der Pathologisierung Guelfos als Kritik an den unvollständigen Moralkonzepten der Spätaufklärung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl in Guelfos Charakter und Handeln und interpretiert die Pathologisierung des Genieideals als Ausdruck der Kritik an den Mängeln des Rationalismus und Empirismus. Es wird die Opferfunktion Guelfos und seine Rolle als Ankläger mangelhafter Moralkonzepte beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Pathologisierung des Genieideals in Klingers "Die Zwillinge", den Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl in der Spätaufklärung, die Kritik an rationalistischen und empiristischen Moralkonzepten, die Darstellung emotionaler Repression und deren Folgen sowie Guelfos Opferfunktion und seine Rolle als Ankläger mangelhafter Moralkonzepte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Hauptteil analysiert pathologische Indikatoren in Guelfos Verhalten und untersucht das Deutungspotential des pathologisierten Geniekonzepts, insbesondere die repressive Vernunft und die Grenzen der Empfindsamkeit im Kontext der Spätaufklärung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Analyse basiert auf systemtheoretischen Gesichtspunkten und der Prämisse der Reziprozität von Gesellschaft und philosophischen Ideen. Es wird die moralische Desorientierung der Spätaufklärung in der Pathologisierung des Genies als Ausdruck der Konflikte zwischen Vernunft und Gefühl gesehen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Sturm und Drang, Klinger, Die Zwillinge, Guelfo, Genie, Pathologisierung, Vernunft, Gefühl, Empfindsamkeit, Rationalismus, Empirismus, Moralkonzept, Spätaufklärung, moralische Desorientierung, Opferfunktion, psychische Erkrankung.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung beginnt mit einem Zitat Klingers, das den zentralen Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl vorwegnimmt. Sie führt in die Thematik des Sturm und Drang ein und skizziert die zentrale These der Arbeit: Die Pathologisierung Guelfos dient als Kritik an den unvollständigen Moralkonzepten der Spätaufklärung. Der Fokus liegt auf der Analyse der Opferfunktion Guelfos und der Untersuchung der konzeptionellen Mängel des Rationalismus und Empirismus.
Wie ist der Hauptteil aufgebaut?
Der Hauptteil analysiert die Pathologisierung Guelfos in verschiedenen Abschnitten. Ein Abschnitt konzentriert sich auf die Identifizierung pathologischer Indikatoren im Text, während ein weiterer Abschnitt das Deutungspotential des pathologisierten Geniekonzepts erörtert. Hier werden die repressive Vernunft und die Grenzen der Empfindsamkeit im Kontext der Spätaufklärung analysiert, sowie die konzeptionellen Mängel des Rationalismus und die ethischen Grenzen der empiristisch beeinflussten Empfindsamkeit untersucht.
- Quote paper
- Benjamin Kasten (Author), 2008, Sonne und Mond am moralischen Firmament, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154636