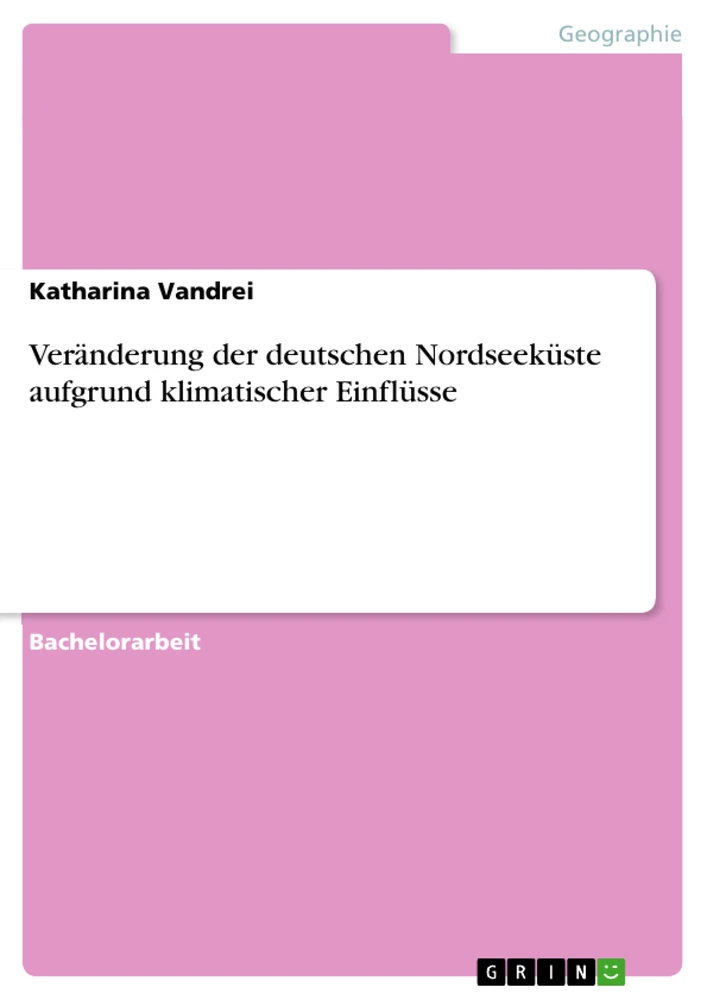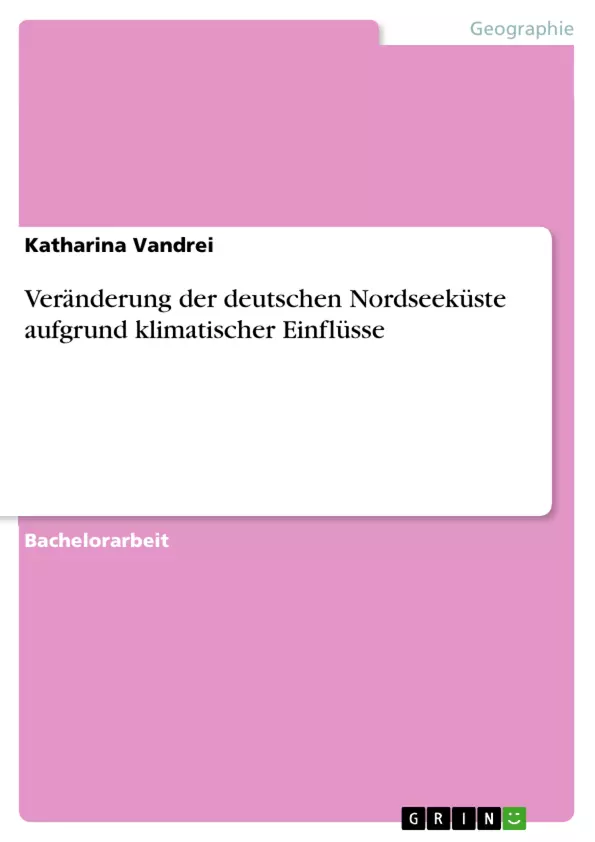,,Klimawandel“, ,,Klimaerwärmung“, ,,Klimakatastrophe“, ,,Klimaveränderung“, ,,globale Erwärmung“ etc. sind Begriffe, die am Ende des 20. Jahrhunderts geprägt wurden und seit den Anfängen des 21. Jahrhunderts zum medialen Alltag gehören. Die Klimaforschung steht so stark in den öffentlichen Diskussionen wie keine andere Wissenschaft, denn das Thema betrifft die Menschen und ihre Umgebung. Forscher, Politiker, diverse Formen der Medien, Umweltorganisationen, Lobbyorganisationen der Wirtschaft und auch nur Interessierte analysieren und interpretieren ihre Ergebnisse auf ganz unterschiedliche Art und Weise, sodass es für den normalen Bürger ,,Max Mustermann“ oft schwierig ist, verlässliche Informationen von den ,,Horrorszenarien“ zu trennen. Besonders anfangs des 21. Jahrhunderts diskutierten und stritten die Akteure über die Ursache des Klimawandels. Die einen hielten die Temperaturanstiege für ein ausschließlich natürliches Phänomen, andere Akteure sprachen ,,vom Menschen verursachte Klimaerwärmung“. Doch mindestens seit dem Weltklimabericht im Jahre 2007 des zwischenstaatlichen Klimabeirates IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist der lang diskutierte Klimawandel aktenkundig und es ist damit nicht mehr zu leugnen, dass der Mensch das Weltklima entscheidend beeinflusst und dass es in den nächsten Jahrzehnten zu gravierenden globalen Veränderungen kommen wird. Folgerungen und Zukunftsszenarien über den Klimawandel beruhen auf Messdaten, Modelle und auf ein physikalisches Verständnis der Wissenschaftler, sodass die Sorge um die Veränderungen unseres Planeten begründet ist. Die zum Beispiel stark ansteigenden Treibhausgase in unserer Atmosphäre beruhen auf gemessene Daten aus den antarktischen Eisbohrkernen, die deutlich aussagen, dass die CO2 –Konzentration nie so hoch war seit einer Millionen Jahre. Weiterhin bestätigt die Tatsache, dass die Jahre 1998 und 2001 bis einschließlich 2005 die sechs wärmsten seit den Aufzeichnungen 1861 waren (RAHMSTORF & SCHELLNHUBER 20076: 8). Unser Klima wird wärmer und wird laut Modellen in den nächsten Jahrzehnten Rekordtemperaturen erreichen, wenn die Menschen nicht im Begriff sind, Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Topographische Einordnung der deutschen Nordseeküste
- 2.1 Schleswig-Holsteinische Nordseeküste
- 2.2 Niedersächsische Nordseeküste
- 3. Formung der Nordseeküstenlandschaft im Quartär
- 3.1 Norddeutschland zwischen Tertiär und Quartär
- 3.2 Norddeutsches Pleistozän
- 3.3 Küstenholozän
- 3.3.1 Globale Veränderungen
- 3.3.2 Entwicklung der Nordseeküsten
- 4. Vorherrschendes Klima im Nordseeküstenbereich
- 4.1 Niederschlag
- 4.2 Luft- und Wassertemperatur
- 4.3 Bewölkung
- 4.4 Wind
- 5. Wind - klimatisches Kriterium für Formungsprozesse
- 5.1 Wellen: Motor der Küstenformung
- 5.1.1 Entstehung von Wellen
- 5.1.2 Wellenbrechen
- 5.1.3 Praxisbeispiel der Küstenformung: Verlagerung der Insel Spiekeroog
- 5.2 Naturereignis Sturmfluten
- 5.2.1 Eigenschaften des Phänomens Sturmflut
- 5.2.2 Historie der Sturmfluten an der Nordseeküste
- 6. Zukunft der deutschen Nordseeküste in Gefahr: Szenarien
- 6.1 Klimaerwärmung und Erliegen des Golfstroms
- 6.2 Gletscherschwund und Meeresspiegelanstieg
- 6.3 Meereserwärmung und regionale Klimaveränderungen
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Arbeit befasst sich mit der Veränderung der deutschen Nordseeküste aufgrund klimatischer Einflüsse. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung der Küstenlandschaft im Quartär und untersucht die prägenden klimatischen Faktoren, insbesondere Wind und Sturmfluten. Darüber hinaus werden Szenarien zur zukünftigen Entwicklung der Nordseeküste im Kontext des Klimawandels betrachtet.
- Geomorphologische Entwicklung der Nordseeküste im Quartär
- Klimatische Einflussfaktoren auf die Küstenformung
- Die Rolle des Windes für die Küstenentwicklung
- Naturereignisse wie Sturmfluten und ihre Auswirkungen
- Zukünftige Szenarien der Küstenentwicklung im Kontext des Klimawandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz des Themas darlegt. Anschließend erfolgt eine topographische Einordnung der deutschen Nordseeküste, die die Küstengebiete Schleswig-Holsteins und Niedersachsens beschreibt. Kapitel 3 befasst sich mit der Formung der Nordseeküstenlandschaft im Quartär und analysiert die geomorphologischen Prozesse, die zur heutigen Küstenform geführt haben. In Kapitel 4 werden die vorherrschenden klimatischen Bedingungen im Nordseeküstenbereich beleuchtet, wobei besondere Aufmerksamkeit dem Niederschlag, der Luft- und Wassertemperatur, der Bewölkung und dem Wind gewidmet wird.
Kapitel 5 widmet sich dem Wind als entscheidendes klimatisches Kriterium für die Küstenformung. Es werden die Entstehung und Auswirkung von Wellen, die Rolle von Sturmfluten sowie deren Auswirkungen auf die Küstenlandschaft behandelt. Das Kapitel endet mit einem Praxisbeispiel der Küstenformung durch die Verlagerung der Insel Spiekeroog. Kapitel 6 widmet sich der Zukunft der deutschen Nordseeküste im Kontext des Klimawandels und untersucht verschiedene Szenarien, wie z. B. die Auswirkungen der Klimaerwärmung, des Gletscherschwunds und des Meeresspiegelanstiegs auf die Küstenlandschaft.
Schlüsselwörter
Nordseeküste, Klimawandel, Küstenformung, Quartär, Wind, Wellen, Sturmfluten, Meeresspiegelanstieg, Szenarien, Klimaerwärmung, Gletscherschwund, Küstenlandschaft, geomorphologische Prozesse, Nordsee, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der Klimawandel die deutsche Nordseeküste?
Durch steigende Temperaturen, den Meeresspiegelanstieg und häufigere Sturmfluten verändert sich die Geomorphologie der Küstenlandschaft nachhaltig.
Welche Rolle spielt der Wind bei der Küstenformung?
Wind ist der Motor für Wellenbildung und Sturmfluten, welche entscheidend zur Erosion und Verlagerung von Inseln (z.B. Spiekeroog) beitragen.
Was sind die Folgen des Meeresspiegelanstiegs für Norddeutschland?
Es drohen Landverluste, die Gefährdung von Küstenschutzanlagen (Deiche) und gravierende Veränderungen im Ökosystem Wattenmeer.
Wie hat sich die Nordseeküste historisch entwickelt?
Die Arbeit analysiert die Formung im Quartär, insbesondere im Pleistozän und Holozän, um heutige Prozesse besser zu verstehen.
Was sagt der Weltklimabericht (IPCC) über die Zukunft aus?
Der Bericht bestätigt den menschlichen Einfluss auf das Weltklima und prognostiziert gravierende globale Veränderungen für die kommenden Jahrzehnte.
- Citar trabajo
- Katharina Vandrei (Autor), 2009, Veränderung der deutschen Nordseeküste aufgrund klimatischer Einflüsse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154727