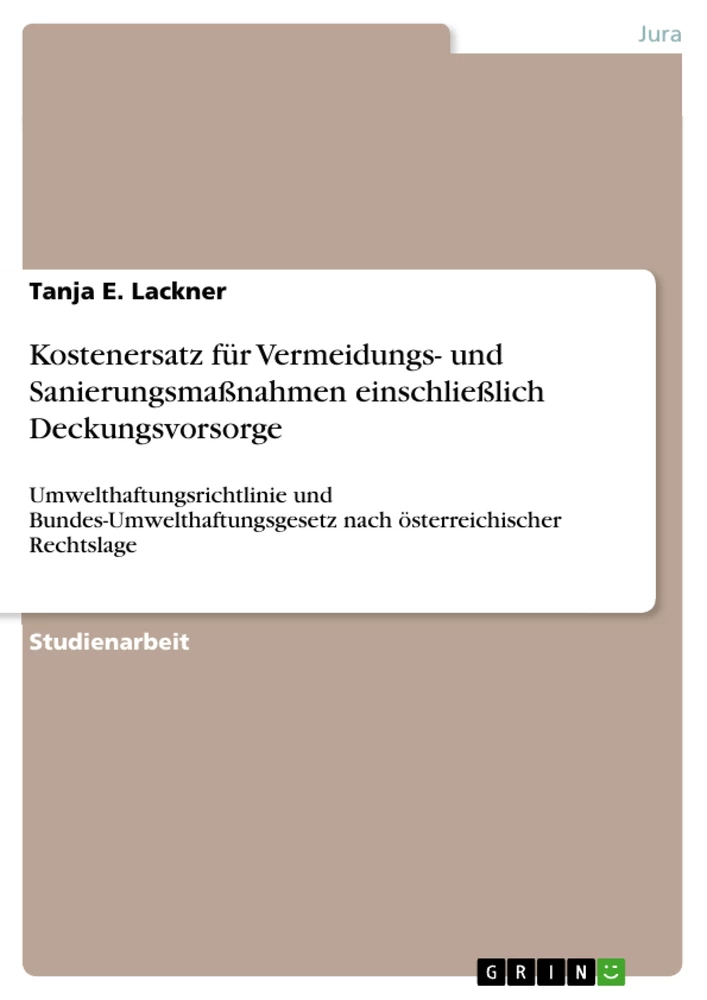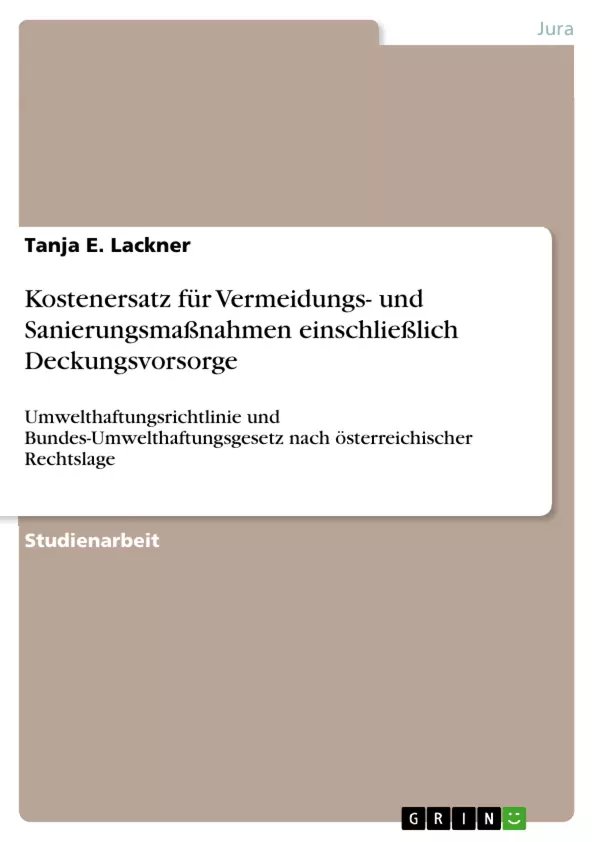Die Umwelthaftungsrichtlinie beabsichtigt einen einheitlichen Ordnungsrahmen zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden an Biodiversität, Gewässern und Boden zu vertretbaren Kosten für die Allgemeinheit und wurde in Österreich durch das Bundesumwelthaftungsgesetz in die Rechtsordnung transformiert. Die UH-RL greift auf das Haftungsregime des öffentlichen Rechts zurück und trägt dem Verursacherprinzip Rechnung: derjenige, welcher einen Umweltschaden oder die unmittelbare Gefahr eines solchen herbeiführt, wird finanziell in die Verantwortung genommen. Potentielle und tatsächliche Schädiger haften gegenüber der Allgemeinheit bereits für die Schaffung einer Gefahrenlage, welche den Eintritt eines Umweltschadens hinreichend wahrscheinlich erscheinen lässt, wenn diese auf eine bestimmte Tätigkeit iSd Anhang III der UH-RL (bzw Anhang 1 Z 1 bis 11 des B-UHG) zurückzuführen ist. Solche Tätigkeiten sind – grob umschrieben – der Betrieb von Anlagen nach dem Anlagenrecht, die (Indirekt-)Einleitung iSd WRG 1959 iVm den Abwasseremissionsverordnungen oder die Nutzung des Wassers für Herstellungsverfahren oder als Transportweg zu verstehen. Nicht umfasst sind jene Tätigkeiten, welche nicht im Zusammenhang mit oder aus dem Anlass einer Tätigkeit iSd Anhang 1 Z 1 bis 11 des B-UHG stehen.
Diese Arbeit befasst sich mit den Instrumenten, die geeignet wären, als Deckungsvorsorge nach der Umwelthaftungsrichtlinie zu dienen. Außerdem werden die Kosten, welche bei Vermeidungs- und Sanierungstätigkeiten anfallen, dargestellt und die Kostentragung beleuchtet (österr. Rechtslage).
Inhaltsverzeichnis
- Die Haftung nach der Umwelthaftungsrichtlinie und dem BundesumwelthaftungsG
- Das Bundesumwelthaftungsgesetz (B-UHG) im Überblick
- Die subsidiäre Liegenschaftseigentümerhaftung
- Das behördliche Vorgehen bei Gefahr im Verzug
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Dokument analysiert die Umwelthaftungsrichtlinie (UH-RL) und das Bundesumwelthaftungsgesetz (B-UHG) in Österreich. Es beleuchtet die Haftung für und Sanierung von Umweltschäden und stellt den rechtlichen Rahmen für die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden an Biodiversität, Gewässern und Boden vor. Der Fokus liegt auf der Kostenersatzpflicht von Verursachern von Umweltschäden und der Einbindung des Verursacherprinzips.
- Die Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in Österreich durch das B-UHG
- Das Verursacherprinzip im Kontext der Umwelthaftung
- Die Haftung für die Schaffung einer Gefahrenlage für Umweltschäden
- Die subsidiäre Haftung von Liegenschaftseigentümern
- Das behördliche Vorgehen bei Gefahr im Verzug
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Haftung nach der Umwelthaftungsrichtlinie und dem BundesumwelthaftungsG: Dieser Abschnitt erläutert die Ziele und die rechtliche Grundlage der Umwelthaftungsrichtlinie und des B-UHG. Es wird dargelegt, wie das Verursacherprinzip in der Gesetzgebung verankert ist und welche Tätigkeiten unter die Haftung fallen. Der Abschnitt beleuchtet auch die Bedeutung der Kostenersatzpflicht für die Allgemeinheit.
- Das Bundesumwelthaftungsgesetz (B-UHG) im Überblick: Dieser Abschnitt analysiert das B-UHG im Detail und beschreibt die verschiedenen Haftungsbereiche, insbesondere die Haftungsverschuldensunabhängigkeit und die Solidarhaftung mehrerer Verursacher. Der Abschnitt verdeutlicht außerdem die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Bereich des Bodenschutzes.
- Die subsidiäre Liegenschaftseigentümerhaftung: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der subsidiären Haftung des Liegenschaftseigentümers im Fall der Nicht-Heranziehbarkeit des Betreibers einer gefährdenden Tätigkeit. Die Bedingungen für die Haftung des Liegenschaftseigentümers werden erläutert und die rechtliche Grundlage für diese Regelung wird im Zusammenhang mit dem Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) hergestellt.
- Das behördliche Vorgehen bei Gefahr im Verzug: Dieser Abschnitt analysiert das behördliche Vorgehen bei Gefahr im Verzug, wenn die Maßnahmen zur Abwendung der unmittelbaren Gefahr eines Umweltschadens nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend getroffen werden. Der Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten der Behörden, die Kostenersatzpflicht des Betreibers und die Rolle des Bundes bei der Finanzierung von Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Umwelthaftungsrichtlinie, Bundesumwelthaftungsgesetz, Umweltschaden, Verursacherprinzip, Kostenersatzpflicht, Biodiversität, Gewässer, Boden, subsidiäre Haftung, Liegenschaftseigentümerhaftung, Gefahr im Verzug, behördliches Vorgehen.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt das Bundesumwelthaftungsgesetz (B-UHG) in Österreich?
Das B-UHG setzt die EU-Umwelthaftungsrichtlinie um und schafft einen Rahmen zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden an Biodiversität, Gewässern und Boden nach dem Verursacherprinzip.
Wer haftet für einen Umweltschaden?
In erster Linie haftet derjenige (Schädiger), der durch eine im Gesetz genannte gefährliche Tätigkeit den Schaden oder die unmittelbare Gefahr eines Schadens verursacht hat.
Was ist die subsidiäre Liegenschaftseigentümerhaftung?
Wenn der eigentliche Betreiber nicht herangezogen werden kann, kann unter bestimmten Bedingungen der Eigentümer der Liegenschaft, auf der die Gefahr besteht, zur Haftung verpflichtet werden.
Was passiert bei „Gefahr im Verzug“?
In diesem Fall können Behörden sofortige Maßnahmen zur Abwendung des Schadens treffen. Der Verursacher ist verpflichtet, die dabei anfallenden Kosten zu ersetzen.
Was versteht man unter Deckungsvorsorge?
Die Deckungsvorsorge umfasst Instrumente (wie Versicherungen oder Garantien), die sicherstellen, dass Mittel für potenzielle Sanierungsmaßnahmen im Falle eines Umweltschadens zur Verfügung stehen.
Welche Tätigkeiten fallen unter das Haftungsregime?
Dazu gehören unter anderem der Betrieb von Industrieanlagen, Einleitungen in Gewässer oder der Umgang mit gefährlichen Stoffen gemäß Anhang III der UH-RL.
- Citar trabajo
- Tanja E. Lackner (Autor), 2010, Kostenersatz für Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen einschließlich Deckungsvorsorge, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154735