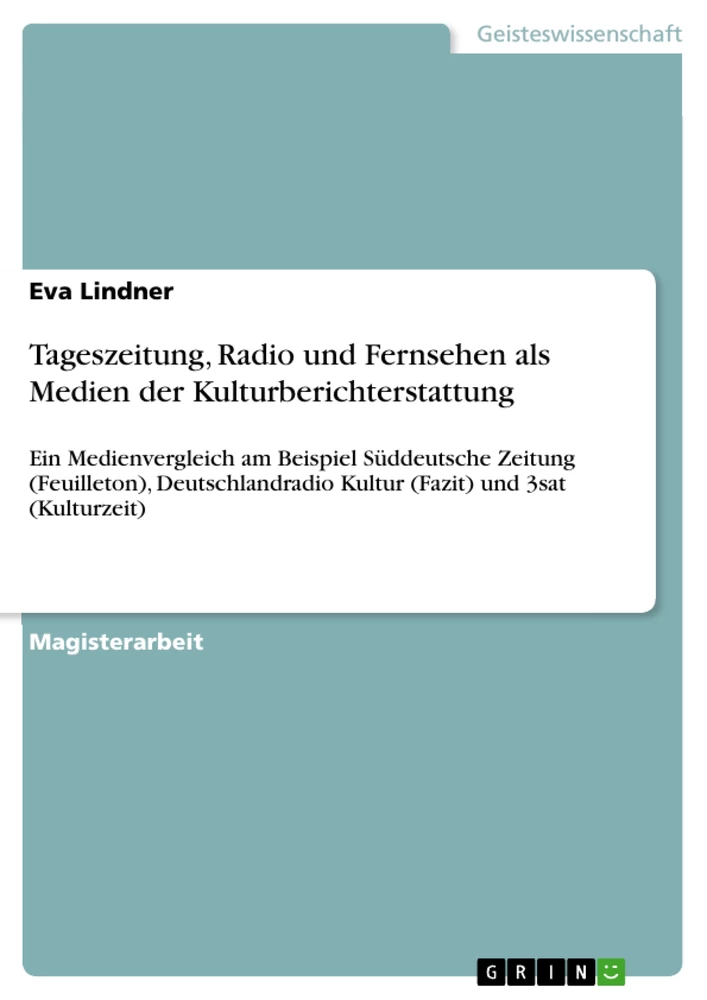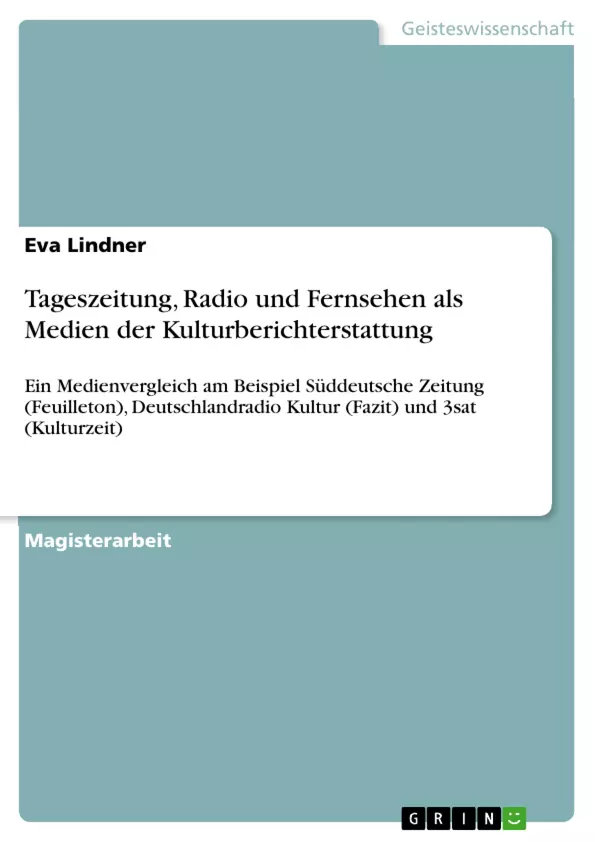Diese Arbeit will sich mit der These beschäftigen, dass sich die drei Massenmedien Fernsehen, Radio und Zeitung strukturell unterscheiden. Um dies zu untersuchen, werden am Beispiel Kulturberichterstattung drei Formate verglichen. Es wird analytisch erkundet, was die Kulturredaktionen als Kultur präsentieren, welche Darstellungsformen und Genres sie bevorzugen, welche Hierarchisierungen sie vornehmen und welcher Sprache sie sich bedienen. Ebenso soll herausgefunden werden, welche Rolle Nachrichtenfaktoren auf die Berichterstattung haben. Auch wird eine Einteilung in drei verschiedene Sinneswahrnehmungssysteme vorgenommen. Aus all diesen Punkten soll dann in Zwischenvergleichen auf mögliche Medienunterschiede geschlossen werden. Im abschließenden Vergleich wird erläutert, welche Auswirkungen die Mediendifferenzen auf das jeweilige Kulturverständnis haben. Dazu wird geklärt, welcher Gegenstandsbereich den Formaten unter dem Begriff Kultur zugrunde liegt und welches Selbstverständnis sie an den Tag legen. Sehen sich die Formate innerhalb ihrer Kulturbeobachtung als Chronisten, als Produzenten oder als Plattform für Kultur? Ist das Kulturverständnis damit medienabhängig oder nicht? Es gilt herauszufinden, ob die Formate sich in ihrem Kulturverständnis stark unterscheiden. Damit einhergehend soll beantwortet werden, ob ein Unterschied zwischen Hoch- und Populärkultur gemacht wird, ob also vor allem klassische Themen den Weg in die Kulturformate finden, oder ob mit einem, und dies könnte eine erste These sein, erweiterten Kulturverständnis gearbeitet wird. Wird Populärkultur, vorausgesetzt sie taucht in den Formaten auf, als solche betrachtet, oder werden alle Gegenstände einheitlich aus einer hochkulturellen Sichtweise angesehen? Auch gilt es zu überprüfen, ob eines der drei Medien als eine Art Leitmedium für die anderen fungiert und es hinsichtlich dessen intermediale Bezüge gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und Grundlagen
- Der Medienvergleich
- Der deutsche Kulturbegriff - eine definitorische Annäherung
- Geschichte des Feuilletons
- Vorgehensweise für die Analyse
- Publikationsform der Formate
- Erscheinungsweise
- Produktion: Sonderfall Kulturzeit
- Sinneswahrnehmungssysteme
- Selektion der Formate
- Nachrichtenfaktoren
- Kulturgenres
- Hierarchisierung
- Zwischenvergleich
- Präsentation der Formate
- Journalistische Darstellungsformen
- Meinungsbetonte Darstellungsformen
- Tatsachenbetonte Darstellungsformen
- Sprache
- Subjektivismus
- Verständlichkeit
- Zwischenvergleich
- Journalistische Darstellungsformen
- Abschließender Vergleich
- Rezension von Kultur
- Produktion von Kultur
- Plattform für Kultur
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die strukturellen Unterschiede zwischen Fernsehen, Radio und Zeitung anhand der Kulturberichterstattung. Ziel ist es, durch den Vergleich ausgewählter Formate herauszufinden, wie sich die Medien in ihrer Präsentation von Kultur, der Auswahl der Themen und der verwendeten Sprache unterscheiden. Es wird analysiert, welche Rolle Nachrichtenfaktoren spielen und wie die jeweiligen Sinneswahrnehmungssysteme die Berichterstattung beeinflussen.
- Vergleich der Kulturberichterstattung in Fernsehen, Radio und Zeitung
- Analyse der Unterschiede in der Themenauswahl und -hierarchisierung
- Untersuchung der verwendeten journalistischen Darstellungsformen und Sprache
- Einfluss der Sinneswahrnehmungssysteme auf die Berichterstattung
- Bedeutung der Nachrichtenfaktoren für die Selektion von Kulturthemen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die aktuelle Situation der Zeitung und des Feuilletons im Kontext des aufkommenden Internets. Sie begründet die Wahl der drei Medien (Fernsehen, Radio, Zeitung) für den Vergleich und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit. Die Arbeit zielt darauf ab, strukturelle Unterschiede zwischen den Medien aufzuzeigen und zu untersuchen, ob und wie sich diese Unterschiede auf das jeweilige Kulturverständnis auswirken. Die Auswahl der drei Medien basiert auf den unterschiedlichen Sinneswahrnehmungssystemen und der Ähnlichkeit der ausgewählten Formate in ihrer Erscheinungsweise.
Begriffsbestimmung und Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit fest. Es umfasst einen Vergleich der drei Medien, eine Annäherung an den deutschen Kulturbegriff, einen geschichtlichen Abriss des Feuilletons und die Beschreibung der Vorgehensweise bei der Analyse der ausgewählten Formate. Es schafft eine solide Basis für den Vergleich, indem es die relevanten Begriffe definiert und kontextualisiert.
Publikationsform der Formate: Dieses Kapitel analysiert die Erscheinungsweise, die Produktionsweise (am Beispiel der "Kulturzeit") und die Sinneswahrnehmungssysteme der drei ausgewählten Formate. Es beleuchtet die unterschiedlichen technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Kulturberichterstattung in den verschiedenen Medien und deren Einfluss auf die Form und den Inhalt.
Selektion der Formate: Hier werden die Kriterien der Themenauswahl untersucht. Es werden die Rolle von Nachrichtenfaktoren, die Auswahl von Kulturgenres, die Hierarchisierung von Themen und ein Zwischenvergleich der Selektionsmechanismen in den drei Medien beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Prozessen, die bestimmen, welche Kulturthemen überhaupt in die Berichterstattung aufgenommen werden.
Präsentation der Formate: Dieses Kapitel analysiert die journalistischen Darstellungsformen (meinungs- und tatsachenbetont), die Sprache (Subjektivismus und Verständlichkeit) und die Unterschiede in der Präsentation von Kulturthemen in den drei Medien. Es beleuchtet, wie die jeweilige mediale Form die Präsentation der Inhalte beeinflusst.
Schlüsselwörter
Kulturberichterstattung, Medienvergleich, Fernsehen, Radio, Zeitung, Feuilleton, Kulturbegriff, Journalistische Darstellungsformen, Sprache, Sinneswahrnehmungssysteme, Nachrichtenfaktoren, Medienunterschiede, Hochkultur, Populärkultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Vergleich der Kulturberichterstattung in Fernsehen, Radio und Zeitung
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die strukturellen Unterschiede zwischen der Kulturberichterstattung im Fernsehen, Radio und in der Zeitung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich ausgewählter Formate, um herauszufinden, wie sich die Medien in ihrer Präsentation von Kultur, der Themenauswahl und der verwendeten Sprache unterscheiden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede in der Präsentation von Kultur, der Auswahl der Themen und der verwendeten Sprache in den drei Medien aufzuzeigen und zu analysieren. Es werden die Rolle der Nachrichtenfaktoren und der Einfluss der Sinneswahrnehmungssysteme auf die Berichterstattung untersucht.
Welche Medien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Kulturberichterstattung im Fernsehen, Radio und in der Zeitung. Die Auswahl basiert auf den unterschiedlichen Sinneswahrnehmungssystemen und der Ähnlichkeit der ausgewählten Formate in ihrer Erscheinungsweise.
Welche Aspekte der Kulturberichterstattung werden analysiert?
Analysiert werden die Themenauswahl und -hierarchisierung, die verwendeten journalistischen Darstellungsformen (meinungs- und tatsachenbetont), die Sprache (Subjektivismus und Verständlichkeit), der Einfluss der Sinneswahrnehmungssysteme und die Rolle der Nachrichtenfaktoren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsbestimmung und Grundlagen, ein Kapitel zur Publikationsform der Formate, ein Kapitel zur Selektion der Formate, ein Kapitel zur Präsentation der Formate, einen abschließenden Vergleich und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Zusätzlich werden die Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einem Medienvergleich, einer Annäherung an den deutschen Kulturbegriff und einem geschichtlichen Abriss des Feuilletons. Die Methodik der Analyse der ausgewählten Formate wird ebenfalls detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielen Nachrichtenfaktoren?
Die Arbeit untersucht, welche Rolle Nachrichtenfaktoren bei der Selektion von Kulturthemen in den verschiedenen Medien spielen und wie diese die Auswahl und Hierarchisierung von Themen beeinflussen.
Wie beeinflussen die Sinneswahrnehmungssysteme die Berichterstattung?
Die Arbeit analysiert, wie die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungssysteme (visuell, auditiv) der Medien die Form und den Inhalt der Kulturberichterstattung beeinflussen.
Welche journalistischen Darstellungsformen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert sowohl meinungsbetonte als auch tatsachenbetonte journalistische Darstellungsformen und deren Verwendung in der Kulturberichterstattung der drei Medien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kulturberichterstattung, Medienvergleich, Fernsehen, Radio, Zeitung, Feuilleton, Kulturbegriff, journalistische Darstellungsformen, Sprache, Sinneswahrnehmungssysteme, Nachrichtenfaktoren, Medienunterschiede, Hochkultur, Populärkultur.
- Quote paper
- Eva Lindner (Author), 2009, Tageszeitung, Radio und Fernsehen als Medien der Kulturberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154754