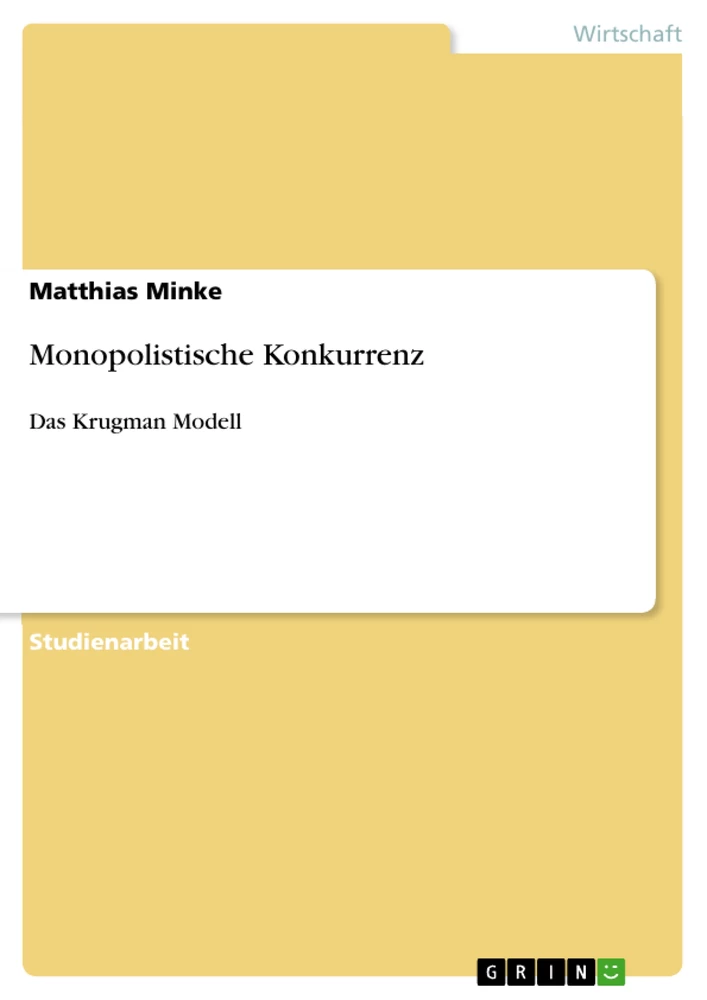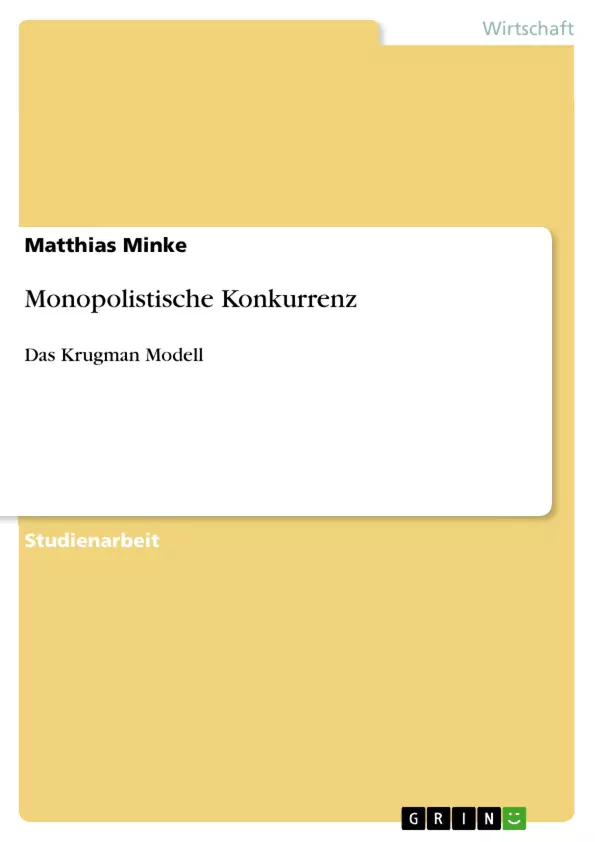Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema Monopolistische Konkurrenz in der Außenwirtschaftstheorie. Dieser Ansatz geht im Wesentlichen auf die Arbeiten von Paul Krugman (1979, 1980, 1981) zurück, welche auch die Grundlage für diesen Text bilden. Zentrale Elemente dieses oft als new trade theory bezeichneten Erklärungsansatzes sind steigende interne Skalenerträge, die Vorliebe der Konsumenten für Produktvielfalt und Produktdifferenzierung. In dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie sich in einer Volkswirtschaft mit den genannten Eigenschaften die endogenen Variablen Preis, Anzahl der Güterarten und Mengen der produzierten Güter ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Stilisierte Fakten und Motivation
- Das Grundmodell nach Krugman
- Annahmen
- Das Autarkiegleichgewicht
- Aufnahme von Handel
- Wohlfahrtswirkungen des Handels
- Das Grundmodell erweitert um Transportkosten
- Einfluss auf das Nachfrageverhalten
- Zahlungsbilanz und Relativlohn
- Der home market effect
- Einkommensverteilung und Handel
- Modellrahmen
- Faktorverhältnis und Handelsstruktur
- Verteilungseffekte des Handels
- Neue ökonomische Geographie
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema monopolistische Konkurrenz in der Außenwirtschaftstheorie und analysiert die Auswirkungen steigender interner Skalenerträge, Produktvielfalt und Produktdifferenzierung auf die endogenen Variablen Preis, Anzahl der Güterarten und produzierte Mengen in einer Volkswirtschaft. Im Vordergrund steht die Untersuchung der Folgen von Handel zwischen zwei Volkswirtschaften mit diesen Eigenschaften, wobei insbesondere die Wohlfahrtssteigernden Effekte des Handels trotz Abwesenheit traditioneller Motive wie komparativer Vorteile oder unterschiedlicher Faktorausstattungen im Fokus stehen. Die Arbeit erweitert das Grundmodell durch die Einbeziehung von Transportkosten und untersucht deren Auswirkungen auf das Nachfrageverhalten, die Zahlungsbilanz und den Relativlohn sowie den home market effect. Darüber hinaus werden die Verteilungswirkungen von Handel diskutiert und ein Ausblick auf die neue ökonomische Geographie gegeben.
- Monopolistische Konkurrenz in der Außenwirtschaftstheorie
- Steigende interne Skalenerträge, Produktvielfalt und Produktdifferenzierung
- Wohlfahrtswirkungen von Handel
- Transportkosten und deren Auswirkungen
- Verteilungseffekte von Handel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Diese Einleitung führt in das Thema monopolistische Konkurrenz in der Außenwirtschaftstheorie ein und stellt die Kernelemente des Ansatzes sowie die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Sie erläutert die Bedeutung steigender interner Skalenerträge, der Vorliebe der Konsumenten für Produktvielfalt und Produktdifferenzierung sowie die Auswirkungen von Handel auf die endogenen Variablen Preis, Anzahl der Güterarten und Mengen der produzierten Güter.
- Stilisierte Fakten und Motivation: Dieses Kapitel präsentiert stilisierte Fakten, die die Notwendigkeit für Modelle auf der Grundlage von monopolistischer Konkurrenz belegen, insbesondere im Hinblick auf das Phänomen des intraindustriellen Handels. Es zeigt die Schwächen traditioneller Außenhandelstheorien bei der Erklärung dieses Phänomens und erläutert die Bedeutung des Grubel-Lloyd-Index als Maß für intraindustriellen Handel.
- Das Grundmodell nach Krugman: Dieses Kapitel stellt das Grundmodell von Krugman (1980) vor, welches die Grundlage für die weitere Analyse bildet. Es definiert die Annahmen des Modells und analysiert das Autarkiegleichgewicht sowie die Auswirkungen von Handel auf die Wohlfahrt.
- Das Grundmodell erweitert um Transportkosten: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Transportkosten auf das Grundmodell. Es analysiert den Einfluss von Transportkosten auf das Nachfrageverhalten, die Zahlungsbilanz und den Relativlohn sowie den home market effect.
- Einkommensverteilung und Handel: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verteilungswirkung von Handel. Es stellt einen Modellrahmen vor, analysiert das Verhältnis von Faktorverhältnis und Handelsstruktur und untersucht die Verteilungseffekte des Handels.
Schlüsselwörter
Monopolistische Konkurrenz, Außenwirtschaftstheorie, Skalenerträge, Produktvielfalt, Produktdifferenzierung, Handel, Wohlfahrt, Transportkosten, home market effect, Einkommensverteilung, neue ökonomische Geographie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist monopolistische Konkurrenz?
Dies ist eine Marktform, bei der viele Anbieter ähnliche, aber nicht identische Produkte (Produktdifferenzierung) anbieten und über einen gewissen Spielraum bei der Preisgestaltung verfügen.
Wie hängen Skalenerträge und monopolistische Konkurrenz zusammen?
Steigende interne Skalenerträge führen dazu, dass größere Unternehmen kostengünstiger produzieren können, was den Anreiz für Spezialisierung und internationalen Handel erhöht.
Was ist der „Home Market Effect“?
Der Home Market Effect besagt, dass Länder mit einer großen Inlandsnachfrage nach einem bestimmten Gut tendenziell zu Nettoexporteuren dieses Gutes werden.
Was erklärt Krugmans Modell zum intraindustriellen Handel?
Es erklärt, warum Länder ähnliche Güter untereinander tauschen (z.B. Autos gegen Autos), da Konsumenten Vielfalt schätzen und Unternehmen durch Skaleneffekte profitieren.
Welchen Einfluss haben Transportkosten auf den Handel?
Transportkosten wirken als Handelshemmnis und beeinflussen das Nachfrageverhalten sowie die Standortwahl von Unternehmen im Rahmen der neuen ökonomischen Geographie.
- Quote paper
- Matthias Minke (Author), 2009, Monopolistische Konkurrenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154794