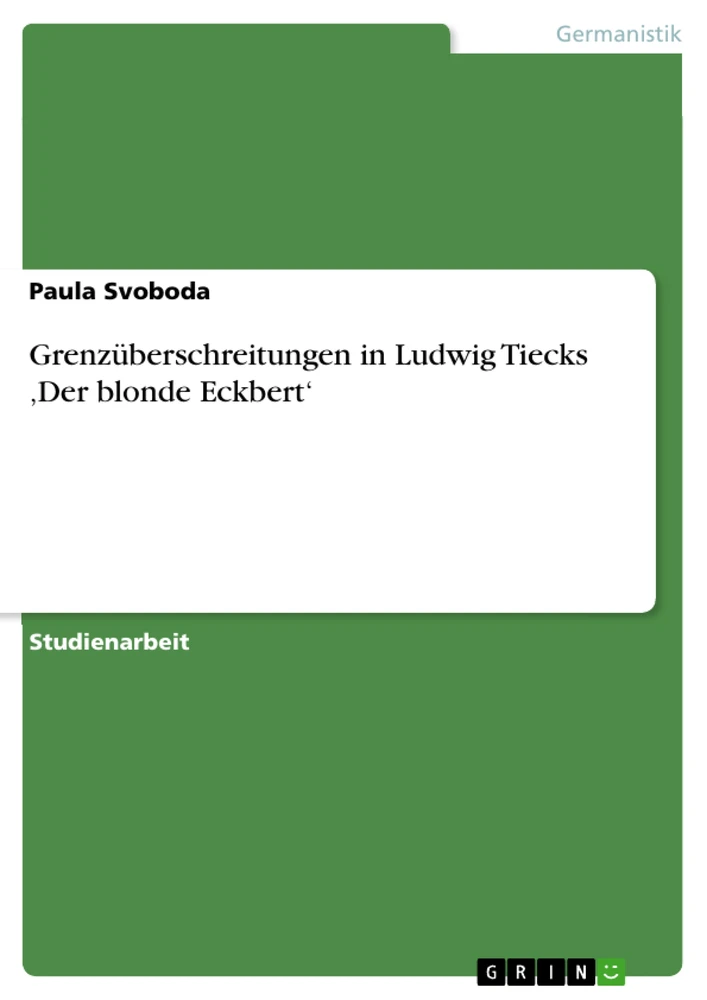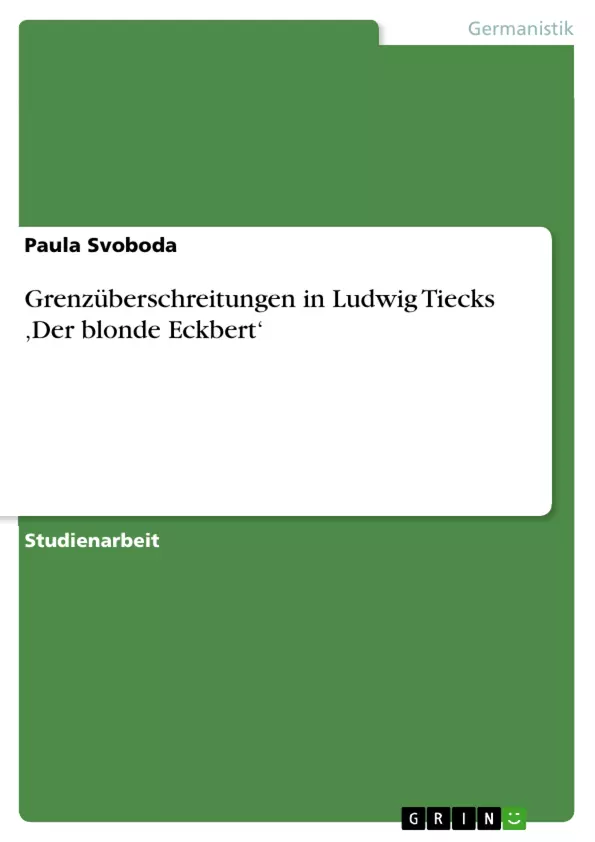Im Gegensatz zum Novalisschen „die ganze Welt muss poetisiert werden“, richtet Tieck sein Augenmerk auf „die Grenzübergänge des Wirklichen und die Aufhe-bung der Maßstäbe des Bewußtseins“ . Durch diese Übergänge soll das Wunder-bare das Wirkliche aufschließen und deuten können.
Durch meine Analyse möchte ich versuchen, die Grenzüberschreitungen aufzude-cken. Zunächst wird die Sprengung des Rahmens des Volksmärchens durch Tieck thematisiert. Ich werde zeigen, inwiefern Tieck das klassische Märchen verwen-det, um es auf eine neue, reflektierte Art und Weise zu gestalten. Daraufhin setze ich mich mit der Erzählinstanz auseinander, denn auch hier überschreitet Tieck die Grenze des Üblichen. Dies setzt sich in der Diegese fort, weswegen hier meine Untersuchungen anknüpfen. Das Problem der Räume beschreibe ich im Abschnitt IV, denn die Grenzüberschreitungen im „Blonden Eckbert“ werden unter dieser Perspektive besonders deutlich. Zum Schluss beschäftige ich mich mit der Zeit-lichkeit, um auch hier die Sprengung des üblichen Rahmens nachzuvollziehen.
Zunächst seien jedoch einige Worte zu der Literarizität des „Blonden Eckberts“ gesagt, da vor jeder literaturwissenschaftlichen Analyse eine Bestimmung erfolgen muss, ob es sich bei dem zu analysierenden Text überhaupt um einen literarischen handelt. Das erste Kriterium, die Fixierung, ist eindeutig vorhanden und bedarf keinerlei Ausführungen. Die zweite Bedingung der Existenz eines literarischen Textes ist die der Fiktionalität. Diese besagt, dass ein Werk von einer eigenen Welt ausgeht, eine eigene Fiktion verschafft und deshalb nicht an den Kriterien des Alltags gemessen werden kann. Ein gutes Beispiel bildet in unserem Falle der Beginn des Textes, der sich konventionell an dem Muster des Märchens hält: „In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden Eckbert nannte.“, (S. 3). Das wichtigste Merkmal bildet das der Poetizität, des außergewöhnlichen Sprachgebrauchs. Dies sieht man am deutlichsten an dem Lied des Vogels, das den Rahmen des Gewöhnlichen sichtbar sprengt. Des Weiteren hebt sich der Text vom Alltäglichen ab, indem es „das Wort nicht wie im alltäglichen Sprechen und Schreiben wahllos und in geschwätziger Füller ge-braucht wird, sondern dass alles Unnötige und Materielle (…) vermieden wird, dass das Wort in seiner ursprünglichen Reinheit (…) zur Geltung kommt“ . „Der blonde Eckbert“ ist folglich ein literarischer Text, dessen Untersuchung nun an-steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mehr als ein Märchen
- Erzählinstanz
- Diegese
- Raum
- Zeit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Ludwig Tiecks "Der blonde Eckbert" mit dem Fokus auf die Grenzüberschreitungen im Text. Sie untersucht, wie Tieck den Rahmen des klassischen Märchens sprengt und eine neue, reflektierte Art des Erzählens präsentiert. Die Arbeit beleuchtet die Erzählinstanz, die Diegese, die Raumgestaltung und die Zeitlichkeit des Textes, um die spezifischen Strategien Tiecks zur Darstellung des Wunderbaren und des Wirklichen aufzudecken.
- Die Sprengung des Rahmens des Volksmärchens durch Tieck
- Die Rolle der Erzählinstanz als Grenzgänger zwischen Realem und Fiktivem
- Die Verbindung von Wirklichem und Wunderbarem in der Diegese
- Die Raumgestaltung als Mittel zur Hervorhebung von Grenzüberschreitungen
- Die Zeitlichkeit als Faktor der Auflösung klassischer Erzählstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert den Ansatz der Hausarbeit und erläutert die Bedeutung von Tiecks Werk im Kontext der Romantik. Sie stellt die zentrale Fragestellung nach den Grenzüberschreitungen in "Der blonde Eckbert" vor und gibt einen Überblick über die einzelnen Analysekapitel.
- Mehr als ein Märchen: Dieses Kapitel untersucht, inwiefern "Der blonde Eckbert" von den Konventionen des klassischen Volksmärchens abweicht. Es beleuchtet die zentralen Merkmale des Volksmärchens und zeigt, wie Tieck diese Elemente auf eine neue Weise verwendet und erweitert.
- Erzählinstanz: Dieses Kapitel analysiert die Erzählinstanz in "Der blonde Eckbert" und deren Einfluss auf die Gestaltung des Textes. Es untersucht, wie die Erzählperspektive die Wahrnehmung der Geschichte prägt und zur Konstruktion von Ambivalenz und Mehrdeutigkeit beiträgt.
- Diegese: Dieses Kapitel befasst sich mit der Diegese des Textes und der Verbindung von Wirklichem und Wunderbarem in der Erzählwelt. Es untersucht, wie Tieck die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt und die Leserschaft zur Interpretation des Textes anregt.
- Raum: Dieses Kapitel fokussiert auf die Raumgestaltung in "Der blonde Eckbert" und die Rolle des Raumes bei der Darstellung von Grenzüberschreitungen. Es untersucht, wie die räumlichen Verhältnisse zur Konstruktion von Spannung, Geheimnis und Unheimlichkeit beitragen.
- Zeit: Dieses Kapitel analysiert die Zeitlichkeit in "Der blonde Eckbert" und die Auflösung traditioneller Erzählstrukturen durch die Zeitgestaltung. Es untersucht, wie die Zeit in der Geschichte subjektiv erfahren und die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwimmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Romantik, insbesondere dem Spannungsverhältnis zwischen Wirklichkeit und Imagination, dem Einfluss der Erzählinstanz auf die Konstruktion von Bedeutung und der Auflösung klassischer Erzählformen durch die Darstellung von Grenzüberschreitungen. Weitere wichtige Begriffe sind das Volksmärchen, die Diegese, der Raum und die Zeitlichkeit.
- Arbeit zitieren
- Paula Svoboda (Autor:in), 2010, Grenzüberschreitungen in Ludwig Tiecks ‚Der blonde Eckbert‘, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154821