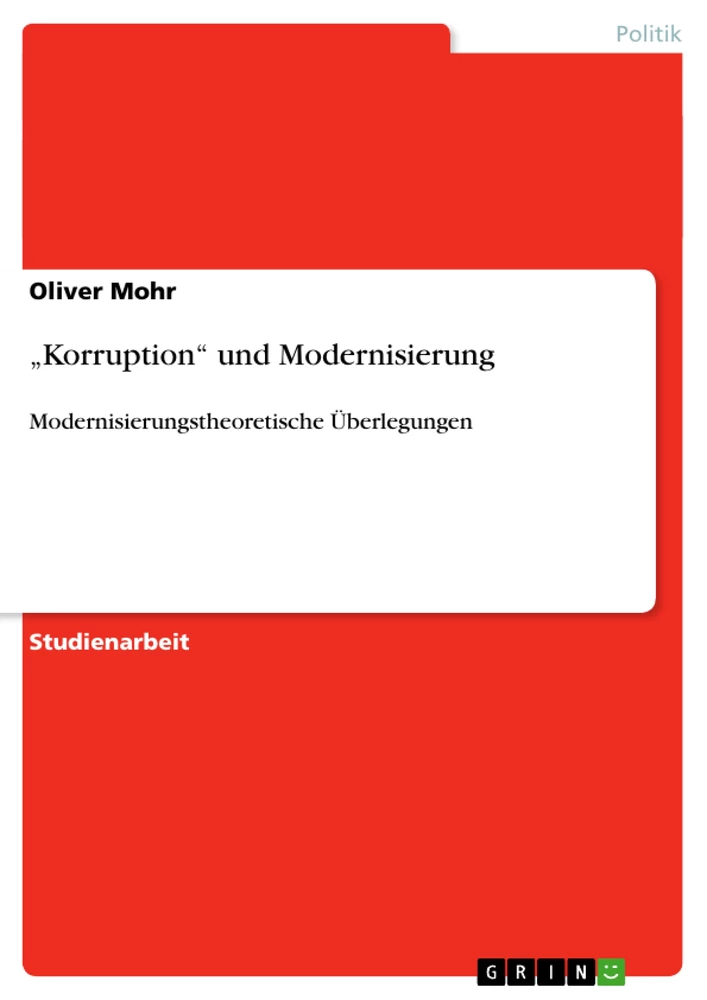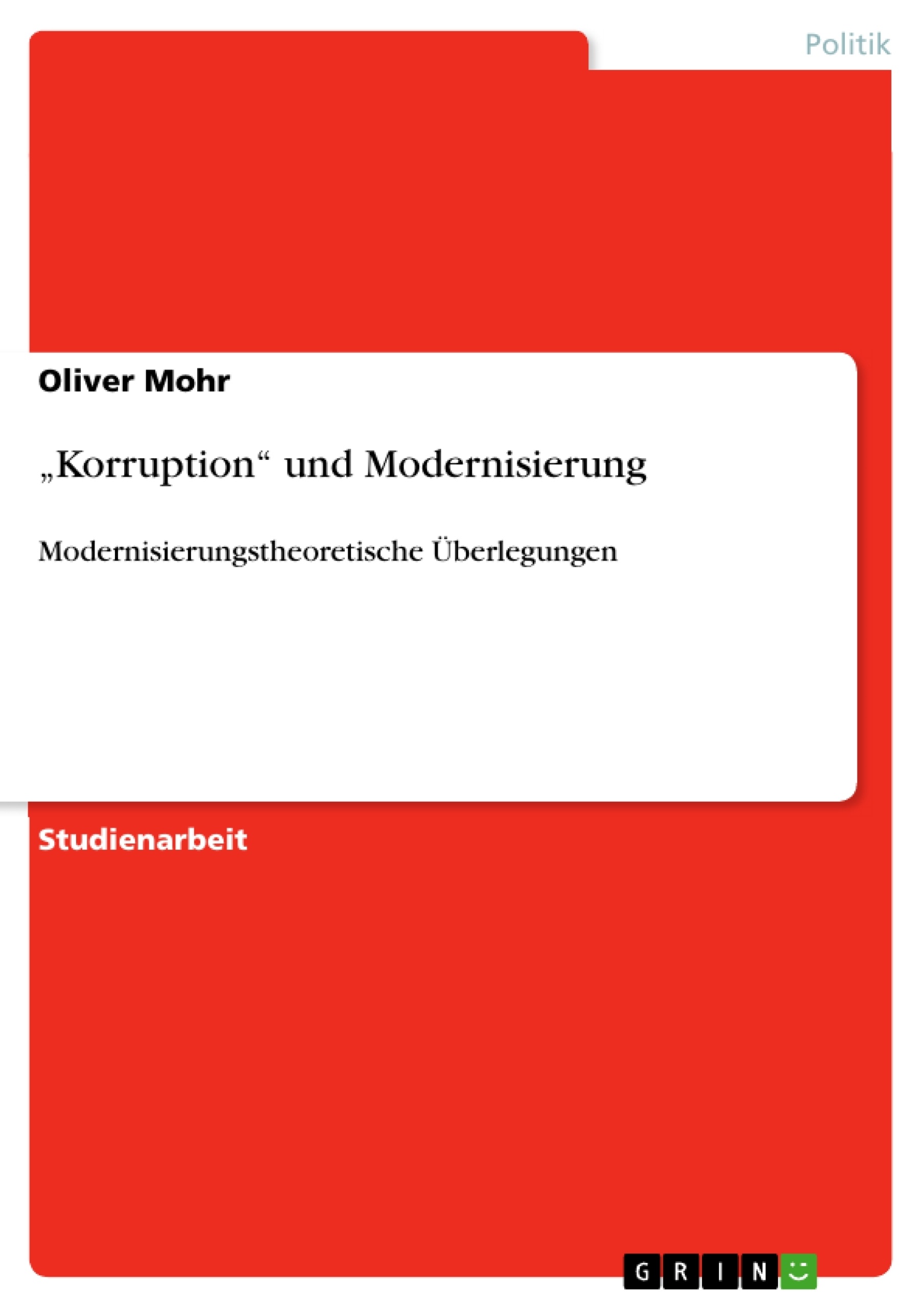Raymond Fisman und Edward Miguel haben untersucht, ob kulturelle Unterschiede eine Auswirkung auf Korruption besitzen. Hierzu haben sie die Verteilungshäufigkeit von Parkverstößen ausgewertet, die von internationalen Diplomaten unter der Bedingung der diplomatischen
Immunität begangen wurden. Sie fanden heraus, dass Diplomaten, die aus Ländern mit hohen Korruptionsraten stammten, eine signifikant höhere Delinquenz aufwiesen als Repräsentanten als weniger korrupt wahrgenommener Länder. Als Regionen halten Afrika und der Nahe Osten den Negativrekord.
Es stellt sich die Frage, wie diese Unterschiede zu erklären sind. Die Autoren selbst sehen in ihrer Studie bestätigt, dass kulturelle Differenzen eine entscheidende Rolle spielen. Solche Differenzen
werden häufig modernisierungstheoretisch erklärt. Die ursprüngliche Idee des Verfassers war, in der Struktur traditionaler und primordialer Gesellschaften eine Erklärung für diese Differenzen zu
suchen. Bald war jedoch festzustellen, dass dieses Unterfangen zu Tautologien führte. Der Diskurs der Korruption ist in ein „klassisches“ Modernisierungsparadigma eingebunden, das schon
voraussetzt, was es eigentlich erklären möchte.
In dieser Arbeit soll nun gezeigt werden, dass Erklärungsansätze problematisch sind, die Korruption als Symptom eines Modernisierungsdefizites verstehen. Die Verknüpfung von „klassischer“ Modernisierung und Korruption offenbart eine entscheidende Schwäche des Korruptionsbegriffs, die mit zeitgemäßen Theorien der Moderne schwer vereinbar ist. Dieses Defizit soll im folgenden historisch aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Korruption und Modernisierung
- 1. Entwicklung und Korruption
- 2. Modernisierung und Korruption
- III. Korruption und Modernisierung – ein historischer Abriss
- 1. Antike
- 2. Mittelalter
- 3. Frühe Neuzeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die enge Verknüpfung von westlicher Modernisierung und Korruptionsdiskursen. Ziel ist es, die Problematik dieser Diskurse als universelles Schema aufzuzeigen und somit ihre Anwendung auf nichtwestliche Gesellschaften kritisch zu hinterfragen.
- Die Verbindung von „klassischer“ Modernisierung und Korruption
- Die historische Entwicklung des Korruptionskonzeptes im euro-atlantischen Raum
- Die Problematik der Übertragung westlicher Werte auf nichtwestliche Gesellschaften
- Die Rolle von kulturellen Unterschieden im Kontext von Korruption
- Der normative Charakter des Korruptionsbegriffs in modernen Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Der Text untersucht die Korrelation zwischen kulturellen Unterschieden und Korruption anhand der Studie von Fisman und Miguel, die eine signifikant höhere Delinquenz bei Diplomaten aus korrupten Ländern festgestellt haben. Die Arbeit beleuchtet die Problematik von Modernisierungstheorien, die Korruption als Symptom eines Modernisierungsdefizits erklären. Die enge Verknüpfung von Korruptionsdiskursen mit westlicher Modernisierung wird im folgenden analysiert.
II. Korruption und Modernisierung
1. Entwicklung und Korruption
Der Text stellt empirische Daten von Berg-Schlosser vor, die einen Zusammenhang zwischen niedrigem Entwicklungsstand und hohen Korruptionsraten aufzeigen. Die Legitimitätsprobleme von korrupten Staaten werden als mögliche Ursache diskutiert.
2. Modernisierung und Korruption
Die Arbeit beleuchtet Huntingtons These, dass Modernisierungsprozesse zu höheren Korruptionsraten führen. Faktoren wie der Wandel gesellschaftlicher Werte, die Schaffung neuer Wohlstands- und Machtquellen sowie die Erweiterung der Regierungstätigkeit begünstigen laut Huntington Korruption. Der Text analysiert außerdem Huntingtons Vergleich von Ghana und Südkorea, um die Bedeutung kultureller Unterschiede zu betonen.
III. Korruption und Modernisierung – ein historischer Abriss
1. Antike
Der Text beleuchtet Beispiele normüberschreitender Delikte im antiken Griechenland und Rom, die als Korruption betrachtet werden können. Die antiken Gesetzgeber versuchten zwar, Korruption zu verhindern, doch konnten diese Normen nicht vollständig durchgesetzt werden. Es bestand keine strikte Trennung von privaten Ansprüchen und öffentlichen Belangen.
2. Mittelalter
Die Arbeit analysiert den mittelalterlichen Begriff „corruptio“ und die Unterschiede zum modernen Korruptionsverständnis. Der Text beleuchtet die Problematik der Einkünfte städtischer Amtsleute im ausgehenden Mittelalter und die fehlende Trennung von öffentlicher und privater Sphäre.
3. Frühe Neuzeit
Der Text beschreibt die Entwicklung des Korruptionsbegriffs in der frühen Neuzeit und die Akzeptanz von Praktiken wie Patronage und Ämterkäuflichkeit. Die Arbeit beleuchtet die Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung und das Verhältnis von Amtsträgern und Fürsten.
Häufig gestellte Fragen
Hängt Korruption mit kulturellen Unterschieden zusammen?
Die Studie von Fisman und Miguel zeigt, dass Diplomaten aus Ländern mit hoher Korruptionsrate auch unter Immunität häufiger Regeln (z.B. Parkverbote) missachten, was auf kulturelle Prägungen hindeutet.
Was besagt die modernisierungstheoretische Erklärung von Korruption?
Sie sieht Korruption oft als Symptom eines Modernisierungsdefizits an, bei dem traditionelle Strukturen noch nicht vollständig durch moderne, rechtsstaatliche Normen ersetzt wurden.
Warum ist der Korruptionsbegriff laut der Arbeit problematisch?
Die Arbeit kritisiert, dass der Begriff oft westliche Standards als universell voraussetzt und nicht-westliche Gesellschaften pauschal als "defizitär" einstuft.
Wie wurde Korruption in der Antike und im Mittelalter wahrgenommen?
In diesen Epochen gab es oft keine strikte Trennung zwischen privaten Interessen und öffentlichen Ämtern, weshalb heutige Korruptionsmaßstäbe nur schwer anwendbar sind.
Welchen Einfluss hat Modernisierung auf die Korruptionsrate?
Nach Huntington können Modernisierungsprozesse Korruption sogar fördern, da neue Machtquellen entstehen und sich gesellschaftliche Werte schneller wandeln als Institutionen.
- Arbeit zitieren
- Oliver Mohr (Autor:in), 2010, „Korruption“ und Modernisierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154845