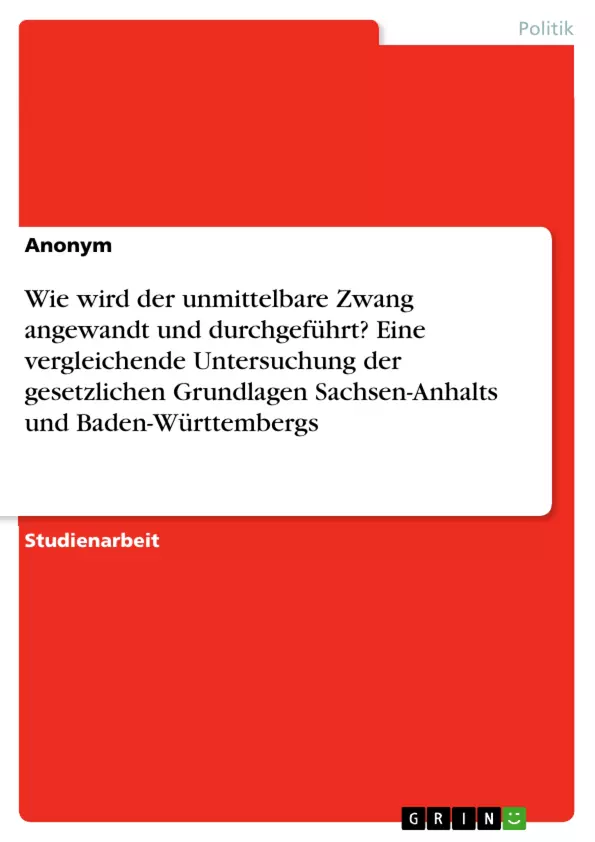Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Wie wird der unmittelbare Zwang angewandt und durchgeführt? Untersucht werden dabei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der gesetzlichen Grundlagen der Bundesländer Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Anwendung des unmittelbaren Zwangs.
Das Polizei - und Ordnungsrecht als Eingriffsrecht ist Ländersache. Die Polizei, als Behörde des Staates (Exekutive), hat allein die Befugnis, physischen Zwang zur Durchsetzung des Rechtes gegenüber Herrschafts-unterworfenen auszuüben. Sie übt nach Art. 20 Abs. 2 GG die Staatsgewalt in Form der Polizeigewalt aus. Hierbei geht es darum, "die Unverbrüchlichkeit des Rechts sicherzustellen". Einerseits sollen die Rechte und Rechtsgüter geschützt, andererseits die Gleichheit aller vor dem Gesetz gewahrt werden.
Das Recht der Polizei, den unmittelbaren Zwang auszuüben, ergibt sich aus den Verwaltungsvollstreckungs - und Polizeigesetzen der einzelnen Länder sowie aus dem Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes (UZwG). Darin werden der Befugnisumfang und dessen Einschränkungen geregelt. Präzise gesagt regeln diese Gesetze die Art und Weise der Zwangsanwendung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hinführung zu themenrelevanten Begriffen und Rechtsgrundlagen
- 2.1 Rechtsgrundlagen
- 2.2 Zwangsmittel
- 2.3 Unmittelbarer Zwang
- 2.4 Abgrenzung zur Ersatzvornahme
- 2.5 Anwendung unmittelbaren Zwangs
- 2.6 Vorbehalt des Gesetzes
- 2.7 Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
- 3. Rechtsvergleich
- 3.1 Hypothese und Untersuchungsgang
- 3.2 Die Verfahrensarten des unmittelbaren Zwangs
- 3.2.1 Gestrecktes Verfahren
- 3.2.2 Sofortiger Vollzug
- 3.2.3 Sachsen-Anhalt
- 3.2.4 Baden-Württemberg
- 3.3 Abgrenzung der Ersatzvornahme
- 3.3.1 Abgrenzung der Ersatzvornahme zum unmittelbarer Zwang gegen Sachen
- 3.3.2 Abgrenzung der Ersatzvornahme zur unmittelbaren Ausführung einer Maßnahme
- 3.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Bundesländer
- 4. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung und Durchführung unmittelbaren Zwangs im Polizeirecht von Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Ziel ist ein Vergleich der gesetzlichen Grundlagen beider Bundesländer und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
- Rechtsgrundlagen des unmittelbaren Zwangs in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg
- Verfahrensarten des unmittelbaren Zwangs (gestrecktes Verfahren, sofortiger Vollzug)
- Abgrenzung des unmittelbaren Zwangs von der Ersatzvornahme
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Anwendung des unmittelbaren Zwangs
- Vergleich des Einheitssystems (Baden-Württemberg) und des Trennungssystems (Sachsen-Anhalt)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des unmittelbaren Zwangs im Polizeirecht ein und stellt die Forschungsfrage nach der Anwendung und Durchführung des unmittelbaren Zwangs in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Sie hebt die Unterschiede im Organisationssystem der Polizei (Trennungssystem in Sachsen-Anhalt, Einheitssystem in Baden-Württemberg) hervor und betont die Doppelfunktion der Polizei (repressiv und präventiv). Die Einleitung verweist auf die relevanten Rechtsgrundlagen (Verwaltungsvollstreckungsgesetze und Polizeigesetze) und betont die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Bundesländer und der Beantwortung der Forschungsfrage.
2. Hinführung zu themenrelevanten Begriffen und Rechtsgrundlagen: Dieses Kapitel klärt wichtige Begriffe und Rechtsgrundlagen. Es erläutert die Verwaltungsvollstreckungsgesetze (VwVG Bund, SOG LSA, LVWVG BW) und deren Anwendung. Die verschiedenen Zwangsmittel werden definiert, insbesondere der unmittelbare Zwang, und von der Ersatzvornahme abgegrenzt. Das Kapitel legt die gesetzlichen Grundlagen für die Anwendung des unmittelbaren Zwangs dar und betont die Bedeutung des Gesetzesvorbehalts und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für dessen rechtmäßige Anwendung.
3. Rechtsvergleich: Das Kapitel vergleicht die Rechtsgrundlagen und Verfahrensweisen des unmittelbaren Zwangs in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Es untersucht sowohl das gestreckte Verfahren als auch den sofortigen Vollzug. Die Abgrenzung zur Ersatzvornahme wird detailliert behandelt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen und deren praktischer Anwendung in beiden Bundesländern werden analysiert, um ein umfassendes Bild der rechtlichen Rahmenbedingungen zu erstellen und Unterschiede im Anwendungskontext zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Unmittelbarer Zwang, Polizeirecht, Verwaltungsvollstreckung, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rechtsvergleich, Einheitssystem, Trennungssystem, Verhältnismäßigkeit, Gesetzesvorbehalt, Ersatzvornahme, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit zum unmittelbaren Zwang?
Diese Arbeit untersucht die Anwendung und Durchführung unmittelbaren Zwangs im Polizeirecht von Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Ziel ist ein Vergleich der gesetzlichen Grundlagen beider Bundesländer und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Welche Themenschwerpunkte werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rechtsgrundlagen des unmittelbaren Zwangs in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg, die Verfahrensarten des unmittelbaren Zwangs (gestrecktes Verfahren, sofortiger Vollzug), die Abgrenzung des unmittelbaren Zwangs von der Ersatzvornahme, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Anwendung des unmittelbaren Zwangs sowie den Vergleich des Einheitssystems (Baden-Württemberg) und des Trennungssystems (Sachsen-Anhalt).
Was beinhaltet die Einleitung dieser Arbeit?
Die Einleitung führt in die Thematik des unmittelbaren Zwangs im Polizeirecht ein und stellt die Forschungsfrage nach der Anwendung und Durchführung des unmittelbaren Zwangs in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Sie hebt die Unterschiede im Organisationssystem der Polizei (Trennungssystem in Sachsen-Anhalt, Einheitssystem in Baden-Württemberg) hervor und betont die Doppelfunktion der Polizei (repressiv und präventiv). Die Einleitung verweist auf die relevanten Rechtsgrundlagen (Verwaltungsvollstreckungsgesetze und Polizeigesetze) und betont die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Bundesländer und der Beantwortung der Forschungsfrage.
Welche Begriffe und Rechtsgrundlagen werden in Kapitel 2 erläutert?
Kapitel 2 klärt wichtige Begriffe und Rechtsgrundlagen, wie die Verwaltungsvollstreckungsgesetze (VwVG Bund, SOG LSA, LVWVG BW) und deren Anwendung. Die verschiedenen Zwangsmittel werden definiert, insbesondere der unmittelbare Zwang, und von der Ersatzvornahme abgegrenzt. Das Kapitel legt die gesetzlichen Grundlagen für die Anwendung des unmittelbaren Zwangs dar und betont die Bedeutung des Gesetzesvorbehalts und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für dessen rechtmäßige Anwendung.
Was ist der Inhalt des Kapitels zum Rechtsvergleich?
Das Kapitel vergleicht die Rechtsgrundlagen und Verfahrensweisen des unmittelbaren Zwangs in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Es untersucht sowohl das gestreckte Verfahren als auch den sofortigen Vollzug. Die Abgrenzung zur Ersatzvornahme wird detailliert behandelt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen und deren praktischer Anwendung in beiden Bundesländern werden analysiert, um ein umfassendes Bild der rechtlichen Rahmenbedingungen zu erstellen und Unterschiede im Anwendungskontext zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Unmittelbarer Zwang, Polizeirecht, Verwaltungsvollstreckung, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rechtsvergleich, Einheitssystem, Trennungssystem, Verhältnismäßigkeit, Gesetzesvorbehalt, Ersatzvornahme, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Wie wird der unmittelbare Zwang angewandt und durchgeführt? Eine vergleichende Untersuchung der gesetzlichen Grundlagen Sachsen-Anhalts und Baden-Württembergs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1548515