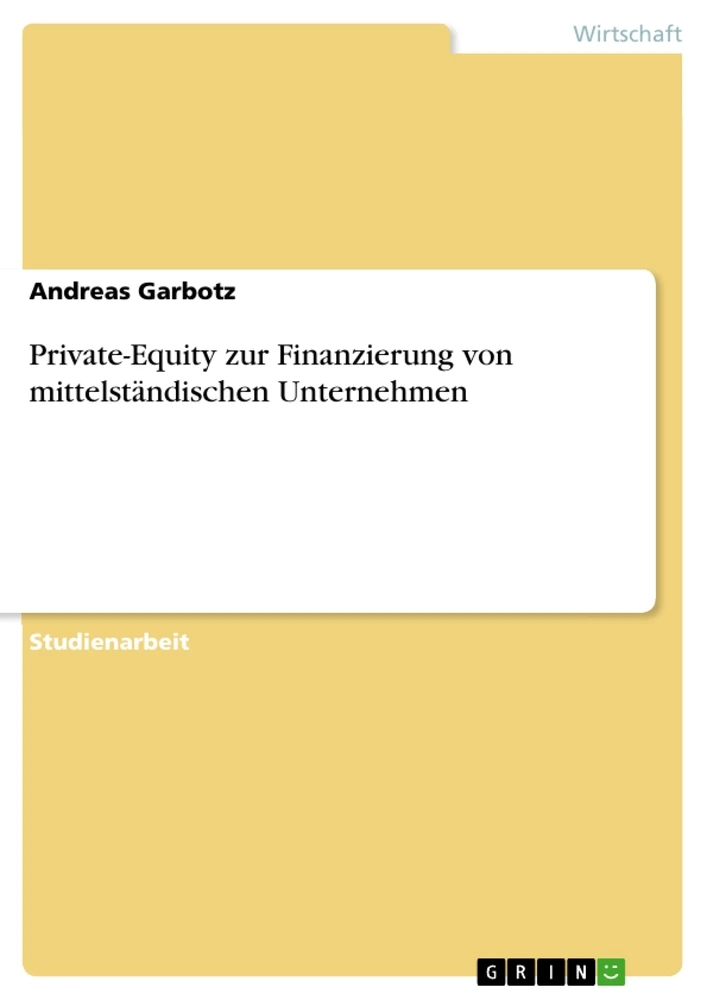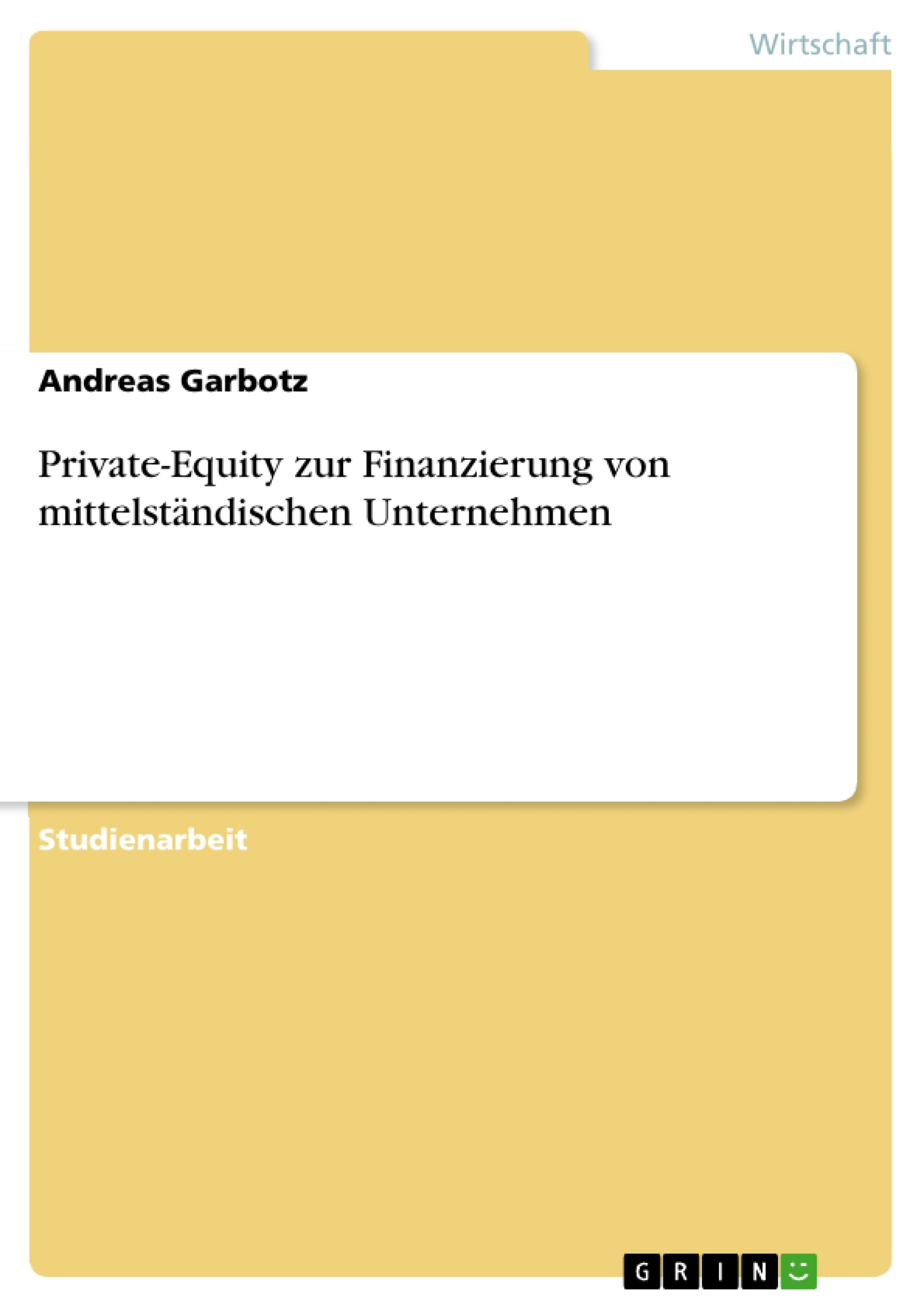„Der deutsche Mittelstand braucht eine stärkere Eigenkapitalkultur.“ für schnelleres Wachstum, eine höhere Forschungsintensität und internationale Präsenz. Diese Herausforderungen sind mit Fremdkapital allein nicht zu lösen – Alternativen sind gefragt. Ein Schlagwort, welches in diesem Zusammenhang häufig fällt, lautet „Private-Equity“. Mit ca. 25 Milliarden Euro Investitionsvolumen im Jahr 2005 ist diese Finanzierungsform auch in Deutschland in Mode gekommen. Doch im Frühjahr 2005 rückte Private-Equity durch die Äußerungen des damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering negativ in die Schlagzeilen. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel dieser Arbeit, die Frage zu beantworten, ob Private-Equity zur Finanzierung des Mittelstandes geeignet ist. Dazu sollen im Kapitel C die zentralen Probleme mittelstän-discher Unternehmen erörtert werden. Wie diese Unternehmen an Private-Equity gelangen, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und in welchen Unternehmenszyklusphasen es eingesetzt werden kann, ist im 4. Teil dieser Arbeit dargestellt. Abschließend wird im Kapitel E der Frage nachgegangen, welche Chancen Private-Equity dem Mittelstand bietet. Weiterhin soll geklärt werden, ob Private-Equity zur Lösung der Probleme mittelständischer Unternehmen beitragen kann.
B. Begriffsbestimmung
I. Mittelstand
Der Begriff „Mittelstand“ besitzt keine eindeutige Definition und ist so auch nur in Deutschland gebräuchlich. In Deutschland nimmt das IfM Bonn die oberste Instanz zur Begriffsdefinition ein. Demnach gibt es quantitative und qualitative Merkmale. Quantitativ zählen alle Unternehmen zum Mittelstand, die weniger als 500 Arbeit-nehmer beschäftigen und einen Jahresumsatz von unter 50 Millionen Euro erwirt-schaften. Zu den qualitativen Merkmalen dieser Unternehmen gehören nach Anga-ben des IfM u. a. die Einheit von Eigentum und Leitung, die Organisationsstruktur, die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Führung sowie die Unabhängigkeit von Konzernen. Eine weitere, in Deutschland angewandte Definition des „Mittelstan-des“ wurde von der EU aufgestellt. Auf diese soll an dieser Stelle nicht näher einge-gangen werden. Eine vergleichende Gegenüberstellung beider Definitionen befindet sich im Anhang 1. Dieser Arbeit soll die Definition des IfM Bonn zugrunde gelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Begriffsbestimmung
- I. Mittelstand
- II. Private-Equity
- C. Herausforderungen mittelständischer Unternehmen
- I. Eigenkapitalproblematik
- II. Nachfolgeregelung
- D. Private Equity: Kapitalbeschaffung und Einsatzmöglichkeiten in KMU
- I. Investoren und deren Investitionskriterien
- II. Ablauf einer Private-Equity-Finanzierung
- III. Finanzierungsphasen
- IV. Zwischenfazit
- E. Private-Equity und Mittelstand: Skepsis trotz zahlreicher Chancen
- I. Private-Equity bietet viele Möglichkeiten
- a) Stärkung der Eigenkapitalbasis mittelständischer Unternehmen
- b) Hilfe bei Nachfolgeregelungen
- c) Know-how-Transfer und Imagegewinn
- II. Vorurteile gegenüber Private-Equity und weitere Hindernisse
- I. Private-Equity bietet viele Möglichkeiten
- F. Praxisbeispiele
- I. Rossmann
- II. Otto Sauer Achsenfabrik GmbH
- G. Fazit
- Anhang
- Verzeichnis des Anhangs
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Private-Equity zur Finanzierung des deutschen Mittelstands geeignet ist. Dabei stehen die zentralen Probleme mittelständischer Unternehmen, insbesondere die Eigenkapitalproblematik und die Nachfolgeregelung, im Fokus. Weiterhin wird analysiert, wie mittelständische Unternehmen an Private-Equity-Kapital gelangen können, welche Voraussetzungen für eine Finanzierung erfüllt werden müssen und in welchen Unternehmensphasen Private-Equity sinnvoll eingesetzt werden kann.
- Definition und Herausforderungen des Mittelstands
- Private-Equity als Finanzierungsform
- Vorteile und Chancen von Private-Equity für mittelständische Unternehmen
- Mögliche Risiken und Kritikpunkte im Zusammenhang mit Private-Equity
- Praxisbeispiele für die erfolgreiche Anwendung von Private-Equity im Mittelstand
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition des Mittelstands und beleuchtet die zentralen Herausforderungen, vor denen diese Unternehmensgruppe steht. Insbesondere werden die Probleme der Eigenkapitalbeschaffung und der Nachfolgeregelung aufgezeigt. Im zweiten Kapitel wird der Begriff Private-Equity näher erläutert und die verschiedenen Formen dieser Finanzierungsform vorgestellt, darunter Venture Capital, Buy-Outs und Mezzanine-Finanzierung.
Das dritte Kapitel analysiert die Einsatzmöglichkeiten von Private-Equity im Mittelstand und untersucht die Kriterien, die Investoren bei der Auswahl von Unternehmen berücksichtigen. Des Weiteren wird der Ablauf einer Private-Equity-Finanzierung Schritt für Schritt beschrieben.
Kapitel vier befasst sich mit den Vorteilen und Chancen von Private-Equity für mittelständische Unternehmen, wie z.B. der Stärkung der Eigenkapitalbasis, der Unterstützung bei der Nachfolgeregelung und dem Know-how-Transfer. Daneben werden auch die Kritikpunkte und Risiken im Zusammenhang mit Private-Equity beleuchtet.
Das fünfte Kapitel präsentiert Praxisbeispiele für die erfolgreiche Anwendung von Private-Equity im Mittelstand. Anhand konkreter Unternehmen wird gezeigt, wie diese Finanzierungsform zur Lösung der spezifischen Herausforderungen einzelner Unternehmen beitragen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Private-Equity als Finanzierungsform für mittelständische Unternehmen. Schwerpunkte sind die Eigenkapitalproblematik, die Nachfolgeregelung, die verschiedenen Formen von Private-Equity-Finanzierung (Venture Capital, Buy-Outs, Mezzanine) sowie die Chancen und Risiken dieser Finanzierungsform für den Mittelstand.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Private-Equity?
Private-Equity bezeichnet außerbörsliches Beteiligungskapital, das Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, um Wachstum, Innovationen oder Nachfolgeregelungen zu finanzieren.
Warum benötigt der Mittelstand Private-Equity?
Viele mittelständische Unternehmen leiden unter einer geringen Eigenkapitalquote. Private-Equity bietet eine Alternative zum klassischen Bankkredit, um internationales Wachstum und Forschung zu finanzieren.
Welche Chancen bietet Private-Equity mittelständischen Firmen?
Neben der Stärkung der Eigenkapitalbasis profitieren Unternehmen oft von einem Know-how-Transfer durch die Investoren sowie einer besseren Positionierung bei Nachfolgeregelungen.
Welche Vorurteile gibt es gegenüber Private-Equity?
Private-Equity-Gesellschaften werden oft kritisch als "Heuschrecken" betrachtet, denen es nur um kurzfristige Gewinnmaximierung auf Kosten der Mitarbeiter geht. Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Skepsis berechtigt ist.
In welchen Phasen wird Private-Equity eingesetzt?
Es wird in verschiedenen Phasen genutzt: als Venture Capital für Start-ups, als Wachstumsfinanzierung oder im Rahmen von Buy-Outs bei etablierten Unternehmen.
- Citar trabajo
- Andreas Garbotz (Autor), 2006, Private-Equity zur Finanzierung von mittelständischen Unternehmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154869