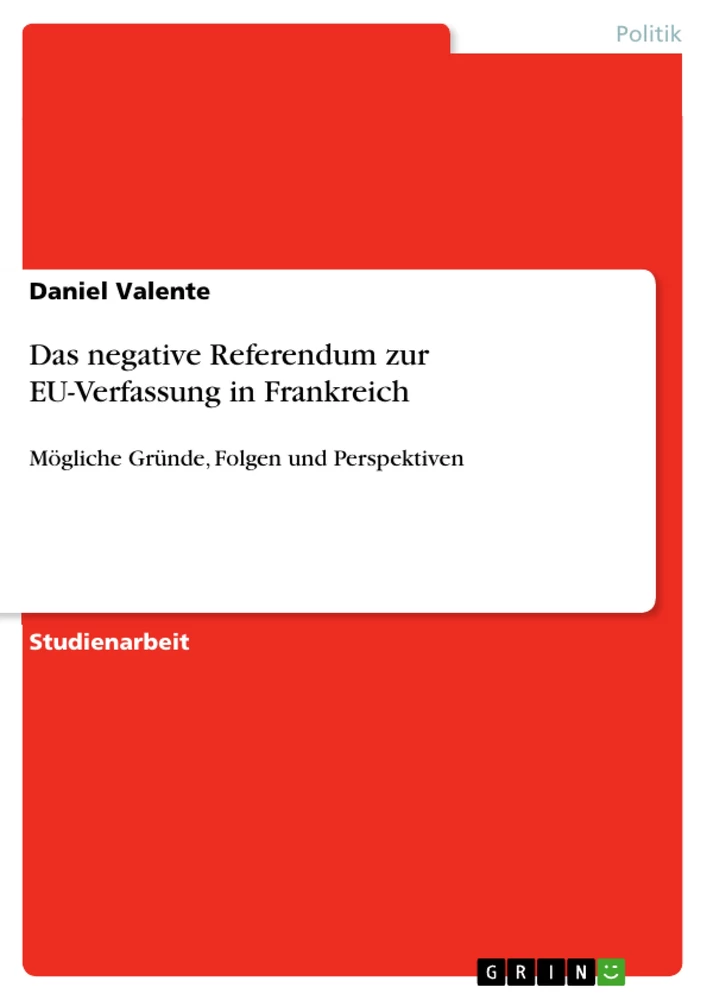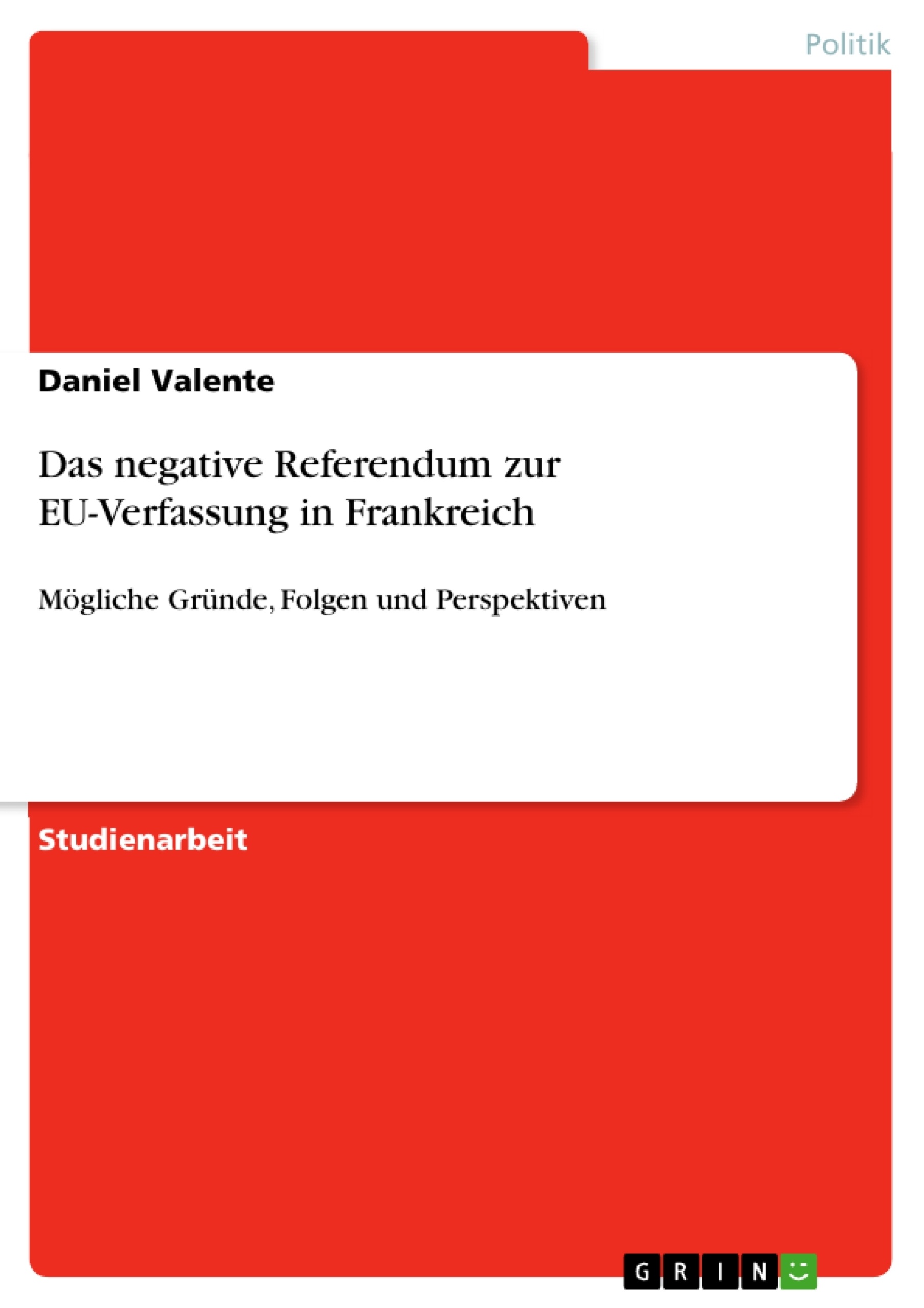Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs den EU-Verfassungsvertrag in Rom. Eine Verfassung soll im Allgemeinen zunächst Machtausübung legitimieren, zur Organisation beitragen, begrenzen, integrativ wirken und zur Identitätsbildung der Bürger führen. Zudem kann sie den alltägliche politischen Prozess von bestimmten Problemen und Streitigkeiten entlasten.
Der Hauptgrund für die Entscheidung der Europäischen Union, eine Verfassung einzuführen, waren jedoch nicht bloß pragmatische oder juristische Erfordernisse. Es ging, neben verschiedenen anderen Aspekten, ganz speziell um die Integrationsfunktion der Verfassung, also einer verstärkten Identifikation der Bürger mit dem Staatengebilde der EU und der Entwicklung und Stärkung einer europäischen Identität, denn allein der Begriff „Verfassung“ ist bei der Mehrzahl der Menschen positiv konnotiert. Bevor die Verfassung für die EU jedoch in Kraft treten konnte, musste der Vertrag von den einzelnen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.
„Die Verfassung muss jetzt noch ratifiziert werden. Da wird es einige Aufregung geben, aber am Schluss tritt sie [die Verfassung] in Kraft.“ Dieser optimistischen Aussage Joschka Fischers, dem ehemaligen Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, wurde durch die gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden widersprochen. Die Ratifizierung erfolgte zuvor jedoch bereits in mehreren Ländern, die insgesamt mehr als 50% der EU-Bevölkerung ausmachen. Die EU steht nun vor dem Problem, dass ein Teil der Länder die Verfassung faktisch befürwortet hat, die Bevölkerung zweier Gründerstaaten der EU diese jedoch bis dato ablehnt. Durch diese Ablehnung ist die Verfassung formal gescheitert. Seitdem wurde viel über die Gründe für das Scheitern der Referenden spekuliert.
Diese Arbeit beschäftigt sich speziell mit dem Referendum in Frankreich. Dabei soll das französische Referendum noch einmal analysiert, die Gründe für das Scheitern hinterfragt und die Folgen des „Non“ der Franzosen dargestellt werden. Dabei kommt es zu Vergleichen verschiedener Aussagen, die es zu hinterfragen gilt. Im letzten Teil der Arbeit wird versucht, Möglichkeiten für das weitere Verfahren der EU in Bezug auf die Verfassung darzustellen und verschiedene Vorschläge zu diesem Thema aufzugreifen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1 Das Referendum in Frankreich
- II.2 Die Organisation des Referendums
- II.3 Mögliche Gründe für den negativen Ausgang des Referendums
- II.4 Schlussfolgerungen aus dem „Non“ und Perspektiven für die Zukunft
- III. Fazit
- IV. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem negativen Referendum zur EU-Verfassung in Frankreich. Sie analysiert das Referendum, hinterfragt die Gründe für das Scheitern und stellt die Folgen des „Non“ dar. Dabei werden verschiedene Aussagen verglichen und hinterfragt. Des Weiteren werden Möglichkeiten für weitere Verfahren der EU in Bezug auf die Verfassung betrachtet.
- Analyse des Referendums in Frankreich
- Gründe für den negativen Ausgang des Referendums
- Folgen des „Non“ der Franzosen
- Perspektiven für die Zukunft
- Möglichkeiten für weitere Verfahren der EU in Bezug auf die Verfassung
Zusammenfassung der Kapitel
II. Hauptteil
II.1 Das Referendum in Frankreich
Das Referendum in Frankreich war ein Plebiszit von oben, das vom französischen Präsidenten Jacques Chirac initiiert wurde. Die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs wurden direkt aufgefordert, sich für oder gegen den Verfassungstext auszusprechen. Das Ergebnis war für die Regierung bindend.3
Es gab verschiedene Gründe, warum Chirac die Frage zur EU-Verfassung in einem Referendum beantworten ließ. In Frankreich war es undenkbar, einem als Verfassung gekennzeichneten Text ohne Befragung des Volkes zuzustimmen. Zudem hatte Tony Blair in Großbritannien bereits ein Referendum in Aussicht gestellt, was den Druck auf Chirac erhöhte. Chirac sah im Referendum die Möglichkeit, das gegnerische Lager der Sozialisten, in dem sich Verfassungsbefürworter und Verfassungsgegner gegenüberstanden, zu spalten und dadurch seinem Rivalen Nicolas Sarkozy, ein deutlicher Befürworter des Referendums, den Wind aus den Segeln zu nehmen.4
II.2 Die Organisation des Referendums
Vor dem Referendum herrschte in Frankreich eine Wahlkampfstimmung, wie man sie sonst nur von Präsidentschaftswahlen kennt. Politische Parteien konnten staatliche Unterstützung für ihre Kampagnen beantragen. Jede Partei erhielt eine zehnminütige Mindestzeit kostenloser Fernsehwerbung.5
Zwei Wochen vor der Abstimmung erhielten alle Haushalte Frankreichs den Text des EVV, den Gesetzesentwurf zur Ratifizierung sowie einen zusätzlichen Brief der Regierung mit verschiedenen Erklärungen. Dennoch beschwerten sich viele Bürger über unzureichende Informationen.5
Schlüsselwörter
EU-Verfassung, Referendum, Frankreich, negative Ergebnisse, Folgen, Perspektiven, europäische Integration, Identität, Staats- und Regierungschefs, Ratifizierung, Volksbegehren, Volksabstimmung, Plebiszit, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Attac, EU-Verfassungsvertrag (EVV).
- Citation du texte
- Daniel Valente (Auteur), 2007, Das negative Referendum zur EU-Verfassung in Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154900