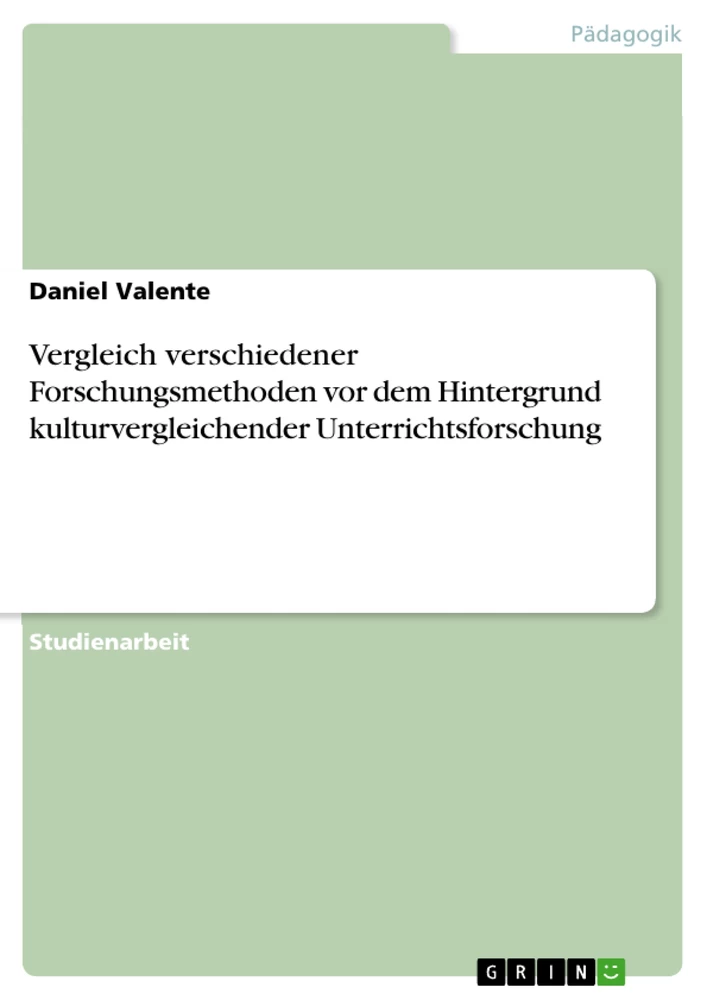Nicht zuletzt durch die ernüchternden Ergebnisse der großen Schulleistungsstudien wie z.B. PISA (Programme for International Student Assessment) oder TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) ist das bestehende Schulsystem mit den ausführenden Kräften, den Lehrpersonen, in die Diskussion geraten, sei es nun in der Politik oder im Bereich der Bildungsforschung. Das relativ schlechte Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich war besonders für Deutschland, dessen Bildungssystem in den 1970er Jahren noch von skandinavischen Lehrkräften studiert wurde, besonders erschreckend. Die Ergebnisse machten den längst überfälligen Handlungsbedarf in deutschen Schulen erstmals öffentlich und klar erkennbar. Seitdem sind Bildungsforscher, Theoretiker wie Praktiker, verstärkt daran interessiert, die Unterrichtsqualität an deutschen Schulen nachhaltig zu verbessern. Dazu wurden in der Vergangenheit eine Vielzahl von Studien angestellt (u.a. auch die TIMSS), die auf verschiedene Weise ausgewertet wurden.
Diese Arbeit beschäftigt sich primär nicht mit der Frage, was Unterrichtsqualität bedeutet und wird auch nur blickpunktartig auf einige der Studien eingehen können. Im Vordergrund steht das Interesse herauszufinden, welche Forschungsmethode bzw. Art der Auswertung von Daten besonders für die Praxis aussagekräftige Ergebnisse liefert. Neben hoch- und niedrig-inferenten Auswertungsverfahren wird der Ansatz der Unterrichtsskripts vor kulturvergleichendem Hintergrund thematisiert. Dies bietet sich wegen der ausführlichen Vergleichsstudien zwischen Deutschen und deutschsprachigen Schweizer Lehrkräften und Schülern an.
Zunächst wird einführend allgemein auf den kulturvergleichenden Aspekt und die videogestützte Arbeit eingegangen, beziehen sich doch viele der damit zusammenhängenden Aussagen auf derartige Analysen. Daraufhin werden spezielle Beispiele bezogen auf praktische Forschung nach Unterrichtsskripts bzw. der Auswertung nach hoch- und niedrig-inferenten Methoden angeschlossen. Im letzten Teil der Arbeit sollen dann die Vor- und Nachteile der beschriebenen Forschungsansätze resümiert werden, um am Ende eventuell feststellen zu können, welcher Forschungsansatz sich für Praktiker besonders eignet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1 Unterrichtsqualität / Videoforschung
- II.2 Kulturvergleichende Unterrichtsforschung
- II.2.1 Warum Kulturvergleich?
- II.2.2 Unterrichtsskripts
- II.3 Niedrig und hoch-inferente Beobachtungsinstrumente
- II.3.1 Anwendung niedrig-inferenter Bewertung
- II.3.2 Anwendung hoch-inferenter Bewertung
- III. Fazit
- IV. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht verschiedene Forschungsansätze zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und fokussiert dabei auf die Frage, welche Methode besonders aussagekräftige Ergebnisse für die Praxis liefert.
- Kulturvergleichende Unterrichtsforschung
- Unterrichtsskripts und deren kulturspezifische Ausprägung
- Niedrig- und hoch-inferente Beobachtungsinstrumente zur Unterrichtsanalyse
- Videobasierte Unterrichtsforschung als Methode der Datenerhebung
- Die Bedeutung von Unterrichtsqualität für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas Unterrichtsqualität im Kontext der Ergebnisse von Schulleistungsstudien wie PISA und TIMSS. Sie führt die Bedeutung von kulturvergleichenden Studien und der Videoforschung ein und stellt den Forschungsansatz der Arbeit vor.
Der Hauptteil befasst sich zunächst mit dem Konzept der Unterrichtsqualität und der Rolle der Videoforschung. Der Fokus liegt auf der kulturvergleichenden Unterrichtsforschung, insbesondere auf der Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer spezifische Unterrichtsskripts verwenden, die kulturspezifisch geprägt sind. Dieser Abschnitt analysiert die Ergebnisse von Videostudien, die im Rahmen der TIMSS durchgeführt wurden und gibt Einblicke in die Praxis des Mathematikunterrichts in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz.
Im Weiteren werden die beiden Auswertungsmethoden niedrig- und hoch-inferenter Beobachtungsinstrumente vorgestellt und an Beispielen erläutert. Diese Methoden dienen der Analyse von Videoaufnahmen und ermöglichen unterschiedliche Ebenen der Interpretation von Unterrichtsdaten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Unterrichtsqualität, Videoforschung, Kulturvergleich, Unterrichtsskripts, niedrig- und hoch-inferente Beobachtungsinstrumente, TIMSS, Bildungsforschung, Lehrerbildung, Lernerfolg.
- Arbeit zitieren
- Daniel Valente (Autor:in), 2007, Vergleich verschiedener Forschungsmethoden vor dem Hintergrund kulturvergleichender Unterrichtsforschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154904