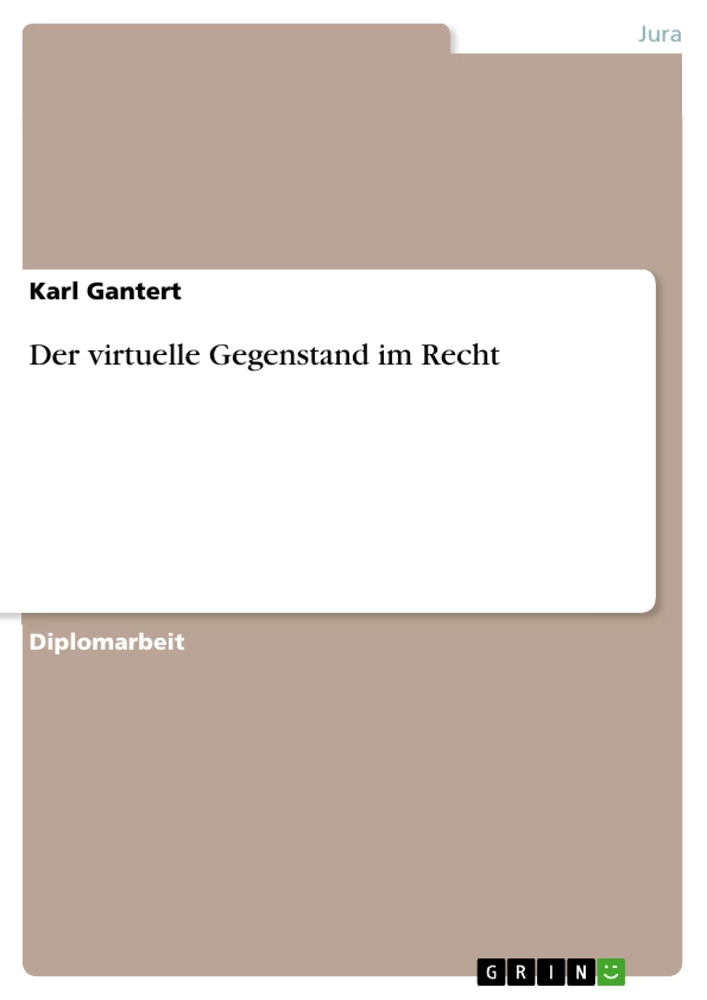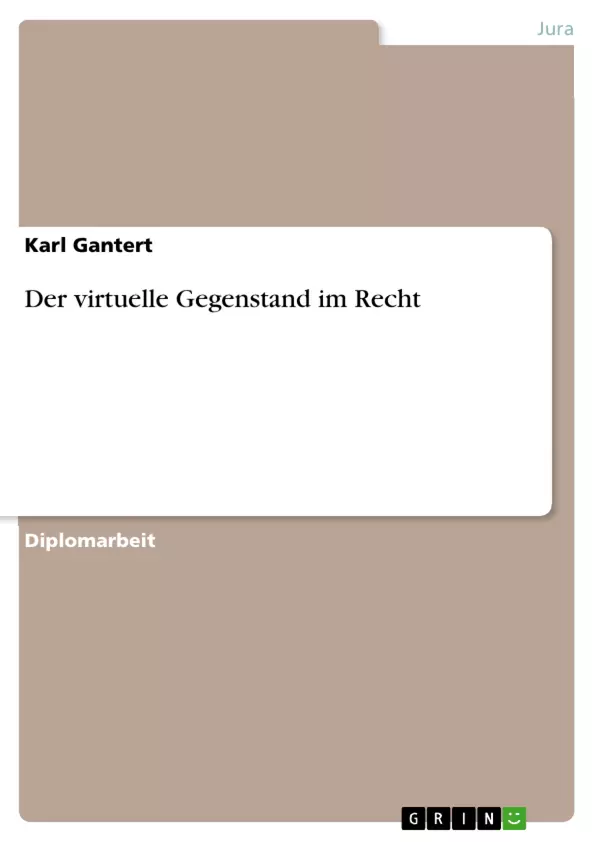Spielwelten existieren nicht real. Es handelt sich hier um rein virtuelle Räume, in der von Menschen gesteuerte Spielfiguren bewegt werden und sich die Teilnehmer wegen der Persistenz dieser virtuellen Umgebungen zudem auch langfristig aufhalten. Die Grenzen zwischen Spiel und Wirtschaftsleben verwischen zunehmend. Eine potenzielle Einnahmequelle für die Betreiber sind hierbei virtuelle Gegenstände. Obwohl die Spielsoftware in der Grundversion kostenlos ist, spielt Geld auch in dieser Parallelwelt eine große Rolle. Wie in der realen Welt kann man auch hier seine Dienste anbieten oder Handel mit virtuellen Gegenständen betreiben. Die bei den vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Nutzern auftretenden juristischen Probleme sind derzeit erst oberflächlich sichtbar. Die bestehenden Strafrechts- und Zivilrechtsnormen erfassen bisher ausschließlich die reale Welt und noch keine virtuellen Fantasiewelten. Würde es überhaupt keine Regeln in Onlinespielen geben, wäre die Konsequenz ein rechtsfreier Raum. Trotz der hier üblichen spielerischen Freiheit benötigen aber auch virtuelle Welten bei Konflikten Verhaltensnormen für ein erfolgreiches Zusammenwirken der Charaktere. Vergleichbar mit der Situation im World Wide Web sind virtuelle Welten kein rechtsfreier Raum und auch nicht einem eigenen Recht unterworfen, sondern es gelten die ganz normalen Gesetze. Zunächst ist deshalb zu klären, ob hier die Normen aus der realen Welt auf virtuelle Räume übertragbar sind oder ob sich Regelungslücken ergeben, die durch Rechtsprechung oder Gesetzesänderungen zu schließen sind. Anders als reale Welten sind virtuelle Welten nicht an territoriale Grenzen gebunden, wodurch sich weiterhin die Frage stellt, welches nationale Recht auf die Rechtsbeziehungen in virtuellen Welten überhaupt anwendbar ist. Der Handel innerhalb der virtuellen Welt unterliegt grundsätzlich den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie in der Realität, wobei sich hier jedoch durch Verbote der Spielbetreiber Rechtsunsicherheiten für die Nutzer ergeben, die es aufzuklären gilt. Im angloamerikanischen Raum werden Rechtsfragen virtueller Welten mit den dort enthaltenen virtuellen Gegenständen bereits kontrovers diskutiert und es gibt auch schon erste Rechtsstreitigkeiten um virtuelle Gegenstände. Richtungsweisende Entscheidungen zu virtuellen Gegenständen aus der Rechtsprechung fehlen aber bislang noch.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung
- II. Untersuchungsziele
- III. Gliederung der Arbeit
- B. Onlinespiele
- I. Begriff und Konzept
- II. Wirtschaftliches Potenzial
- III. Die wichtigsten Gattungen von Onlinespielen
- 1. Browser-Games
- 2. Massively Multiplayer Online Games (MMOGs)
- 3. Virtuelle Welten
- IV. Technische Grundlagen
- 1. Onlineverbindungen
- 2. Plattformen
- 3. Kommunikationsarchitekturen
- C. Dogmatische Einordnung virtueller Gegenstände
- I. Technische Ebene
- II. Ökonomische Ebene
- III. Juristische Ebene
- 1. Die Rechtsnatur der Items
- 2. Die Rechtsnatur der Spielfiguren
- 3. Die Rechtsnatur der virtuellen Währung
- IV. Zusammenfassung und Ergebnisse zur dogmatischen Einordnung virtueller Gegenstände
- D. Rechte an virtuellen Gegenständen
- I. Immaterialgüterrechtliche Qualifikation
- II. Dingliche Rechte
- 1. Eigentum
- 2. Besitz
- III. Zusammenfassung und Ergebnisse zu den Rechten an virtuellen Gegenständen
- E. Urheberrechtliche Bewertung
- I. Urheberrechtliche Schutzfähigkeit
- 1. Computerprogrammcode
- 2. Audiovisueller Inhalt und Darstellung
- 3. Virtuelle Kreationen
- a) Virtuelle Gegenstände
- b) Besonderheiten bei virtuellen Immobilien
- c) Spielfiguren
- II. Urheberschaft
- 1. Onlinespiel
- 2. Virtuelle Kreationen
- III. Erschöpfung von Verwertungsrechten
- IV. Urheberrechtsverletzungen
- V. Zusammenfassung und Ergebnisse der urheberrechtlichen Bewertung
- F. Gewerbliche Schutzrechte
- I. Geschmacksmusterschutz
- II. Markenschutz
- III. Patentrechtlicher Schutz
- IV. Zusammenfassung und Ergebnisse zu gewerblichen Schutzrechten
- G. Rechtsbeziehungen in virtuellen Welten
- I. Kollisionsrechtliche Fragen
- 1. Vertikale Nutzungsverträge zwischen Spielbetreiber und Nutzern
- 2. Horizontale Nutzungsverträge zwischen den Nutzern
- 3. Zusammenfassung und Ergebnisse zu kollisionsrechtlichen Fragen
- II. Gestaltungsmöglichkeiten durch AGB
- 1. Klauseln zur Löschung/Sperrung eines Accounts und Abschaltung des Service
- 2. Klauseln zur Haftungsbeschränkung
- 3. Klauseln zur Übertragung des Accounts
- a) Endgültige Übertragung des Accounts
- b) Temporäre Überlassung eines Accounts
- 4. Klauseln zum Handel mit virtuellen Gegenständen
- 5. Zusammenfassung und Ergebnisse zu den Gestaltungsmöglichkeiten durch AGB
- III. Vertikales Rechtsverhältnis zwischen Spielbetreiber und Nutzer
- 1. Vertragsleistungen
- 2. Vertragliche Einordnung der Leistungen
- a) Überlassungsvertrag Clientsoftware
- b) Onlinenutzungsvertrag
- aa) Klassifizierung als Mietvertrag
- bb) Klassifizierung als Pachtvertrag
- cc) Klassifizierung als Dienstvertrag
- c) Vertragliche Einordnung des Leistungsgegenstands
- Gewährleistung der Onlineerreichbarkeit
- d) Gemischter Vertrag als Ergebnis der vertraglichen Einordnung der Leistungen
- aa) Kostenlose Nutzer-Accounts
- bb) Kostenpflichtige Nutzer-Accounts
- 3. Beendigung des Vertragsverhältnisses
- a) Ordentliche Kündigung
- b) Außerordentliche Kündigung
- 4. Das virtuelle Hausrecht des Spielbetreibers
- 5. Zusammenfassung und Ergebnisse zum vertikalen Rechtsverhältnis zwischen Spielbetreiber und Nutzer
- IV. Horizontales Rechtsverhältnis zwischen den Nutzern untereinander
- 1. Vertragsschlüsse in der virtuellen Welt
- 2. Übertragung des Accounts
- 3. Übertragung virtueller Gegenstände
- a) Verpflichtungsgeschäft
- aa) Werk-/dienstvertragliche Qualifikation des Rechtsgeschäfts
- bb) Leistungsgegenstand nach § 453 BGB
- cc) Tausch nach § 480 BGB
- dd) Miet-/pachtvertragliche Qualifikation des Rechtsgeschäfts
- b) Verfügungsgeschäft
- 4. Zusammenfassung und Ergebnisse zum horizontalen Rechtsverhältnis zwischen Spielbetreiber und Nutzer
- V. Virtuelle Gegenstände im Zwangsvollstreckungsverfahren
- 1. Zusammenfassung und Ergebnisse zur Zwangsvollstreckung von virtuellen Gegenständen
- VI. Rechtsverletzungen
- 1. Durch die Nutzer
- a) Strafrechtliche Haftung
- b) Zivilrechtliche Haftung
- aa) Vertragliche Ansprüche
- bb) Dingliche Ansprüche
- cc) Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag
- dd) Deliktische Haftungstatbestände
- ee) Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
- 2. Durch den Betreiber
- a) Originäre Haftung für eigene Handlungen
- b) Abgeleitete Haftung für Handlungen der Nutzer
- 3. Zusammenfassung und Ergebnisse zu Rechtsverletzungen in virtuellen Welten
- H. Schlussbetrachtung
- I. Würdigung und Ausblick
- Rechtliche Einordnung virtueller Gegenstände
- Schutzmöglichkeiten für virtuelle Gegenstände im Immaterialgüterrecht, Dinglichem Recht und Gewerblichen Rechtsschutz
- Rechtsbeziehungen zwischen Spielbetreibern und Nutzern sowie zwischen Nutzern untereinander
- Haftung für Rechtsverletzungen in virtuellen Welten
- Zwangsvollstreckung von virtuellen Gegenständen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Rechtsnatur virtueller Gegenstände im Kontext von Online-Spielen. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für virtuelle Gegenstände in der digitalen Welt zu analysieren und zu bewerten. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und in welcher Form virtuelle Gegenstände rechtlich geschützt werden können, und welche Rechtsbeziehungen zwischen Spielbetreibern und Nutzern sowie unter den Nutzern untereinander entstehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Untersuchungsziele definiert. Kapitel B beschäftigt sich mit dem Konzept von Online-Spielen, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und den wichtigsten Gattungen von Onlinespielen. Kapitel C untersucht die dogmatische Einordnung virtueller Gegenstände auf technischer, ökonomischer und juristischer Ebene. Kapitel D befasst sich mit den Rechten an virtuellen Gegenständen im Immaterialgüterrecht und im Dinglichem Recht. Kapitel E analysiert die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von virtuellen Gegenständen und die Anwendung des Urheberrechts in der digitalen Welt. Kapitel F beschäftigt sich mit dem gewerblichen Schutz von virtuellen Gegenständen. Kapitel G analysiert die Rechtsbeziehungen zwischen Spielbetreibern und Nutzern sowie zwischen Nutzern untereinander im Kontext von Online-Spielen. Abschließend zieht die Arbeit in Kapitel H eine Würdigung der Ergebnisse und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Virtuelle Gegenstände, Online-Spiele, Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Rechtsbeziehungen, Vertrag, Haftung, Zwangsvollstreckung, Immaterialgüterrecht, Dingliches Recht, Spielbetreiber, Nutzer, virtuelle Welt, digitales Recht.
- Arbeit zitieren
- Karl Gantert (Autor:in), 2010, Der virtuelle Gegenstand im Recht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154970