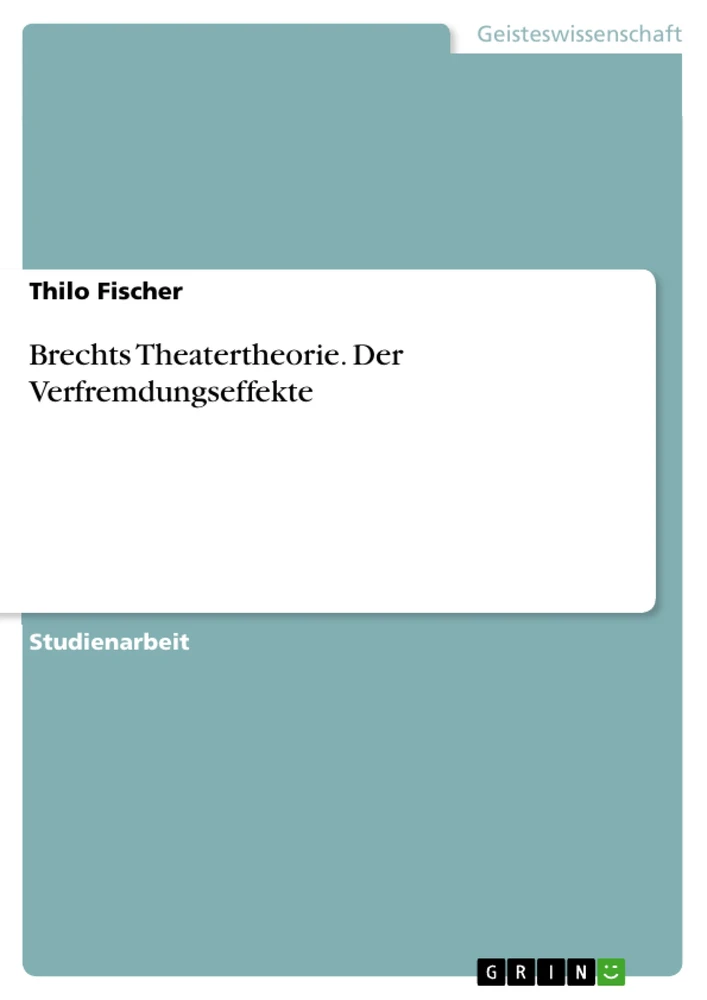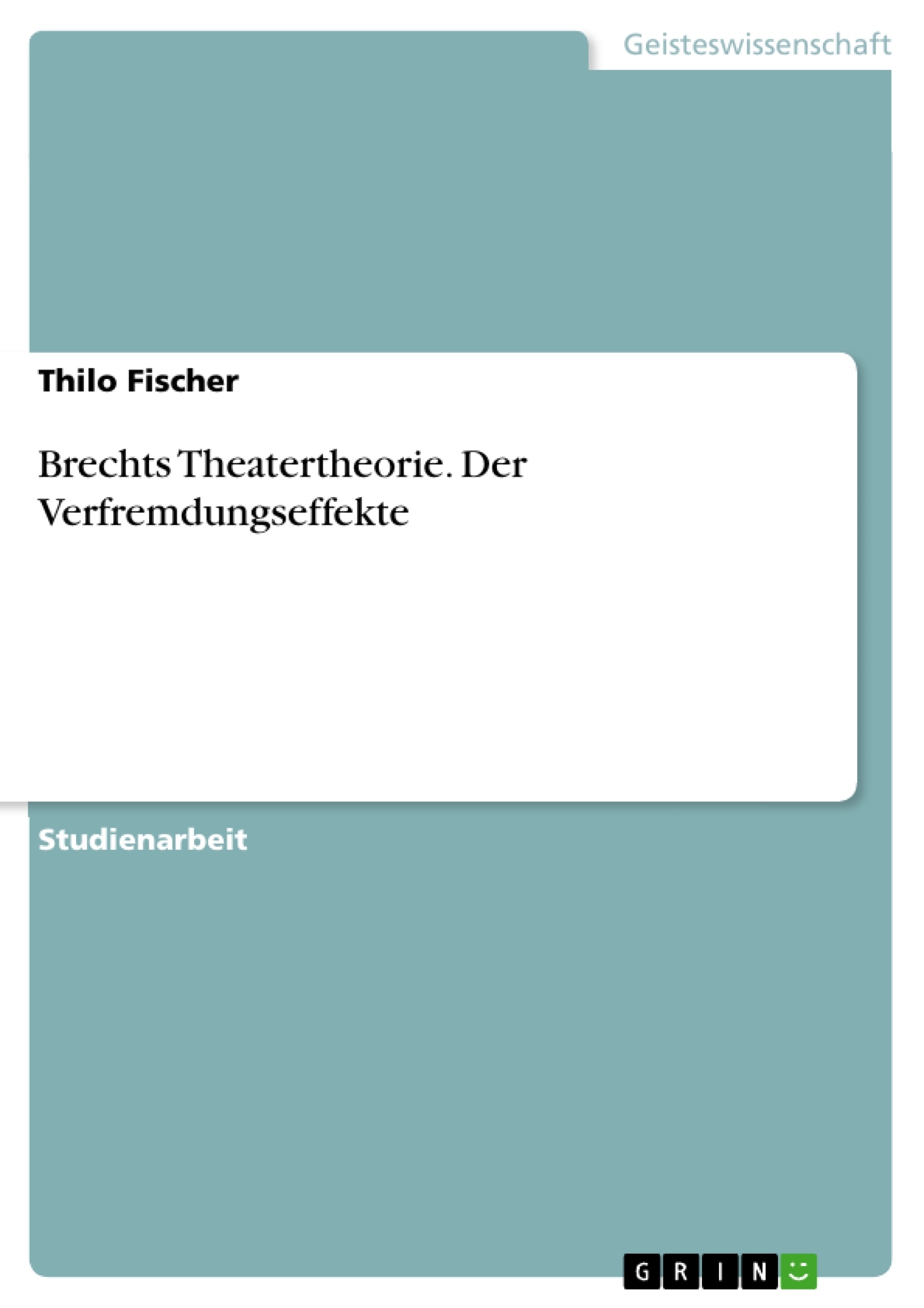Mit seiner Auffassung vom epischen Theater als Lehrtheater steht Bertolt Brecht zunächst in typisch aufklärerischer Tradition, allerdings mit ganz anderen Prämissen und Intentionen. Hatte Lessing die Aufgabe der Tragödie etwa in der Erweiterung der „Fähigkeit, Mitleid zu fühlen“ gesehen, so ging er davon aus, dass der Zuschauer durch die kathartische Wirkung des Fühlens von Furcht und Mitleid das Theater als besserer Mensch verlässt, wobei die Katharsis in der Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten bestehe. Lessings erzieherisches Ziel des allseits gebildeten Bürgers versuchte Gefühl und Ratio zu verbinden. Durch das Fühlen mit dem Helden auf der Bühne und der Wendung auf sich selbst im Sinne eines Transfers auf die eigene Situation soll der einzelne Mensch geläutert werden. Gerade diese Einfühlung ist es, die Brecht als „Grundpfeiler“ der von Aristoteles bestimmten „herrschenden Ästhetik“ ablehnt, weil sie dem modernen wissenschaftlichen Zeitalter nicht mehr angemessen sei. Statt sich mit dem Bühnenhelden zu identifizieren, soll der Zuschauer die distanzierte Beobachtungshaltung des forschenden Wissenschaftlers einnehmen, denn „[d]as Wesentliche am epischen Theater ist vielleicht, dass es nicht so sehr an das Gefühl, sondern mehr an die Ratio des Zuschauers appelliert. Nicht miterleben soll der Zuschauer, sondern sich auseinandersetzen.“ Bei Benjamin heißt es dazu, dass das Publikum für das epische Theater „nicht mehr eine Masse hypnotisierter Versuchspersonen sondern eine Versammlung von Interessenten“ sei, deren Anforderungen es zu genügen habe. Der Zuschauer soll sich nicht mit dem dargestellten Stoff mitleidig identifizieren, sondern einen Erkenntnisgewinn davontragen und mitdenken. „Mitdenken erfordert jedoch einen klaren Kopf, den Abstand, der es ermöglicht, einen Vorgang von allen Seiten zu sehen".
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Episches Theater - eine nicht-aristotelische Dramatik
- Elemente des „Epischen Theaters“
- Verfremdungstechniken
- Verfremdungseffekte der Dramaturgie und Inszenierung
- Historisieren
- Brechts neue Schauspielkunst
- Verfremdungstechniken
- Schlussbemerkungen
- Quellenverzeichnis
- Primär- und Sekundärliteratur
- Internetquellen
- Aufführungsnachweis
- Anhang
- Gegenüberstellung des dramatischen und epischen Theaters
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Bertolt Brechts Theorie des epischen Theaters, insbesondere mit den Verfremdungseffekten. Ziel ist es, Brechts Ansatz im Kontext der Theatergeschichte zu verorten und seine Intentionen zu erläutern. Die Arbeit untersucht die Abgrenzung zum aristotelischen Drama und analysiert die Bedeutung der Verfremdungstechniken für Brechts Konzept eines aufklärerischen und kritischen Theaters.
- Brechts Abkehr vom aristotelischen Drama
- Das epische Theater als Lehrtheater
- Die Funktion der Verfremdungseffekte
- Brechts Auseinandersetzung mit dem Marxismus
- Das epische Theater im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des 19. und 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und verortet Brechts Theatertheorie im Kontext der sozialen und industriellen Veränderungen des 19. Jahrhunderts. Es wird die „Krise des Dramas“ angesprochen, die durch den Widerspruch zwischen dramatischer Form und undramatischem Stoff entsteht und zur Entwicklung des epischen Theaters führt. Der Autor kündigt an, das epische Theater im Rahmen der Arbeit näher zu beschreiben.
2. Einleitung: Die Einleitung stellt Brechts episches Theater als Lehrtheater vor und vergleicht dessen aufklärerische Tradition mit der Lessings. Im Gegensatz zu Lessings Fokus auf Katharsis und Einfühlung, die den Zuschauer zu einem besseren Menschen machen sollen, betont Brecht die Bedeutung der Distanzierung und des kritischen Denkens. Der Zuschauer soll nicht mitfühlen, sondern sich mit dem dargestellten Stoff auseinandersetzen und einen Erkenntnisgewinn erzielen. Brechts Ablehnung der aristotelischen Ästhetik und sein Ziel, einen kritischen und intelligenten Zuschauer zu fördern, werden deutlich herausgearbeitet.
3. Episches Theater - eine nicht-aristotelische Dramatik: Dieses Kapitel behandelt den scheinbaren Widerspruch zwischen epischer und dramatischer Form im Theater. Brecht argumentiert, dass sich Epik und Dramatik nicht ausschließen, sondern gegenseitig ergänzen. Es werden historische Vorläufer des epischen Theaters, wie Passionsspiele und Mysterienspiele, erwähnt, um die Entwicklung hin zu einer eigenständigen Theaterform zu verdeutlichen. Die Weiterentwicklung des epischen Theaters durch Piscator und Brecht in den 1920er Jahren und die erste Erwähnung des Begriffs im Kontext der Aufführung von Paquets „Fahnen“ werden beschrieben.
Schlüsselwörter
Episches Theater, Bertolt Brecht, Verfremdungseffekt, Aristoteles, Dramatik, Epik, Lehrtheater, Marxismus, gesellschaftliche Veränderungen, wissenschaftliches Zeitalter, kritisches Denken, Distanzierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Episches Theater Bertolt Brechts
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Bertolt Brechts Theorie des epischen Theaters, insbesondere die Verfremdungseffekte. Sie verortet Brechts Ansatz in der Theatergeschichte, erläutert seine Intentionen und untersucht die Abgrenzung zum aristotelischen Drama. Die Bedeutung der Verfremdungstechniken für Brechts Konzept eines aufklärerischen und kritischen Theaters steht im Mittelpunkt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Brechts Abkehr vom aristotelischen Drama, das epische Theater als Lehrtheater, die Funktion der Verfremdungseffekte, Brechts Auseinandersetzung mit dem Marxismus und das epische Theater im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen des 19. und 20. Jahrhunderts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält ein Vorwort, eine Einleitung, ein Kapitel zum epischen Theater als nicht-aristotelische Dramatik (inkl. Verfremdungstechniken), Schlussbemerkungen, ein Quellenverzeichnis (Primär- und Sekundärliteratur, Internetquellen, Aufführungsnachweis) und einen Anhang mit einer Gegenüberstellung des dramatischen und epischen Theaters.
Was sind die wichtigsten Verfremdungstechniken?
Die Arbeit beschreibt Verfremdungseffekte der Dramaturgie und Inszenierung, das "Historisieren" und Brechts neue Schauspielkunst als zentrale Verfremdungstechniken. Die genaue Analyse dieser Techniken ist im Kapitel über das epische Theater zu finden.
Wie grenzt sich Brechts episches Theater vom aristotelischen Drama ab?
Brecht lehnt die aristotelische Ästhetik ab, insbesondere die Katharsis und Einfühlung. Im Gegensatz zum aristotelischen Drama zielt das epische Theater auf Distanzierung und kritisches Denken des Zuschauers. Der Zuschauer soll nicht mitfühlen, sondern sich kritisch mit dem dargestellten auseinandersetzen und einen Erkenntnisgewinn erzielen. Die Arbeit beleuchtet diesen Gegensatz ausführlich.
Welche Rolle spielt der Marxismus in Brechts epischem Theater?
Die Arbeit untersucht Brechts Auseinandersetzung mit dem Marxismus und dessen Einfluss auf sein Theaterkonzept. Der genaue Zusammenhang wird im Text detailliert dargelegt.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Episches Theater, Bertolt Brecht, Verfremdungseffekt, Aristoteles, Dramatik, Epik, Lehrtheater, Marxismus, gesellschaftliche Veränderungen, wissenschaftliches Zeitalter, kritisches Denken, Distanzierung.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis ist zu Beginn der Arbeit aufgeführt und beinhaltet Vorwort, Einleitung, ein Kapitel zum epischen Theater, Schlussbemerkungen, Quellenverzeichnis und einen Anhang.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Brechts Theorie des epischen Theaters zu erklären und im Kontext der Theatergeschichte zu verorten. Sie soll Brechts Intentionen verdeutlichen und die Bedeutung der Verfremdungstechniken für sein Konzept eines kritischen und aufklärerischen Theaters analysieren.
- Quote paper
- Thilo Fischer (Author), 2010, Brechts Theatertheorie. Der Verfremdungseffekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155075