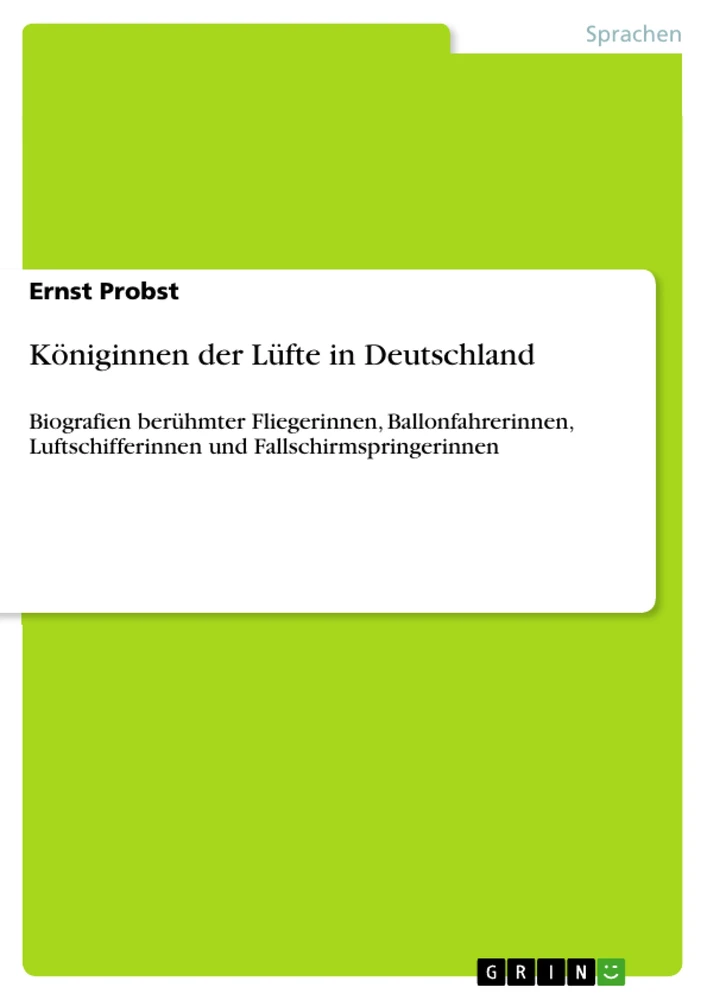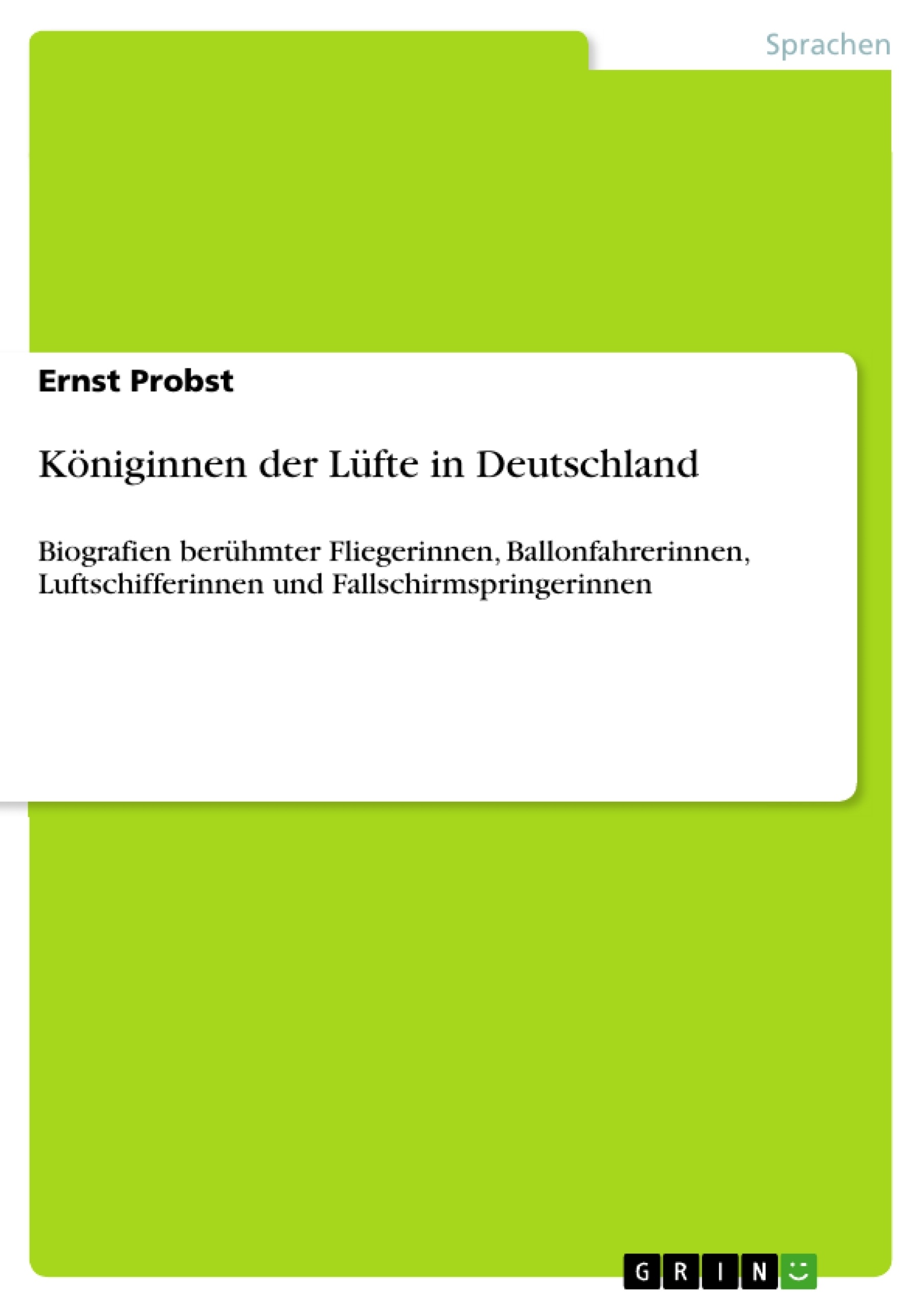Königinnen der Lüfte in Deutschland werden in dem gleichnamigen Taschenbuch des Wiesbadener Autors Ernst Probst in Wort und oft auch mit Bild vorgestellt. Zu seinen Spezialitäten gehören Biografien über berühmte Frauen und populärwissenschaftliche Themen.
18 Kapitel schildern das Leben von Liesel Bach, Melli Beese, Elly Beinhorn, Vera von Bissing, Marga von Etzdorf, Margret Fusbahn, Luise Hoffmann, Thea Knorr, Rita Maiburg, Käthe Paulus, Thea Rasche, Wilhelmine Reichard, Hanna Reitsch, Christl-Marie Schultes, Lisl Schwab, Melitta Gräfin Schenk von Stauffenberg, Sabine Trube und Beate Uhse.
Liesel Bach gebührt die Ehre, Deutschlands erfolgreichste Kunstfliegerin gewesen zu sein. Melli Beese erwarb als Erste in ihrem Heimatland eine Pilotenlizenz. Die legendäre Elly Beinhorn überflog als erste Frau der Welt alle Erdteile.
Luise Hoffmann tat sich als erste deutsche Einfliegerin hervor, Käthe Paulus als erste deutsche Luftschifferin, Thea Rasche („The Flying Fräulein“) als erste deutsche Kunstfliegerin, Wilhelmine Reichard als erste deutsche Ballonfahrerin, Beate Uhse, geborene Köstlin, als erste deutsche Stuntpilotin.
Hanna Reitsch gilt sogar als Pilotin der Weltklasse. Sie stellte mehr als 40 Rekorde aller Klassen und Flugzeugtypen auf, wurde der erste weibliche Flugkapitän, flog als erste Frau einen Hubschrauber und unternahm den ersten Hubschrauberflug in einer Halle.
Im Kapitel „Weitere Königinnen der Lüfte“ findet man 42 Kurzbiografien in Stichworten von Andrea Amberge über Elisabeth Hartmann, Angelika Machinek, Elfriede Riotte, Lola Schröter, Antonie Straßmann, Mutz Trense, Margit Waltz, Iris Wittig und anderen Luftfahrt-Pionierinnen bis zu Liesel Zangemeister.
Herausragende Leistungen von Fliegerinnen, Ballonfahrerinnen, Luftschifferinnen, Fallschirmspringerinnen und Astronautinnen werden im Kapitel „Daten und Fakten“ aufgelistet. Es beginnt mit dem ersten Flug einer Frau im Heißluftballon und endet mit dem ersten Flug einer Weltraumtouristin.
Wie ein „roter Faden“ zieht sich durch das Taschenbuch, wie schwer es früher oft Frauen von Männern gemacht wurde, das Fliegen zu lernen und in der Luftfahrt Fuß zu fassen. Bis in jüngste Zeit hatten Pilotinnen weltweit unter Vorurteilen zu leiden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Dank
- Liesel Bach
- Melli Beese
- Elly Beinhorn
- Vera von Bissing
- Marga von Etzdorf
- Margret Fusbahn und Ludwig Werner Fusbahn
- Luise Hoffmann
- Thea Knorr
- Rita Maiburg
- Käthe Paulus
- Thea Rasche
- Wilhelmine Reichard
- Hanna Reitsch
- Christl-Marie Schultes
- Lisl Schwab
- Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg
- Sabine Trube
- Beate Uhse
- Weitere „Königinnen der Lüfte“
- Daten und Fakten
- Der Autor
- Literatur
- Bildquellen
- E-Books über „Königinnnen der Lüfte“
- Bücher von Ernst Probst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch "Königinnen der Lüfte in Deutschland" von Ernst Probst beleuchtet die Lebensgeschichten von Frauen, die in der Geschichte der Luftfahrt eine bedeutende Rolle spielten. Der Autor zeichnet mit Biografien berühmter Fliegerinnen, Ballonfahrerinnen, Luftschifferinnen und Fallschirmspringerinnen ein umfassendes Bild der weiblichen Pionierinnen in der deutschen Luftfahrt.
- Frauen in der Luftfahrtgeschichte
- Pionierinnen in der Luftfahrt
- Biografische Portraits
- Entwicklung der Luftfahrt in Deutschland
- Frauen und Technik
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einem Vorwort und einem Dank. Die folgenden Kapitel widmen sich jeweils einer prominenten Frau aus der deutschen Luftfahrt. Diese Biografien präsentieren die Lebenswege, Erfolge und Herausforderungen der einzelnen Frauen im Kontext der jeweiligen Epoche. Sie stellen die individuellen Beweggründe, Motivationen und persönlichen Leistungen der „Königinnen der Lüfte" in den Vordergrund. Dabei werden nicht nur ihre Flugkünste, sondern auch ihre Rolle in der Gesellschaft und ihre Herausforderungen als Frauen in einem männlich dominierten Bereich beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe des Buches sind: Fliegerinnen, Ballonfahrerinnen, Luftschifferinnen, Fallschirmspringerinnen, Luftfahrtgeschichte, Pionierinnen, Biografien, Frauen und Technik, Deutschland.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2010, Königinnen der Lüfte in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155107