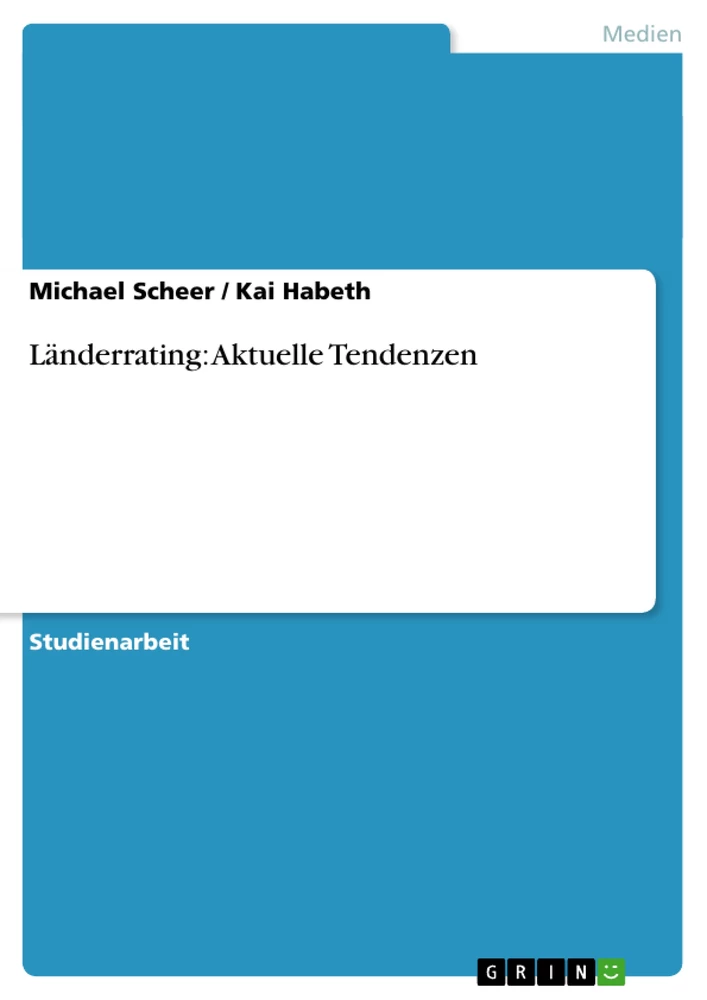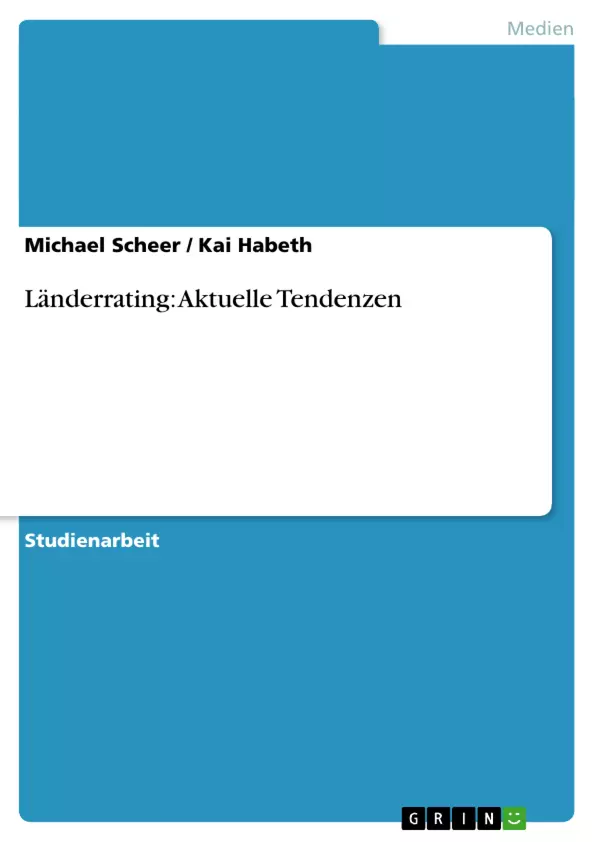Seit vielen Jahren prägt der Begriff „Globalisierung“ die Berichterstattung in den Medien, wenn es um die Annäherung von Nationalstaaten, Regionen und einzelnen Unternehmen in Wirtschaftsfragen geht. Globalisierung wird als Prozeß verstanden, durch den Märkte und Produktionen in den verschiedenen Ländern immer mehr voneinander abhängig werden. Dies heißt nichts anderes, als daß sich die Ökonomien der einzelnen Länder in einem direkten Wettbewerb zueinander befinden. Globalisierung bedeutet für den Staat, daß er wirtschaftliche Aktivitäten immer weniger steuern kann. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben: Erstens die Schaffung eines günstigen Umfeldes für die Wirtschaft und zweitens die Imagepflege im Ausland, um potentielle Investoren anzulocken. Die Vollendung des europäischen Binnenmarktes mit der Einführung einer gemeinsamen Währung und die Schaffung von multinationalen Unternehmen wie DaimlerChrysler sollen hierfür als bedeutende Beispiele dienen. Die Globalisierung geht jedoch weit über rein wirtschaftliche Aspekte hinaus. Die Annäherung der Wirtschaftssysteme bedingt, dass kulturelle Schranken verschwinden und das Konzept des isolierten Nationalstaates in Zukunft immer mehr an Bedeutung verlieren wird. Für die Menschen aller Nationen bedeutet dies eine dramatische Veränderung bisheriger Strukturen. Globalisierung ist vor allem die Schaffung einer bisher nie dagewesenen Transparenz in allen Bereichen des Lebens. Nicht nur, daß Unternehmen weltweit um Absatzmöglichkeiten und Marktanteile für ihre Produkte konkurrieren, auch Ausbildungssysteme, Staaten und Regionen werben weltweit um die besten Studenten und Arbeitskräfte, um im globalen Wettbewerb nicht den Anschluß zu verlieren. Deshalb fällt der Imagepolitik in der gegenwärtigen Situation eine entscheidende Rolle zu. Länder, Regionen oder auch Unternehmen müssen Werbung in eigener Sache betreiben. Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, wie mit Hilfe von Rating-Verfahren eine global vergleichbare „Benotung“ von Finanzinstrumenten, Unternehmen, Ländern und Regionen geschaffen wurde, um Investoren die Möglichkeit des objektiven Vergleichs von unterschiedlichen Anlageformen zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Definition des Begriffes Länderrisiko
- Definition des Begriffs Rating
- Die prozessuale Komponente des Rating
- Das beantragte und das nicht beantragte Ratingverfahren
- Die taxonomische Komponente des Rating
- Die prozessuale Komponente des Rating
- Die Entstehung der führenden Ratingagenturen
- Relevanz des Rating
- Volkswirtschaftsrating unter weltpolitischen Gesichtspunkten
- Volkswirtschaftsrating unter finanzmarktpolitischen Aspekten
- Volkswirtschaftsrating unter sozio-politischen Aspekten
- Volkswirtschaftsrating unter wettbewerbspolitischen Aspekten
- Die Qualität des Rating
- Kritikpunkte am Rating
- Ansätze zur Objektivierung des Ratingverfahrens
- Informationspolitik der Ratingagenturen
- Informationsquellen der Rating-Agenturen
- Publikationen der Rating-Agenturen
- Die Entgeltpolitik der Rating-Agenturen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte des Länderrisikos und des Ratings im Kontext der Globalisierung. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Ratingverfahren eine global vergleichbare Bewertung von Ländern und Regionen ermöglichen und Investoren somit einen objektiven Vergleich verschiedener Anlageformen bieten. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Relevanz von Ratingagenturen und analysiert kritische Punkte des Systems.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Länderrisiko und Rating
- Entstehung und Entwicklung führender Ratingagenturen
- Relevanz von Länderratings aus verschiedenen Perspektiven (weltpolitisch, finanzmarktpolitisch, sozio-politisch, wettbewerbspolitisch)
- Qualität und Kritikpunkte des Ratingverfahrens
- Ansätze zur Verbesserung der Objektivität des Ratingverfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Länderrating ein und verdeutlicht dessen Bedeutung im Kontext der Globalisierung und des zunehmenden Wettbewerbs zwischen Staaten und Regionen um Investitionen. Sie betont die Notwendigkeit objektiver Vergleichsmöglichkeiten für Investoren und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Länderrisiko“ und „Rating“. Es hebt die fehlende einheitliche Definition von Länderrisiko in der Literatur hervor und beschreibt es als das Risiko, dass ein Staat seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, begründet durch politische, soziale und wirtschaftliche Faktoren. Der Begriff „Rating“ wird in seine prozessuale und taxonomische Komponente zerlegt, um die Vorgehensweise des Ratingverfahrens zu verdeutlichen.
Die Entstehung der führenden Ratingagenturen: Dieses Kapitel gibt einen kurzen historischen Überblick über die Entstehung der wichtigsten Ratingagenturen. Es beleuchtet die Entwicklung und den Aufstieg dieser Institutionen als zentrale Akteure im internationalen Finanzmarkt.
Relevanz des Rating: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung des Ratings aus verschiedenen Perspektiven. Es untersucht die Relevanz für Volkswirtschaften unter weltpolitischen, finanzmarktpolitischen, sozio-politischen und wettbewerbspolitischen Aspekten. Die Auswirkungen des Ratings auf politische Entscheidungsprozesse und Marktmechanismen werden beleuchtet.
Die Qualität des Rating: Dieses Kapitel befasst sich mit der messbaren Qualität des Ratings und dessen Grenzen. Es analysiert die Faktoren, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Ratings beeinflussen und diskutiert die Herausforderungen bei der Bewertung von Länder Risiken.
Kritikpunkte am Rating: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Kritikpunkte am Ratingverfahren dargelegt. Es analysiert die potenziellen Schwächen und Mängel des Systems und diskutiert dessen Auswirkungen auf Märkte und Volkswirtschaften.
Ansätze zur Objektivierung des Ratingverfahrens: Dieses Kapitel präsentiert Ansätze zur Verbesserung der Objektivität und Transparenz des Ratingverfahrens. Es diskutiert neue Methoden und Techniken, die den hohen Subjektivitätsfaktor reduzieren sollen und die Zuverlässigkeit der Bewertungen erhöhen können.
Informationspolitik der Ratingagenturen: Der Abschnitt beschreibt die Informationsquellen, Publikationen und die Entgeltpolitik der Ratingagenturen. Die Transparenz des Prozesses wird untersucht, sowie der Einfluss der Auftraggeber auf die Agenturen.
Schlüsselwörter
Länderrating, Länderrisiko, Ratingagenturen, Globalisierung, Volkswirtschaft, Finanzmärkte, Investitionen, Objektivität, Transparenz, Kritik, Methoden, Informationspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Länderrating
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Thema Länderrating?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Länderrating. Sie beinhaltet eine Einleitung, Begriffsdefinitionen (Länderrisiko und Rating), die Entstehung führender Ratingagenturen, die Relevanz des Ratings aus verschiedenen Perspektiven (weltpolitisch, finanzmarktpolitisch, sozio-politisch und wettbewerbspolitisch), eine Analyse der Qualität und Kritikpunkte des Ratingverfahrens, Ansätze zur Objektivierung des Verfahrens und abschließend die Informationspolitik der Ratingagenturen (Informationsquellen, Publikationen und Entgeltpolitik).
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert die zentralen Begriffe „Länderrisiko“ und „Rating“. Länderrisiko wird als das Risiko beschrieben, dass ein Staat seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, aufgrund politischer, sozialer und wirtschaftlicher Faktoren. Der Begriff „Rating“ wird in seine prozessuale (das Verfahren selbst) und taxonomische (die Kategorisierung der Ergebnisse) Komponente unterteilt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Einleitung, Begriffsdefinitionen, der Entstehung der Ratingagenturen, der Relevanz des Ratings aus verschiedenen Perspektiven, der Qualität und Kritik des Ratings, Ansätzen zur Objektivierung und der Informationspolitik der Agenturen befassen. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Perspektiven werden bei der Analyse der Relevanz des Ratings betrachtet?
Die Relevanz des Länderratings wird aus vier Perspektiven analysiert: weltpolitisch, finanzmarktpolitisch, sozio-politisch und wettbewerbspolitisch. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Ratings auf politische Entscheidungsprozesse und Marktmechanismen.
Welche Kritikpunkte am Ratingverfahren werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet die potenziellen Schwächen und Mängel des Ratingverfahrens und diskutiert deren Auswirkungen auf Märkte und Volkswirtschaften. Konkrete Kritikpunkte werden detailliert im entsprechenden Kapitel dargelegt.
Welche Ansätze zur Verbesserung der Objektivität des Ratingverfahrens werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Ansätze zur Verbesserung der Objektivität und Transparenz des Ratingverfahrens. Es werden neue Methoden und Techniken diskutiert, die den Subjektivitätsfaktor reduzieren und die Zuverlässigkeit der Bewertungen erhöhen sollen.
Welche Informationen werden über die Informationspolitik der Ratingagenturen gegeben?
Dieser Abschnitt beschreibt die Informationsquellen, Publikationen und die Entgeltpolitik der Ratingagenturen. Die Transparenz des Prozesses und der Einfluss der Auftraggeber auf die Agenturen werden untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Länderrating, Länderrisiko, Ratingagenturen, Globalisierung, Volkswirtschaft, Finanzmärkte, Investitionen, Objektivität, Transparenz, Kritik, Methoden, Informationspolitik.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Michael Scheer (Autor:in), Kai Habeth (Autor:in), 2001, Länderrating: Aktuelle Tendenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15516