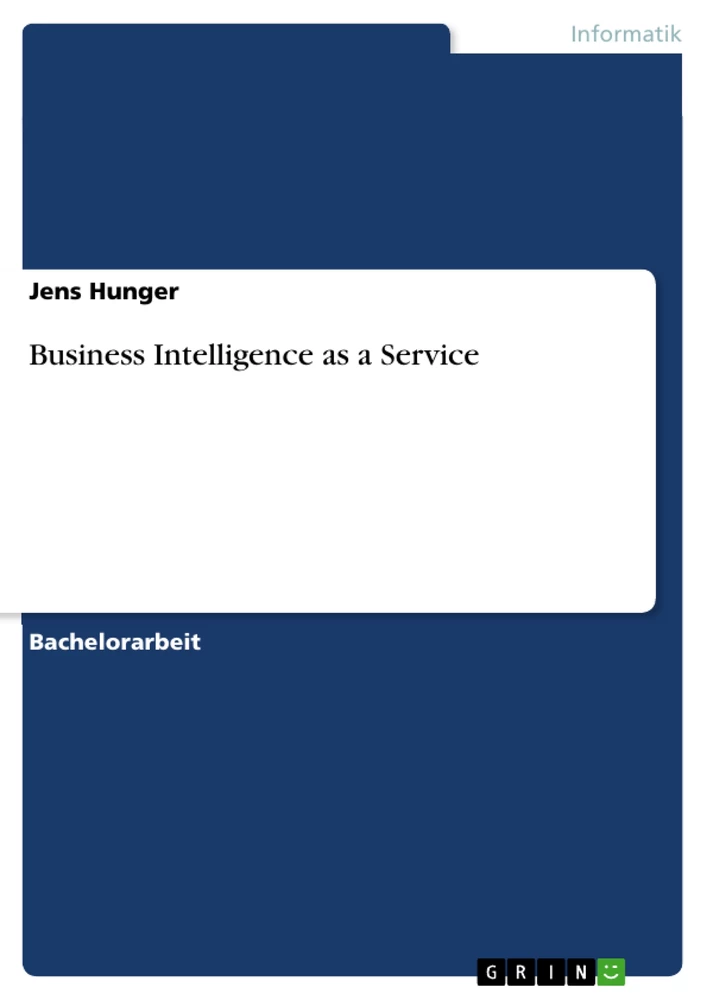Mietmodelle für die Nutzung gehosteter Software, die mit Schlagworten wie On-Demand, Cloud Computing, SaaS oder ASP vermarktet werden, sind in den letzten Jahren in vielen Bereichen des Softwaremarktes auf dem Vormarsch. Angetrieben durch die Wirtschaftskrise versprechen die Marketingaussagen von SaaS-Anbietern besonders mittelständischen Unternehmen den kostengünstigen Zugang zu komplexen Geschäftsanwendungen, ohne das krisenbedingt eingeschränkte Investitionsbudget zu belasten.
Nachdem sich SaaS-Lösungen im Bereich des Customer Relationship Managements bereits erfolgreich etablieren konnten, und auch ERP-Systeme den Weg in die Cloud beschreiten, gewinnt dieser Bereich auch für den Business Intelligence-Markt an Bedeutung.
Klassisch werden Business Intelligence Produkte innerhalb des unternehmenseigenen Netzwerks (on-premise) betrieben, um die Anbindung an die in der Regel im gleichen Umfeld betriebenen Vorsysteme zu erleichtern.
Die wachsende Zahl der Angebote für das Hosting der klassischen Datenquellen für BI-Lösungen wie zum Beispiel ERP-Systeme oder Systeme für Finanzbuchhaltung auf firmenexternen Systemen legt den Gedanken nahe, auch die Analyse dieser Daten auszulagern. Besonders für die Zielgruppe der mittelständischen Unternehmen, die über ein begrenztes Budget für den Aufbau und Erhalt einer eigenen BI-Infrastruktur verfügen, sind in letzter Zeit viele gehostete Lösungen auf den Markt gekommen, die für den BI-Markt an Bedeutung gewinnen.
Das Software-as-a-Service-Modell verspricht Einsparungen im Bereich der IT-Investitionen und operativen Kosten bei kurzen Vertragslaufzeiten. Diese Bachelorarbeit soll die Frage klären, ob der Übertrag dieses Konzept auf Business Intelligence das Potential hat, herkömmliche on-premise-Lösungen zu ersetzen, und für welche Einsatzgebiete ein solches Konzept in Frage kommt.
Diese Arbeit soll einen Überblick über die am Markt befindlichen Hosting-Modelle und deren Abgrenzung zueinander bieten. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Lösungen im Business Intelligence Bereich sollen vor dem Hintergrund möglicher Einsatzgebiete im Bezug auf Unternehmensgröße und Branche kritisch bewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Motivation
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Herleitung der Fragestellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Grundlagen
- Software as a Service
- Entwicklung des SaaS
- Vergleich zwischen ASP und SaaS
- SaaS als Cloud Service
- Business Intelligence
- Business Intelligence as a Service
- Unternehmensgröße
- Software as a Service
- Marktbetrachtung
- Markt SaaS
- Teilmarkt BlaaS
- Bewertung des SaaS-Ansatzes
- Vor- und Nachteile SaaS
- Herausforderungen für Anbieter
- Bewertung BlaaS
- Bewertung aus Kundensicht
- Bewertung aus Anbietersicht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Business Intelligence as a Service (BaaS) und dessen Anwendbarkeit in Unternehmen. Die Arbeit analysiert die Grundlagen von SaaS, die Besonderheiten von BaaS und die Marktbedingungen. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile von BaaS aus Kunden- und Anbietersicht zu bewerten und Herausforderungen aufzuzeigen.
- Software as a Service (SaaS) und dessen Entwicklung
- Business Intelligence (BI) und die Integration in SaaS-Modelle
- Marktbedingungen und Wettbewerbslandschaft für BaaS
- Vorteile und Nachteile von BaaS aus Kundensicht
- Herausforderungen für Anbieter von BaaS
Zusammenfassung der Kapitel
Motivation: Die Einleitung beschreibt die Motivation des Autors, sich mit dem Thema Business Intelligence as a Service auseinanderzusetzen. Sie legt den Grundstein für die gesamte Arbeit.
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext und die Problemstellung der Arbeit vor. Sie definiert den Untersuchungsgegenstand, beschreibt die Ausgangssituation und leitet die Forschungsfrage ab. Die Zielsetzung und die Vorgehensweise werden ebenfalls erläutert.
Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Business Intelligence as a Service. Es behandelt Software as a Service (SaaS), dessen Entwicklung und den Vergleich zu Application Service Providing (ASP). Zusätzlich werden Business Intelligence und dessen Implementierung als Service erläutert, sowie ein Einblick in die Bedeutung der Unternehmensgröße gegeben.
Marktbetrachtung: Dieses Kapitel analysiert den Markt für SaaS und den Teilmarkt für Business Intelligence as a Service (BaaS). Es beschreibt die Marktlage und identifiziert relevante Akteure und Trends.
Bewertung des SaaS-Ansatzes: In diesem Kapitel werden die Vor- und Nachteile des SaaS-Ansatzes, insbesondere im Hinblick auf BaaS, umfassend diskutiert. Es wird eine Bewertung aus der Perspektive von Kunden und Anbietern gegeben, inklusive der Herausforderungen, denen sich die Anbieter stellen müssen.
Schlüsselwörter
Business Intelligence as a Service (BaaS), Software as a Service (SaaS), Cloud Computing, Business Intelligence (BI), Marktforschung, Wettbewerbsanalyse, Vorteile, Nachteile, Herausforderungen, Kundenperspektive, Anbieterperspektive, Unternehmensgröße.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Business Intelligence as a Service (BaaS)
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht Business Intelligence as a Service (BaaS) und dessen Anwendbarkeit in Unternehmen. Sie analysiert die Grundlagen von SaaS, die Besonderheiten von BaaS und die Marktbedingungen. Ziel ist die Bewertung der Vor- und Nachteile von BaaS aus Kunden- und Anbietersicht sowie die Aufzeigen von Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Software as a Service (SaaS) und dessen Entwicklung, Business Intelligence (BI) und deren Integration in SaaS-Modelle, die Marktbedingungen und Wettbewerbslandschaft für BaaS, die Vorteile und Nachteile von BaaS aus Kundensicht und die Herausforderungen für Anbieter von BaaS.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Motivation, Einleitung (mit Ausgangslage, Fragestellung, Zielsetzung und Vorgehensweise), Grundlagen (SaaS, ASP, SaaS als Cloud Service, BI, BIaaS, Unternehmensgröße), Marktbetrachtung (Markt SaaS, Teilmarkt BaaS), Bewertung des SaaS-Ansatzes (Vor- und Nachteile SaaS, Herausforderungen für Anbieter, Bewertung BaaS aus Kunden- und Anbietersicht) und Fazit.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert eine umfassende Bewertung von BaaS, indem sie die Vor- und Nachteile aus Kunden- und Anbietersicht gegenüberstellt und die Herausforderungen für Anbieter beleuchtet. Sie analysiert den Markt für BaaS und dessen Einbettung in den größeren Kontext von SaaS und Cloud Computing.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Business Intelligence as a Service (BaaS), Software as a Service (SaaS), Cloud Computing, Business Intelligence (BI), Marktforschung, Wettbewerbsanalyse, Vorteile, Nachteile, Herausforderungen, Kundenperspektive, Anbieterperspektive, Unternehmensgröße.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturrecherche und eine Analyse der Marktbedingungen. Die genaue Methodik wird im Kapitel "Vorgehensweise" detailliert beschrieben (diese Information ist im gegebenen Preview nicht explizit enthalten).
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit SaaS, BaaS, Cloud Computing und Business Intelligence beschäftigen, insbesondere für Studierende, Unternehmen, die SaaS-Lösungen implementieren oder anbieten, und Marktforscher im IT-Bereich.
Wo finde ich die vollständige Bachelorarbeit?
Die vollständige Bachelorarbeit ist nicht im gegebenen Preview enthalten. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit sind nicht verfügbar.
- Arbeit zitieren
- Jens Hunger (Autor:in), 2010, Business Intelligence as a Service, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155190