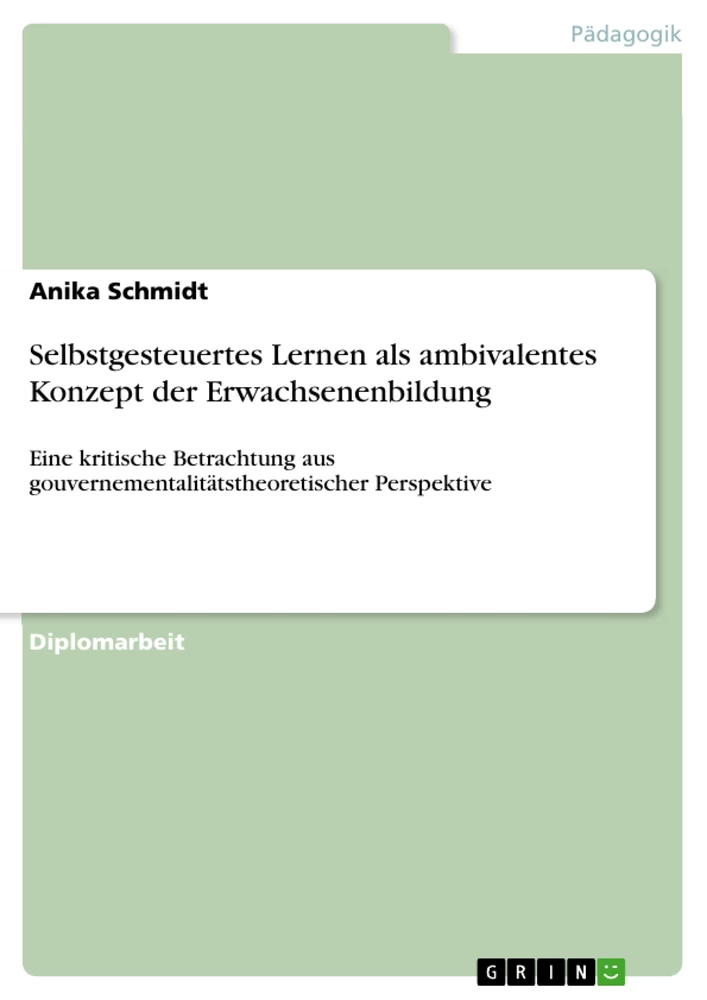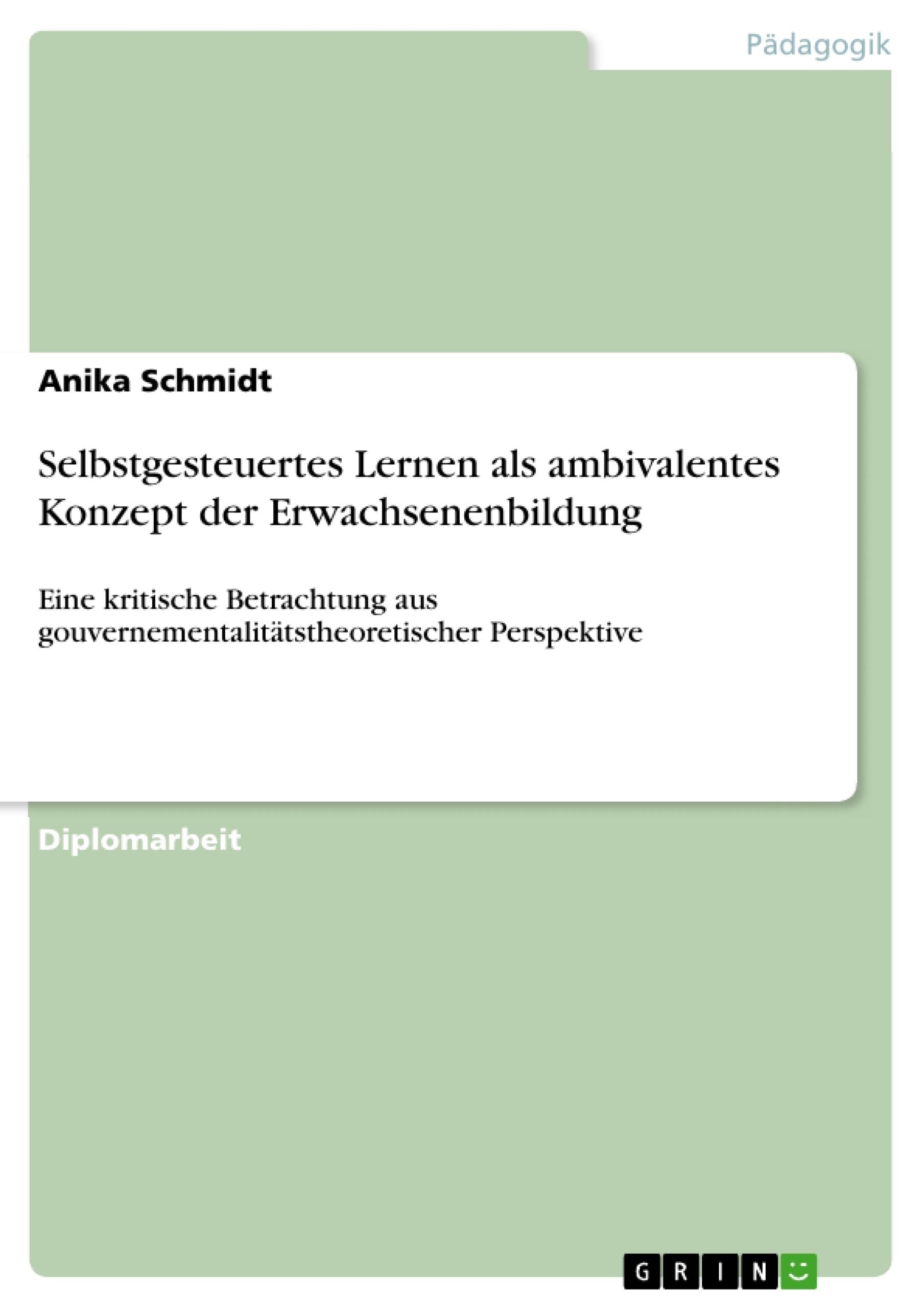Individuen sind zunehmend aufgefordert, ihre persönlichen Kompetenzen eigenverantwortlich und kontinuierlich zu aktualisieren und zu erweitern. Lebenslanges Selbstgesteuertes Lernen – darin sind sich Politik, Bildung und Wirtschaft einig – etabliert sich zur gesellschaftlichen und individuellen Notwendigkeit. Mit der Ausdehnung des Lernbegriffs in die private Verantwortung des Individuums, markiert Selbstgesteuertes Lernen jedoch eine bildungspolitische Programmatik, die zu tiefgreifenden Veränderungen in der Erwachsenenbildung führt. Die erwachsenenpädagogische Fundierung des Konzepts ist vor allem auf den systemisch-konstruktivistischen Paradigmenwechsel zurückzuführen, mit dem die Aneignung gegenüber den Kategorien des Lehrens oder Vermittelns in der didaktischen Theorieentwicklung an Bedeutung gewonnen hat. Problematisch erscheint allerdings, dass damit ein grundlegender Legitimationsverlust didaktischen Handelns sowie des Selbst- und Aufgabenverständnisses der Lehrenden einhergeht, da dieser Ansatz pädagogische Interventionen prinzipiell infrage stellt und didaktisches Handeln als zentraler Aspekt erwachsenenpädagogischer Professionalität in einem unauflösbaren Handlungswiderspruch mündet. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich, bei schwindender disziplinärer Stabilität, ein wachsender Problemdruck für die Wissenschaftsdisziplin der Erwachsenenbildung ab. Die aufgespannte Problematik wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit aus der poststrukturalistisch geprägten Theorieperspektive der Gouvernementalität im Anschluss an Michel Foucault reflektiert. Das Konzept der Gouvernementalität rückt nicht nur die mit dem pädagogischen Selbstverständnis ‚scheinbar‘ unvereinbare Gegensätzlichkeit von Selbstbestimmung und Fremdsteuerung in ein anderes Licht, es eröffnet zudem eine differenzierte Theorieperspektive, die eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Begründungslogiken Selbstgesteuerten Lernens und der damit verbundenen spezifischen gesellschaftlichen Funktion der Erwachsenenbildung ermöglicht. Es wird gezeigt, wie sich unterschiedlichen theoretischen Zugänge (Systemtheorie und Konstruktivismus, Poststrukturalismus und Bildungstheorie) ergänzend in die wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung um Selbstgesteuertes Lernen einordnen und begründen lassen. Mit dem Konzept des Selbstsorgenden Lernens wird ein erwachsenenpädagogischer Ansatz zum Selbstgesteuerten Lernen vorgestellt, der beide Perspektiven in die didaktische Konkretisierung einbezieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstgesteuertes Lernen als erwachsenenpädagogisches Paradigma
- Lebenslanges Selbstgesteuertes Lernen
- Zur Problematik der begrifflichen Bestimmung
- Aktueller Diskussions- und Forschungsstand
- Systemisch-konstruktivistische Grundlagen
- Bedingungen Selbstgesteuerten Lernens
- Selbststeuerung als didaktische Dimension
- Selbststeuerung als gesellschaftspolitische Dimension
- Definitorische Eingrenzung
- Zusammenfassung
- Selbstgesteuertes Lernen im fachwissenschaftlichen Diskurs
- Wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung
- Bildung als Orientierungskategorie didaktischen Handelns
- Grenzen konstruktivistischen Erklärungspotentials
- Zusammenfassung
- Selbstgesteuertes Lernen aus gouvernementalitätstheoretischer Perspektive
- Zum Begriff der Gouvernementalität
- Genealogischer Zugang und gouvernementalitäts-theoretische Perspektive
- Das begriffliche Analyseinstrumentarium Foucaults
- Die Geschichte der Gouvernementalität
- Weiterbildung und Selbstgesteuertes Lernen im Kontext der Gouvernementalität
- Pädagogik und Macht
- Kritische Betrachtung des erwachsenenpädagogischen Diskurses um Selbstgesteuertes Lernen
- Zusammenfassung
- Konsequenzen für das erwachsenenpädagogische Professionalitätsverständnis
- Bildungstheoretische Reflexion im Anschluss an Foucault
- Selbstsorge als berufsethischer Anspruch
- Didaktische Konsequenzen am Beispiel Selbstsorgenden Lernens
- Veränderte didaktische Steuerungslogik
- Aufbau der Selbstlernarchitekturen
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der kritischen Betrachtung des Konzepts Selbstgesteuerten Lernens in der Erwachsenenbildung aus gouvernementalitätstheoretischer Perspektive. Ziel ist es, die Problematik des Konzepts aus zwei unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Perspektiven – Konstruktivismus und Poststrukturalismus – zu beleuchten und deren jeweilige Relevanz für die aktuelle erwachsenenpädagogische Situation zu analysieren.
- Die Herausforderungen des Konzepts Selbstgesteuerten Lernens im Kontext der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse.
- Die Bedeutung des Konstruktivismus und seiner Kritikpunkte im Hinblick auf die Förderung von Selbststeuerung im Lernprozess.
- Die Anwendung der Gouvernementalitätstheorie als ein analytisches Instrument zur Kritik der Machtwirkungen im Kontext von Selbstgesteuertem Lernen.
- Die Herausforderungen und Chancen für das erwachsenenpädagogische Professionalitätsverständnis im Spannungsfeld von Selbstbestimmung und Fremdsteuerung.
- Die Implikationen des Konzepts Selbstgesteuerten Lernens für die Gestaltung der Lernprozesse in der Erwachsenenbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Diskurs um Selbstgesteuertes Lernen in der Erwachsenenbildung in den Kontext des dynamischen Wandels gesellschaftlicher Verhältnisse stellt. Dabei wird die Bedeutung des Konzepts im Hinblick auf die individuelle und gesellschaftliche Notwendigkeit lebenslangen Lernens hervorgehoben.
Kapitel 2 widmet sich dem Konzept Selbstgesteuerten Lernens als erwachsenenpädagogischem Paradigma und beleuchtet verschiedene Aspekte, wie die Problematik der begrifflichen Bestimmung, den aktuellen Diskussions- und Forschungsstand, systemisch-konstruktivistische Grundlagen, Bedingungen Selbstgesteuerten Lernens, Selbststeuerung als didaktische Dimension und Selbststeuerung als gesellschaftspolitische Dimension. Zudem werden die definitorischen Grenzen des Konzepts sowie seine Bedeutung im Kontext der Erwachsenenbildung zusammengefasst.
Kapitel 3 beleuchtet das Konzept Selbstgesteuerten Lernens aus fachwissenschaftlicher Perspektive und analysiert die wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen, die Rolle von Bildung als Orientierungskategorie didaktischen Handelns sowie die Grenzen des konstruktivistischen Erklärungspotentials.
Kapitel 4 greift die gouvernementalitätstheoretische Perspektive auf und analysiert die Begriffsdefinition, den genealogischen Zugang, das begriffliche Analyseinstrumentarium Foucaults sowie die Geschichte der Gouvernementalität. Des Weiteren wird die Bedeutung von Weiterbildung und Selbstgesteuertem Lernen im Kontext der Gouvernementalität sowie die Beziehung zwischen Pädagogik und Macht beleuchtet. Abschließend wird eine kritische Betrachtung des erwachsenenpädagogischen Diskurses um Selbstgesteuertes Lernen aus gouvernementalitätstheoretischer Perspektive angeboten.
Kapitel 5 diskutiert die Konsequenzen für das erwachsenenpädagogische Professionalitätsverständnis im Anschluss an Foucault. Es werden die Konzepte der Bildungstheoretischen Reflexion und der Selbstsorge als berufsethischer Anspruch behandelt. Zudem werden didaktische Konsequenzen am Beispiel Selbstsorgenden Lernens, insbesondere die veränderte didaktische Steuerungslogik und der Aufbau der Selbstlernarchitekturen, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Selbstgesteuertes Lernen, Erwachsenenbildung, Gouvernementalität, Konstruktivismus, Poststrukturalismus, Bildungstheorie, Selbstsorge, Professionalitätsverständnis, Lebenslanges Lernen, Gesellschaftlicher Wandel, Pädagogik und Macht.
- Quote paper
- Anika Schmidt (Author), 2008, Selbstgesteuertes Lernen als ambivalentes Konzept der Erwachsenenbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155201