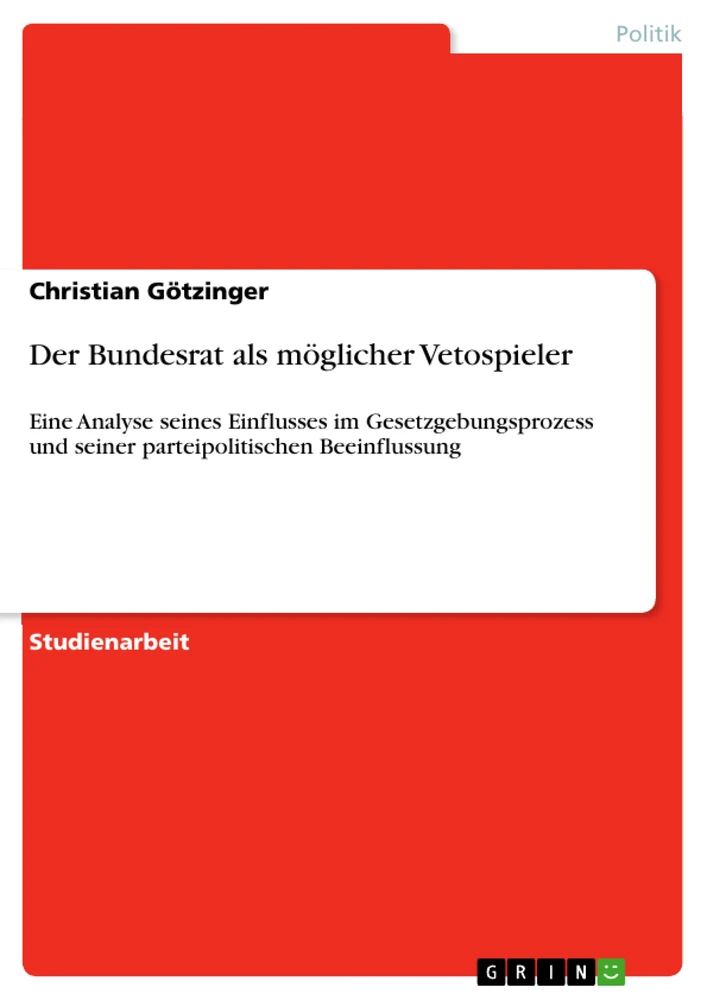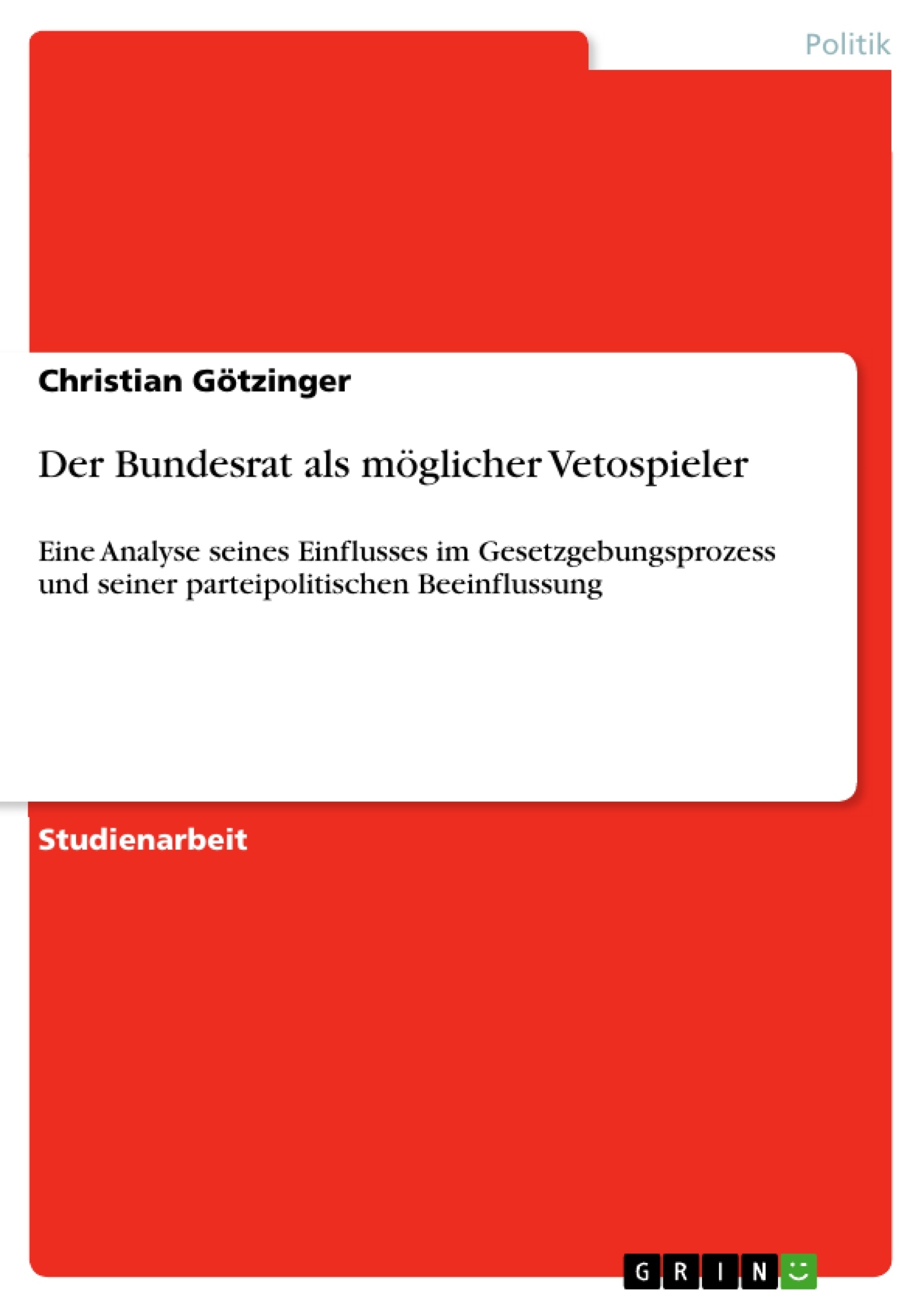Reformen braucht das Land – das ist wohl einer der beliebtesten Sätze der neuzeitlichen öffentlichen Politikdiskussionen und somit natürlich auch des Journalismus. Immer sobald etwas im Argen zu liegen scheint, oder der Wahlkampf begonnen hat, wird von allen Seiten förmlich danach gebrüllt. So verfasste zum Beispiel im Jahre 2003 Wolfgang Böhmer, der damalige und 2006 wiedergewählte Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, seine Regierungserklärung unter dieser prägnanten Überschrift . Es gibt viele Arten von Reformen, von denen in den letzten Jahren oft zu hören war; Gesundheitsreform, Hochschulreform, Rentenreform, Arbeitsreform und nicht zu vergessen die Steuerreform - nur um ein paar Beispiele zu nennen. Doch was genau ist eigentlich eine Reform? Der Duden erklärt eine Reform als „planmäßige Neuordnung, Umgestaltung, Verbesserung des Bestehenden (ohne Bruch mit den wesentlichen geistigen und kulturellen Grundlagen)“ (Duden 2007: 1369). Umgeformt in ein Staatensystem heißt das also kurz gefasst: Eine Reform braucht ein großes oder sogar mehrere Gesetze, denn nur mit Gesetzen lässt sich in einer funktionierenden Demokratie durch den Staatsapparat grundsätzlich etwas verändern. Diese Arbeit wird sich hauptsächlich mit der Mitwirkung des Bundesrates an der Gesetzgebung und seiner Beeinflussung durch das Parteiensystem befassen.
Der Bundesrat stellt in der Bundesrepublik Deutschland eines der fünf ständigen Verfassungsorgane dar. Genau wie die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundespräsident als Verfassungsorgane aktiv an der Gesetzgebung des Landes maßgeblich beteiligt sind, ist auch der Bundesrat eng in das komplizierte Geflecht des Gesetzgebungsverfahrens verflochten. Doch wie entscheidend ist die Rolle des Bundesrates? Kann er entscheidende Gesetze initiieren und kippen und vor allem: wenn ja, wann tut er es? Die hier untersuchte Frage lautet: In wie weit ist der Bundesrat beim Gesetzgebungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland ein möglicher Vetospieler und wann nutzt er seine damit gegebenen Kompetenzen? Die vorangestellte These dazu lautet: Der Bundesrat stellt einen möglichen Vetospieler im Gesetzgebungsprozess dar und wird sein Veto vor allem dann einlegen, wenn eine Mehrheit der Regierungsopposition im Bundesrat vertreten ist. Die Grundlage dieser These stellt das ständige Kontrahieren von Regierung und Opposition dar, welches sich, so hier angenommen, auch auf den Bundesrat wiederspiegelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Bundesrat ein Vetospieler?
- Definition eines Vetospielers
- Die Verteilung der Gesetzgebungskompetenz im Grundgesetz
- Zustimmungsgesetze und Einspruchsgesetze
- Verhältnis von Zustimmungs- und Einspruchsgesetz
- Parteipolitischer Einfluss im Bundesrat
- Die Opposition und der Bezug zum Bundesrat
- Wie der Bundesrat handelt, und wie er ursprünglich handeln sollte
- Der Prozess um das Zuwanderungsgesetz
- Quantitative Betrachtung von zwei Regierungsperioden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle des Bundesrates im Gesetzgebungsprozess der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere seiner möglichen Funktion als Vetospieler und dem Einfluss des Parteiensystems auf seine Entscheidungen. Sie untersucht, inwieweit der Bundesrat seine Kompetenzen nutzt, um Gesetzesvorhaben zu blockieren, und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
- Die Definition eines Vetospielers im Kontext des deutschen politischen Systems
- Die Kompetenzverteilung im Grundgesetz und die Rolle des Bundesrates in der Gesetzgebung
- Die Unterscheidung zwischen Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen und ihre Relevanz für die Entscheidungsmacht des Bundesrates
- Der Einfluss von Parteipolitik auf die Entscheidungen des Bundesrates
- Die Frage, ob und wann der Bundesrat sein Veto einlegt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Arbeit stellt die Relevanz von Reformen im politischen System dar und beleuchtet die Rolle des Bundesrates in der Gesetzgebung. Die These der Arbeit ist, dass der Bundesrat ein möglicher Vetospieler im Gesetzgebungsprozess ist und sein Veto vor allem dann einlegt, wenn eine Mehrheit der Regierungsopposition im Bundesrat vertreten ist.
- Der Bundesrat ein Vetospieler?: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Bundesrates als Vetospieler, indem es zunächst die Definition eines Vetospielers nach Tsebelis darlegt. Anschließend wird die Verteilung der Gesetzgebungskompetenz im Grundgesetz erläutert und auf die Unterscheidung zwischen Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen eingegangen.
- Parteipolitischer Einfluss im Bundesrat: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Parteipolitik auf die Entscheidungen des Bundesrates. Dabei wird die Opposition im Bundesrat und ihre Rolle im Gesetzgebungsprozess beleuchtet. Die Untersuchung umfasst auch den Prozess um das Zuwanderungsgesetz sowie eine quantitative Betrachtung von zwei Regierungsperioden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten des deutschen politischen Systems, wie z. B. Vetospieler, Gesetzgebung, Bundesrat, Parteipolitik, Zustimmungsgesetze, Einspruchsgesetze, Regierungsopposition und empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Bundesrat ein Vetospieler im Gesetzgebungsprozess?
Ja, der Bundesrat fungiert als Vetospieler, da er bei vielen Gesetzen (Zustimmungsgesetze) seine explizite Zustimmung geben muss, ohne die ein Gesetz nicht zustande kommen kann.
Was ist der Unterschied zwischen Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen?
Bei Zustimmungsgesetzen hat der Bundesrat ein echtes Veto-Recht. Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat zwar Einspruch erheben, dieser kann jedoch vom Bundestag mit einer entsprechenden Mehrheit überstimmt werden.
Welchen Einfluss hat das Parteiensystem auf den Bundesrat?
Der Bundesrat wird oft als Arena des Parteienwettbewerbs genutzt. Wenn die Opposition im Bundestag eine Mehrheit im Bundesrat hat, nutzt sie diese häufig, um Regierungsvorhaben zu blockieren oder Änderungen zu erzwingen.
Wann legt der Bundesrat typischerweise sein Veto ein?
Dies geschieht vor allem dann, wenn Gesetzesvorhaben die Interessen der Länder stark berühren oder wenn eine parteipolitische Konfrontation zwischen Bundesregierung und der Mehrheit der Länderregierungen vorliegt.
Was war das Problem beim Zuwanderungsgesetz?
Das Zuwanderungsgesetz ist ein klassisches Beispiel für die Blockademacht des Bundesrates und die juristischen Auseinandersetzungen über das korrekte Abstimmungsverfahren in diesem Verfassungsorgan.
- Citation du texte
- Christian Götzinger (Auteur), 2010, Der Bundesrat als möglicher Vetospieler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155273