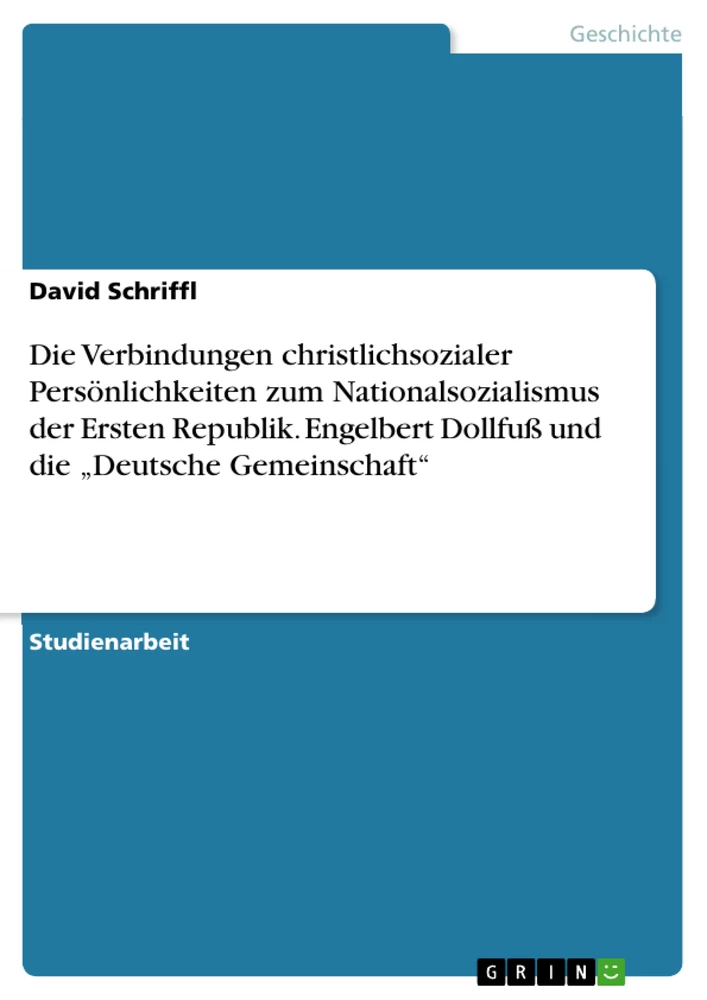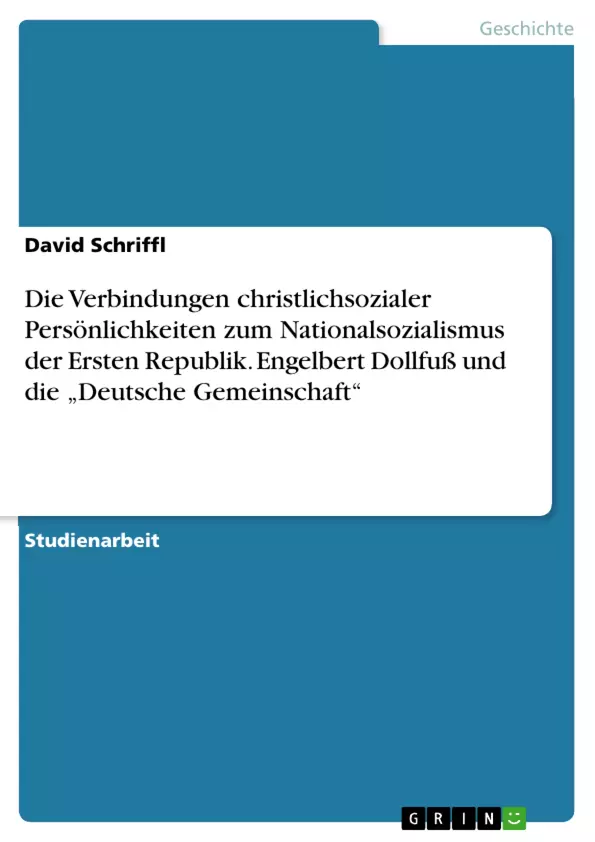Die Beschäftigung mit der Geschichte der Ersten Republik findet nicht nur in populärwissenschaftlichen Darstellungen immer noch unter Einhaltung gewisser „politischer Spielregeln“, die sich aus dem vielzitierten politischen „Nachkriegskonsens“ entwickelt haben, statt. Dabei werden Fakten und Zusammenhänge unterbelichtet oder vollständig ignoriert. Ein Beispiel hierfür ist die Rolle der Christlich-Sozialen Partei in ihrer offiziellen wie auch - durch
Einzelpersonen verkörperten - inoffiziellen Haltung in der Zwischenkriegszeit. Keineswegs sollen dabei andere politische Akteure dieser Zeit durch die Nicht- oder seltene
Erwähnung als unbeteiligt erscheinen oder sogar exkulpiert werden. Ebenso wie die Christlich-Sozialen haben auch die Sozialdemokraten und Kommunisten „weiße Flecken“ in ihrem politischen Selbstbild dieser Zeit, egal ob dies nun mit antisemitischen Strömungen, der NSDAP oder anderen Phänomenen zu tun hat. Sie sind aber nicht Gegenstand dieser Arbeit.
Ziel dieser Arbeit ist es nicht nur, vorhandene Beziehungen zwischen katholischen und völkisch-nationalen bzw. nationalsozialistischen Persönlichkeiten in der Ersten Republik aufzuzeigen,
sondern auch in Ansätzen nachzuvollziehen, warum diese Übereinstimmungen bestanden haben, und trotzdem nach 1945 eine vermeintlich klare Trennungslinie zwischen beiden Lagern gezogen werden konnte. Dabei wird die These verfolgt, daß diese Trennungslinie wenigstens streckenweise ein Konstrukt der Nachkriegszeit darstellt. Es soll nicht versucht werden, möglichst lückenlos „aufzuzeigen“ oder sogar „aufzudecken“, wer mit
wem entgegen der „Nachkriegshistoriographie der ÖVP“ regen Gesinnungsaustausch pflegte - das ist erstens schon über weite Strecken geschehen (siehe u.a. Wolfgang Rosars´ Dissertation über Seyss-Inquart in der Anschlußbewegung), und würde zweitens den Rahmen einer Seminararbeit sprengen - sondern es soll vielmehr verdeutlicht werden, daß gesellschaftspolitische Positionen wie
Antisemitismus oder Antiparlamentarismus in der Ersten Republik nicht nur von politischen Extremisten vertreten wurden. Ganz im Gegenteil herrschte weitgehende Einigkeit über solche politischen Fragen innerhalb eines weiten Spektrums von Gesinnungsgemeinschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Die Turnvereine als Bindeglied:
- ,,Nationale Persönlichkeiten“ und die Deutsche Gemeinschaft:
- Feldmarschalleutnant Bardolff:
- Arthur Seyss-Inquart:
- Engelbert Dollfuß:
- Knabenseminar Hollabrunn:
- Studienzeit in Wien:
- Erster Weltkrieg:
- Studium nach dem Krieg:
- Dollfuẞ und die DG:
- Andere,,katholisch-nationale“ Vereinigungen und Verhandlungen der Regierung mit den Nationalen:
- Kurt Schuschnigg:
- Christlichsoziale, Kirche und Nationalsozialismus:....
- Schlußwort:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Verbindungen zwischen christlichsozialen Persönlichkeiten und dem Nationalsozialismus in der Ersten Republik Österreichs. Dabei stehen besonders Engelbert Dollfuß und die „Deutsche Gemeinschaft“ im Fokus. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung dieser Verbindungen, die Rolle der Turnvereine als Bindeglied zwischen den beiden Lagern sowie die Bedeutung der Heimwehr in diesem Kontext. Darüber hinaus werden wichtige Persönlichkeiten wie Feldmarschalleutnant Bardolff und Arthur Seyss-Inquart beleuchtet, um die Dynamik dieser Verbindungen besser zu verstehen.
- Die Rolle der Christlich-Sozialen Partei und ihrer Repräsentanten in der Ersten Republik.
- Die Verbindungen zwischen christlichsozialen und nationalsozialistischen Persönlichkeiten, insbesondere die Bedeutung von Engelbert Dollfuß und der „Deutschen Gemeinschaft“
- Die Rolle von Turnvereinen und Heimwehren als Bindeglieder zwischen christlichsozialen und nationalsozialistischen Gruppierungen.
- Die Verbreitung von antisemitischen Strömungen in christlichsozialen Kreisen und ihre Verbindung zum Nationalsozialismus.
- Die Entwicklung und Bedeutung eines „ideologischen Vorkriegskonsenses“ in Österreich.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Untersuchung der Verbindungen zwischen christlichsozialen und nationalsozialistischen Akteuren in der Ersten Republik. Sie stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und hebt die Notwendigkeit einer differenzierteren Analyse der Rolle der Christlich-Sozialen Partei in dieser Zeit hervor.
- Die Turnvereine als Bindeglied: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Turnvereine als Mittler zwischen christlichsozialen und nationalsozialistischen Gruppierungen. Es zeigt, wie die Turnvereine, trotz ihrer offiziell „nicht-rassistischen“ Haltung, antisemitische Ansichten verbreiteten und einen Beitrag zur „Zerbröselung“ der christlichsozialen Ideologie leisteten.
- ,,Nationale Persönlichkeiten“ und die Deutsche Gemeinschaft: Dieses Kapitel stellt Feldmarschalleutnant Bardolff als Beispiel für die Kriegsgeneration des 1. Weltkriegs und deren politisches Denken vor. Es beleuchtet seine nationalistische Gesinnung und seine frühen Bemühungen um eine engere Verbindung zwischen Österreich und dem Deutschen Reich.
- Engelbert Dollfuß: Dieses Kapitel beleuchtet die politische Entwicklung Engelbert Dollfuß' von seinen frühen Jahren bis zu seiner Rolle als Bundeskanzler. Es untersucht seine Verbindungen zum Nationalsozialismus und seine Beziehungen zur „Deutschen Gemeinschaft“ sowie zu anderen „katholisch-nationalen“ Vereinigungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselwörter Christlichsoziale Partei, Nationalsozialismus, Deutsche Gemeinschaft, Engelbert Dollfuß, Turnvereine, Heimwehr, Antisemitismus und „ideologischer Vorkriegskonsens“. Sie befasst sich mit den Verbindungen und Überschneidungen zwischen diesen Begriffen und beleuchtet die politische Landschaft der Ersten Republik Österreichs.
Häufig gestellte Fragen
Welche Verbindung hatte Engelbert Dollfuß zur "Deutschen Gemeinschaft"?
Dollfuß war Mitglied der "Deutschen Gemeinschaft" (DG), einem Geheimbund, der als Netzwerk zwischen katholisch-konservativen und völkisch-nationalen Kreisen fungierte.
Welche Rolle spielten Turnvereine in der Ersten Republik Österreichs?
Turnvereine dienten oft als ideologisches Bindeglied, in dem antisemitisches und deutschnationales Gedankengut auch in christlichsoziale Kreise einsickerte.
War die Trennung zwischen Christlichsozialen und Nationalsozialisten immer klar?
Die Arbeit vertritt die These, dass die klare Trennungslinie teilweise ein Konstrukt der Nachkriegszeit ist und es in der Ersten Republik erhebliche personelle und ideologische Überschneidungen gab.
Wer war Arthur Seyss-Inquart in diesem Kontext?
Seyss-Inquart ist ein Beispiel für eine "nationale Persönlichkeit", die enge Kontakte zur Deutschen Gemeinschaft pflegte und später eine zentrale Rolle im Nationalsozialismus spielte.
Was ist der "ideologische Vorkriegskonsens"?
Damit sind weit verbreitete gesellschaftspolitische Positionen wie Antisemitismus und Antiparlamentarismus gemeint, die über Parteigrenzen hinweg konsensfähig waren.
- Quote paper
- David Schriffl (Author), 1998, Die Verbindungen christlichsozialer Persönlichkeiten zum Nationalsozialismus der Ersten Republik. Engelbert Dollfuß und die „Deutsche Gemeinschaft“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155290