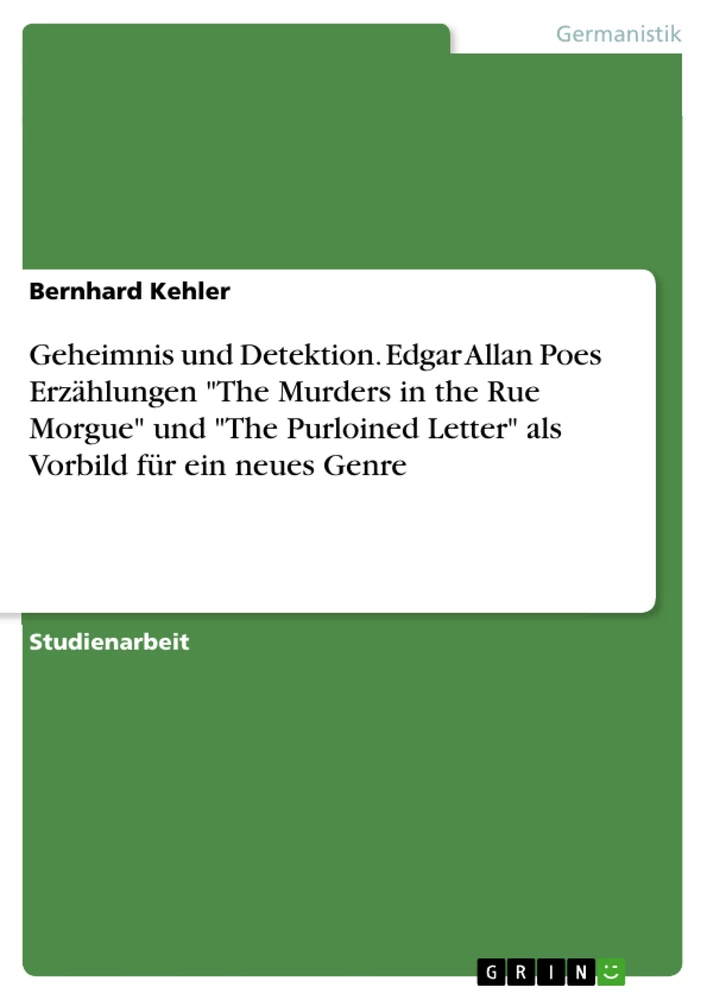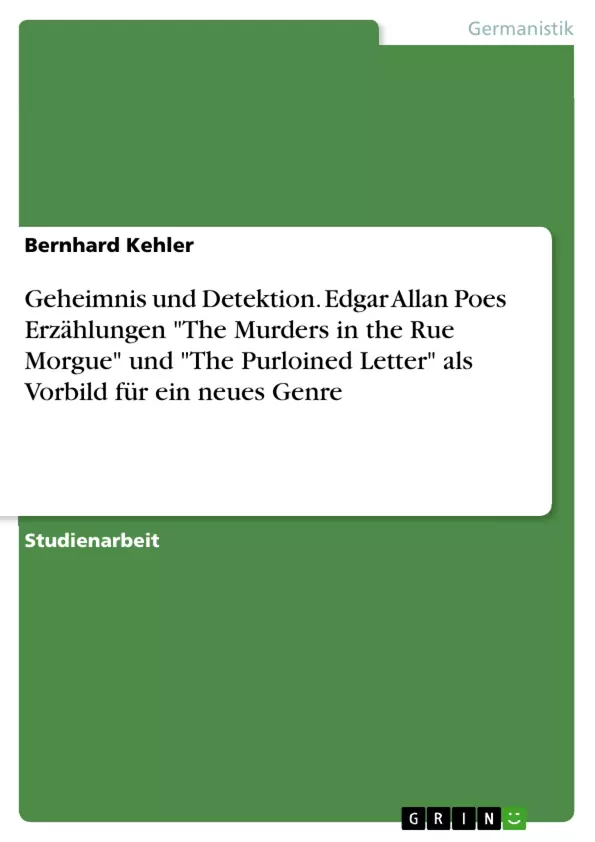Diese Hausarbeit hat zum Ziel E.A. Poes Detektivgeschichten „The Murders in the Rue Morgue“ und „The Purloined Letter“ zu untersuchen.
Zwei Fragen stehen dabei im Vordergrund, zum einen das Verfahren der Detektion zur Lösung eines Kriminalfalles und zum anderen die Konstruktion einer Detektivgeschichte als Short-Story. Für beide Aspekte erhebt Poe den Anspruch einer logischen Strenge, wie sie vornehmlich in der Mathematik vorzufinden ist.
Den ersten Aspekt, das Verfahren der Detektion, reflektiert er ausführlich innerhalb der beiden Erzählungen, während er den zweiten Aspekt, die Konstruktion einer Detektivgeschichte in seinen literaturtheoretischen Betrachtungen explizit erläutert.
Um das Wesen der „Detective Stories“ auszuloten, ist es erforderlich sowohl wissenschaftstheoretische als auch poetologisch-ästhetische Überlegungen einzubeziehen um daraus das sich mit Poe etablierende Genre zu erschließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 1.1 Erläuterung und Eingrenzung des Themas
- 2.0 Grundstruktur der beiden Erzählungen
- 2.1 Die Komposition der Detektivgeschichten
- 2.2 Die Rolle des Erzählers
- 2.3 Die Rolle des Auguste Dupin
- 2.4 Die Rolle des Präfekten
- 2.5 Die analytischen Betrachtungen innerhalb der Erzählungen zur Aufdeckung eines Verbrechens
- 3.0 Wirkungsabsicht und Rezeption der beiden Erzählungen
- 3.1. Welche Schlussfolgerungen lassen Poe`s Äußerungen als Lektor, Kritiker und Theoretiker in Bezug auf seine Wirkungsabsicht zu?
- 3.2 Welche Wirkungen haben die Erzählungen auf den Leser?
- 3.3 Welche Grundstrukturen finden sich in späteren Detektivgeschichten anderer Autoren wieder?
- 4.0 Schluss
- 4.1 Die Detektivgeschichte als Paradigma eines neuen Genres
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Edgar Allen Poes Detektivgeschichten „The Murders in the Rue Morgue“ und „The Purloined Letter“ und konzentriert sich auf zwei zentrale Aspekte: Das Verfahren der Detektion zur Lösung eines Kriminalfalls und die Konstruktion einer Detektivgeschichte als Short-Story. Poe strebt in beiden Bereichen eine logische Strenge an, die an mathematische Prinzipien angelehnt ist.
- Die Konstruktion der Detektivgeschichte als Short-Story und Poes Forderung nach kausaler Strenge
- Das Verfahren der Detektion, wie es in den beiden Erzählungen dargestellt wird, mit Fokus auf Logik und Analyse
- Die Rolle der mathematischen Denkmuster und der Einfluss des sich wandelnden Strafverfahrens auf die Gestaltung der Detektivgeschichte
- Die Analyse der Medienberichterstattung und die Rolle der Urbanisierung und Kriminalität in den Erzählungen
- Die Rolle des Erzählers und seine Beziehung zum Detektiv Auguste Dupin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert das Ziel der Hausarbeit, die Analyse von Poes Detektivgeschichten „The Murders in the Rue Morgue“ und „The Purloined Letter“. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Methode der Detektion und der Konstruktion einer Detektivgeschichte als Short-Story.
Im zweiten Kapitel wird die Grundstruktur der beiden Erzählungen untersucht. Zuerst wird Poes Konzept der kausalen Strenge in der Komposition einer Detektivgeschichte beleuchtet und in den Kontext literaturgeschichtlicher Entwicklungen, von Aristoteles bis hin zu Goethe und der Romantik, gestellt. Anschließend werden die narrativen Besonderheiten der Detektivgeschichten und ihr Zusammenhang mit sozialen Veränderungen der Moderne, wie dem Wandel im Strafverfahren, der Urbanisierung und dem aufkommenden Pressewesen, untersucht.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Wirkungsabsicht und Rezeption der beiden Erzählungen. Es werden Poes Äußerungen als Lektor, Kritiker und Theoretiker analysiert, um seine Intentionen in Bezug auf die Wirkungsabsicht zu verstehen. Weiterhin wird untersucht, wie die Erzählungen auf den Leser wirken und welche Grundstrukturen sich in späteren Detektivgeschichten anderer Autoren wiederfinden.
Schlüsselwörter
Diese Hausarbeit befasst sich mit zentralen Aspekten der Detektivgeschichten von Edgar Allen Poe, insbesondere mit den Themen „The Murders in the Rue Morgue“, „The Purloined Letter“, Detektionsverfahren, Short-Story, Kausalität, Logik, Mathematik, Urbanisierung, Kriminalität, Medienberichterstattung, Erzähler, Detektiv, Auguste Dupin, Präfekt, Analytische Betrachtungen, Wirkungsabsicht, Rezeption, Genre, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Werke von Edgar Allan Poe werden analysiert?
Die Arbeit untersucht die Detektivgeschichten „The Murders in the Rue Morgue“ (Der Doppelmord in der Rue Morgue) und „The Purloined Letter“ (Der entwendete Brief).
Was ist das Besondere an Poes Detektionsverfahren?
Poe erhebt den Anspruch einer logischen und analytischen Strenge, die stark an mathematische Denkmuster angelehnt ist.
Welche Rolle spielt die Figur Auguste Dupin?
C. Auguste Dupin ist der erste moderne Detektiv der Literaturgeschichte, der Fälle durch reine Logik und psychologische Analyse löst.
Wie hängen Urbanisierung und Detektivgeschichte zusammen?
Die Arbeit beleuchtet, wie soziale Veränderungen der Moderne, wie das Städtewachstum und die steigende Kriminalität, die Entstehung des Genres beeinflussten.
Gilt Poe als Begründer eines neuen Genres?
Ja, die Hausarbeit betrachtet seine Detektivgeschichten als Paradigma für ein neues literarisches Genre, das viele spätere Autoren prägte.
- Quote paper
- Bernhard Kehler (Author), 2009, Geheimnis und Detektion. Edgar Allan Poes Erzählungen "The Murders in the Rue Morgue" und "The Purloined Letter" als Vorbild für ein neues Genre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155300