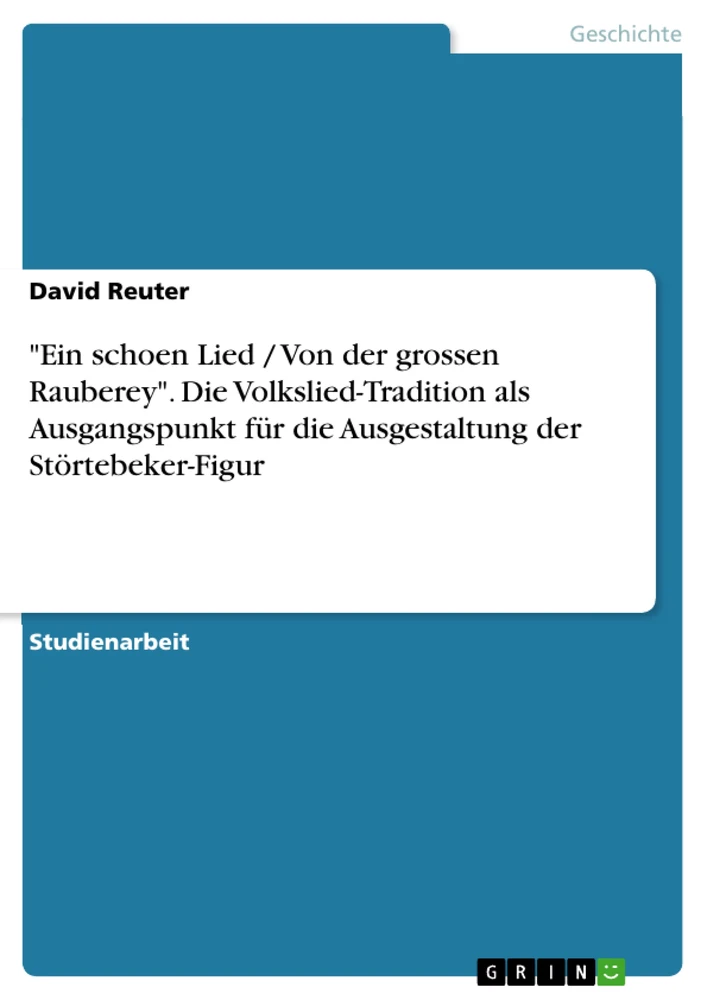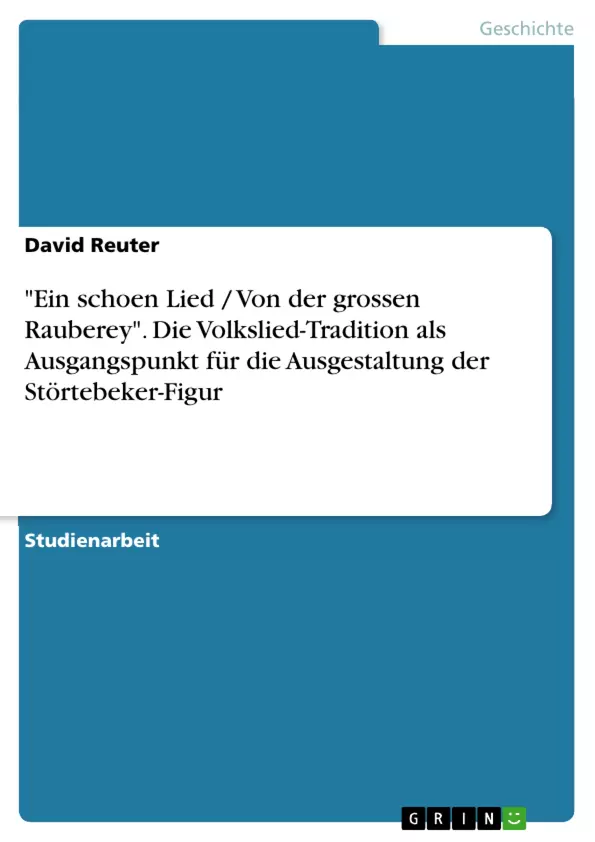Diese Seminararbeit mit dem Titel „Ein schön Lied von der großen Räuberei“: Die Volkslied-Tradition als Ausgangspunkt für die Ausgestaltung der Störtebeker-Figur widmet sich der Entwicklung des Störtebeker-Mythos in der deutschen Kulturgeschichte. Ausgangspunkt ist die Analyse eines frühen Volkslieds, das die Seeräuber Klaus Störtebeker und Gödeke Michels thematisiert. Dieses Lied wird als Träger mündlicher Tradition untersucht, mit Fokus auf der Verbindung zwischen historischer Überlieferung und legendarischer Ausschmückung.
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Quellenlage und Methodik, gefolgt von einer Untersuchung der historischen und sagenhaften Aspekte der Störtebeker-Figur. Es wird aufgezeigt, wie sich das Bild des Seeräubers im Laufe der Jahrhunderte wandelte und welche Rolle die Volkslied-Tradition dabei spielte. Volkslieder reflektieren nicht nur historische Ereignisse, sondern auch moralische und soziale Werte ihrer Zeit.
Ein zentraler Bestandteil ist die Interpretation des Liedes Ein schön Lied / Von der großen Rauberey / deß Störtenbechers / vnnd Goediche Michael. Die Arbeit untersucht sprachliche Merkmale und narrative Strukturen, die zur Heroisierung der Figuren beitragen. Dabei wird gezeigt, wie das Lied ein ambivalentes Bild von Störtebeker und seinen Gefährten zeichnet: sowohl unerschrockene Helden als auch gesetzlose Räuber. Diese Ambivalenz trägt zur Popularität der Figur bei und spiegelt gesellschaftliche Spannungen wider.
Die Arbeit beleuchtet zudem die Bedeutung der „Volkslied“-Gattung und ihre Entwicklung. Sie analysiert, wie dramatische und vereinfachende Elemente den Störtebeker-Mythos prägten. Volkslieder stärken kollektive Identität und vermitteln Werte, die in Krisenzeiten besonders relevant sind.
Im Fazit wird die historische Bedeutung des Mythos um Klaus Störtebeker und seine Relevanz für die Kulturgeschichte zusammengefasst. Es wird gezeigt, dass das Volkslied nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch ein Instrument kollektiver Erinnerung ist. Die Arbeit richtet sich an Leser*innen mit Interesse an Kulturgeschichte, Literaturwissenschaft und der Welt der Piraterie.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Zur Quellenwahl
- I.2 Fragestellung und Methode
- II. Die Störtebeker-Überlieferung im Allgemeinen
- II.1 Klaus Störtebeker als Sagenfigur
- II.2 Klaus Störtebeker als historische Figur
- III. Das Volkslied als Gattung
- IV. Quelleninterpretation: […] Lied / [...] deß Störtzenbechers / vnnd Goediche Michael
- IV.1 Äußere Quellenkritik
- IV.1.1 Textgrundlage
- IV.1.2 Verfasser*in, Entstehungsort und -zeit
- IV.2 Textinterpretation
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Volksliedern in der Gestaltung des Störtebeker-Mythos. Die Zielsetzung besteht darin, den Einfluss der Gattung Volkslied auf die Entwicklung und Verbreitung der Störtebeker-Sage zu analysieren. Dabei wird ein spezifisches Volkslied herangezogen und dessen textliche Eigenheiten im Hinblick auf die Mythenbildung untersucht.
- Die Entwicklung des Störtebeker-Mythos von der historischen Figur zur Legende.
- Die Rolle mündlicher Tradition und Volkslieder in der Verbreitung der Sage.
- Analyse eines spezifischen Volksliedes über Störtebeker und seine Bedeutung für die Mythenbildung.
- Der Vergleich zwischen historischen Fakten und ihrer Darstellung im Volkslied.
- Die Frage nach dem Quellenwert von Volksliedern in der Geschichtswissenschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Problematik der vielschichtigen Überlieferung um Klaus Störtebeker vor. Sie hebt die Diskrepanz zwischen historisch belegten Fakten und der legendären Ausschmückung hervor, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie historische Aspekte in der wachsenden Legende verarbeitet und verändert wurden. Die Quellenwahl wird kurz erläutert, wobei die immense Anzahl an Quellen und die Bedeutung der mündlichen Überlieferung betont werden. Die Fragestellung konzentriert sich auf den Einfluss der gewählten Liedform auf die Entwicklung der Störtebeker-Sage. Die Methode der historisch-kritischen Analyse und Textkritik wird angekündigt.
II. Die Störtebeker-Überlieferung im Allgemeinen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Störtebeker-Sage. Es differenziert zwischen der Sagenfigur Störtebeker, die als nahezu unbesiegbarer Seeräuber den gesamten Nord- und Ostseeraum beherrschte und den Armen von seiner Beute abgab, und der historischen Figur, über deren Existenz nur spärliche Informationen vorliegen. Die immense Verbreitung des Mythos, reflektiert in Literatur, Musik und Kunst, wird mit dem Mangel an gesicherten historischen Daten kontrastiert. Dieses Kapitel legt die Grundlage für die spätere Analyse des Volksliedes, indem es den Kontext und die vielschichtigen Ausprägungen der Störtebeker-Überlieferung darstellt.
III. Das Volkslied als Gattung: Dieses Kapitel definiert die Gattung "Volkslied" und deren Eigenschaften. Es betont die oft vorhandene Verbindung zu historischen Ereignissen und Figuren, jedoch auch die Fiktionalität und den eingeschränkten Wahrheitsanspruch dieser Texte. Die Bedeutung von Volksliedern als Träger der mündlichen Überlieferung wird hervorgehoben, besonders im Kontext des 15. bis 18. Jahrhunderts. Der vermeintlich geringe Quellenwert in der Geschichtswissenschaft wird diskutiert, sowie dessen ungenutztes Potenzial im Hinblick auf die Erforschung der Mythenbildung.
Schlüsselwörter
Klaus Störtebeker, Vitalienbrüder, Volkslied, Mündliche Überlieferung, Mythenbildung, Sagenfigur, Historische Figur, Quellenkritik, Textinterpretation, historisch-kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text befasst sich mit der Rolle von Volksliedern bei der Gestaltung des Störtebeker-Mythos. Er untersucht, wie die Gattung Volkslied die Entwicklung und Verbreitung der Störtebeker-Sage beeinflusst hat, und analysiert die textlichen Eigenheiten eines spezifischen Volksliedes im Hinblick auf die Mythenbildung.
Welche Themen werden in dem Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen:
- Die Entwicklung des Störtebeker-Mythos von der historischen Figur zur Legende.
- Die Rolle mündlicher Tradition und Volkslieder in der Verbreitung der Sage.
- Die Analyse eines spezifischen Volksliedes über Störtebeker und seine Bedeutung für die Mythenbildung.
- Der Vergleich zwischen historischen Fakten und ihrer Darstellung im Volkslied.
- Die Frage nach dem Quellenwert von Volksliedern in der Geschichtswissenschaft.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss der Gattung Volkslied auf die Entwicklung und Verbreitung der Störtebeker-Sage zu analysieren. Dabei wird ein spezifisches Volkslied herangezogen und dessen textliche Eigenheiten im Hinblick auf die Mythenbildung untersucht.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Problematik der vielschichtigen Überlieferung um Klaus Störtebeker vor. Sie hebt die Diskrepanz zwischen historisch belegten Fakten und der legendären Ausschmückung hervor, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie historische Aspekte in der wachsenden Legende verarbeitet und verändert wurden. Die Quellenwahl wird kurz erläutert, und die Fragestellung konzentriert sich auf den Einfluss der gewählten Liedform auf die Entwicklung der Störtebeker-Sage. Die Methode der historisch-kritischen Analyse und Textkritik wird angekündigt.
Was wird im Kapitel "Die Störtebeker-Überlieferung im Allgemeinen" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Störtebeker-Sage. Es differenziert zwischen der Sagenfigur Störtebeker und der historischen Figur. Die immense Verbreitung des Mythos, reflektiert in Literatur, Musik und Kunst, wird mit dem Mangel an gesicherten historischen Daten kontrastiert. Dieses Kapitel legt die Grundlage für die spätere Analyse des Volksliedes, indem es den Kontext und die vielschichtigen Ausprägungen der Störtebeker-Überlieferung darstellt.
Was wird im Kapitel "Das Volkslied als Gattung" behandelt?
Dieses Kapitel definiert die Gattung "Volkslied" und deren Eigenschaften. Es betont die oft vorhandene Verbindung zu historischen Ereignissen und Figuren, jedoch auch die Fiktionalität und den eingeschränkten Wahrheitsanspruch dieser Texte. Die Bedeutung von Volksliedern als Träger der mündlichen Überlieferung wird hervorgehoben, besonders im Kontext des 15. bis 18. Jahrhunderts. Der vermeintlich geringe Quellenwert in der Geschichtswissenschaft wird diskutiert, sowie dessen ungenutztes Potenzial im Hinblick auf die Erforschung der Mythenbildung.
Welche Schlüsselwörter werden in dem Text verwendet?
Die Schlüsselwörter sind: Klaus Störtebeker, Vitalienbrüder, Volkslied, Mündliche Überlieferung, Mythenbildung, Sagenfigur, Historische Figur, Quellenkritik, Textinterpretation, historisch-kritische Analyse.
- Arbeit zitieren
- David Reuter (Autor:in), 2023, "Ein schoen Lied / Von der grossen Rauberey". Die Volkslied-Tradition als Ausgangspunkt für die Ausgestaltung der Störtebeker-Figur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1553172