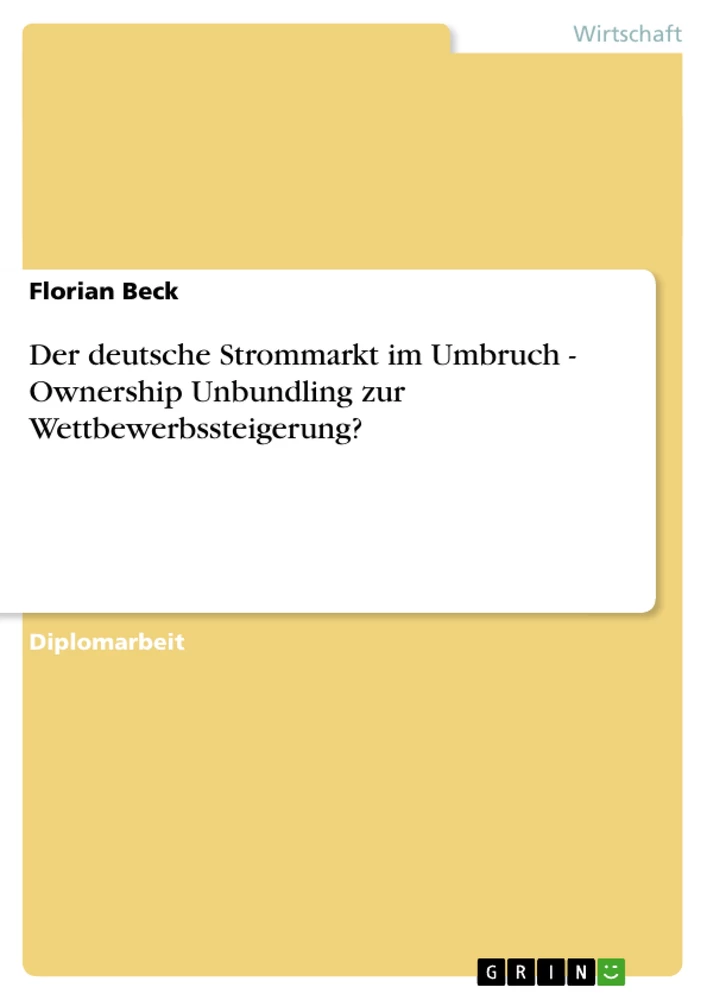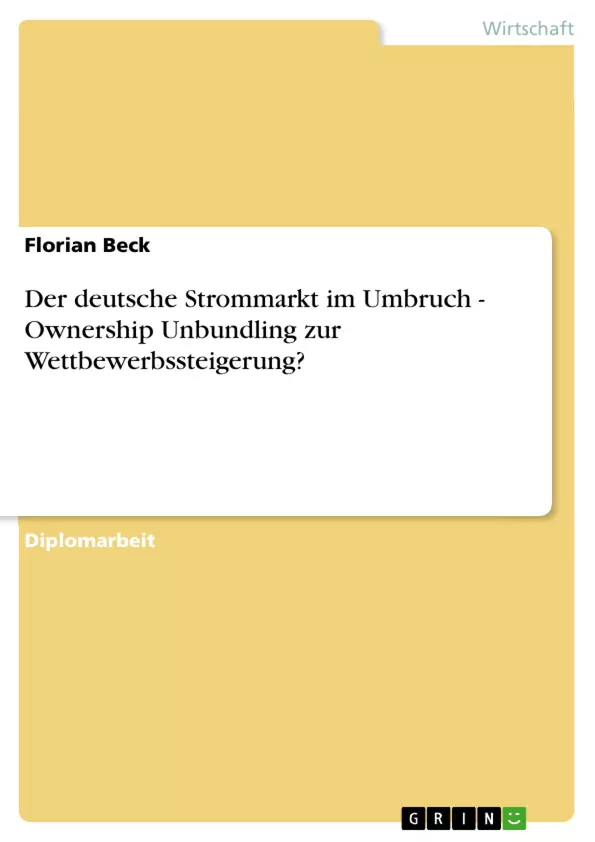Nach Meinung der EU-Kommission ist die Wettbewerbs-und Strompreissituation auf den
europäischen Strommärkten gänzlich unbefriedigend. Den Grund hierfür sieht sie vor allem
im Bereich der Stromübertragungsnetze. In einigen Staaten der EU sind diese nach wie vor
im Eigentum von Verbundunternehmen d.h. Unternehmen, die zeitgleich auch in der Stromerzeugung
und im Stromhandel aktiv sind. Deshalb hat die Kommission nach zähem Ringen
mit Parlament und Nationalstaaten einen dritten Anlauf unternommen, die Strommärkte weiter
zu entflechten. Das dritte Richtlinienpaket zum Elektrizitätsbinnenmarkt muss bis März
2011 in nationales Recht umgesetzt werden und stellt drei Optionen zur Auswahl. Die erste
Variante (Ownership Unbundling) sieht einen Zwangsverkauf der Übertragungsnetze sofern
sich diese in der Hand eines Verbundunternehmens befinden an einen unabhängigen Dritten
vor. Dies ist das von der EU-Kommission favorisierte Modell. Die zweite Möglichkeit (Independent
System Operator ISO) belässt die Übertragungsnetze im Besitz der Verbundunternehmen,
allerdings müssen diese einen unabhängigen Betreiber einsetzen. Variante drei
(Independent Transmission Operator ITO) belässt die Übertragungsnetze in den Verbundunternehmen,
fordert aber eine Verschärfung der gesellschaftsrechtlichen Entflechtung.
Diese Arbeit zeigt unter Einbezug der geschichtlichen Entwicklung, der Liberalisierungsentwicklung
und der Wertschöpfungsstufen die Struktur und die Problematik des deutschen
Strommarktes auf und untersucht die drei EU-Modelle dahingehend, welches der Verfahren
für Deutschland am geeignetsten erscheint, mehr Wettbewerb und sinkende Strompreise zu
ermöglichen. Das Ergebnis ist eine Empfehlung zur vorläufigen Anwendung des ITO-Modells
unter Einbezug einer strikten Regulierung. Die Gründe hierfür sind vielfältig und werden in
der Arbeit detailliert dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Thematische Einführung
- 1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- 2 Die Geschichte des deutschen Strommarktes
- 2.1 Von den Anfängen bis 1945
- 2.2 Die Nachkriegszeit bis zur Wiedervereinigung
- 2.2.1 Die Elektrizitätswirtschaft in der Bundesrepublik
- 2.2.2 Die Elektrizitätswirtschaft der DDR
- 2.3 Deutschland 1990 bis heute
- 2.3.1 Die Integration der neuen Bundesländer
- 2.3.2 Erste Liberalisierungsansätze
- 2.3.3 Liberalisierung 1998 und die Entstehung der großen Vier
- 2.3.3.1 Die EnBW AG
- 2.3.3.2 Die E.ON Energie AG
- 2.3.3.3 Die RWE AG
- 2.3.3.4 Die Vattenfall Europe AG
- 2.3.4 Weitere Liberalisierungsanläufe nach 1998
- 3 Der Strommarkt heute: Strukturen, Probleme und Regulierungsmöglichkeiten
- 3.1 Die drei Stufen der Wertschöpfung
- 3.1.1 Stromerzeugung
- 3.1.2 Stromtransport
- 3.1.2.1 Struktur und Charakteristika der Stromübertragung
- 3.1.2.2 Struktur und Charakteristika der Stromverteilung
- 3.1.2.3 Kostencharakteristika des Stromtransports
- 3.1.3 Stromhandel
- 3.1.3.1 Der Großhandelsmarkt für Strom
- 3.1.3.2 Der Endkundenmarkt für Strom
- 3.2 Liberalisierung und Re-Regulierung der Stromwirtschaft
- 3.3 Liberalisierungsmodelle für die Stromwirtschaft
- 3.4 Modelle zur Regulierung von Netznutzungsentgelten
- 3.5 Netznutzungsentgelte und die Rolle der Bundesnetzagentur
- 3.6 Politische Sonderlasten
- 3.7 Strompreisbildung und Entwicklung
- 3.8 Neueste Entwicklungen: die Vorgaben der EU
- 3.1 Die drei Stufen der Wertschöpfung
- 4 Entflechtungsmodelle nach den Vorgaben der EU
- 4.1 Ownership Unbundling - eigentumsrechtliche Entflechtung
- 4.1.1 Modelle für ein Ownership Unbundling
- 4.1.1.1 Eine private Netz AG
- 4.1.1.2 Eine staatliche Netz AG
- 4.1.1.3 Mehrere private Netzbetreiber
- 4.1.2 Argumente für ein Ownership Unbundling
- 4.1.3 Argumente gegen ein Ownership Unbundling
- 4.1.4 Die realisierte Trennung: Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern
- 4.1.4.1 England und Wales
- 4.1.4.2 Schweden
- 4.1.4.3 Die Niederlande
- 4.1.5 Bewertung des Ownership-Unbundling-Modells
- 4.1.1 Modelle für ein Ownership Unbundling
- 4.2 Independent System Operator ISO
- 4.2.1 Das Modell
- 4.2.2 Erfahrungen aus anderen Ländern
- 4.2.2.1 Irland
- 4.2.2.2 Schweiz
- 4.2.3 Bewertung des ISO-Modells
- 4.3 Independent Transmission Operator ITO
- 4.3.1 Das Modell
- 4.3.2 Bewertung des ITO-Modells
- 4.1 Ownership Unbundling - eigentumsrechtliche Entflechtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen des Ownership Unbundlings auf den deutschen Strommarkt. Ziel ist es, die verschiedenen Entflechtungsmodelle zu analysieren und deren Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Wettbewerbsförderung zu bewerten.
- Die Geschichte der Liberalisierung des deutschen Strommarktes
- Die Struktur des aktuellen Strommarktes und seine Herausforderungen
- Verschiedene Modelle des Ownership Unbundlings
- Bewertung der Entflechtungsmodelle anhand internationaler Beispiele
- Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Liberalisierung des deutschen Strommarktes und das damit verbundene Ownership Unbundling ein. Es beschreibt die Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit.
2 Die Geschichte des deutschen Strommarktes: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des deutschen Strommarktes von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Es beschreibt die verschiedenen Phasen, von der staatlichen Monopolstellung bis hin zur Liberalisierung und der Entstehung der großen vier Energiekonzerne (EnBW, E.ON, RWE, Vattenfall). Die Integration der neuen Bundesländer nach der Wiedervereinigung und die damit verbundenen Herausforderungen werden ebenfalls thematisiert. Der Fokus liegt auf den strukturellen Veränderungen und den politischen Rahmenbedingungen, die die Entwicklung des Marktes prägten.
3 Der Strommarkt heute: Strukturen, Probleme und Regulierungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel analysiert den gegenwärtigen deutschen Strommarkt. Es beschreibt die drei Stufen der Wertschöpfung (Erzeugung, Transport, Handel) im Detail, einschließlich der jeweiligen Strukturen, Probleme und Regulierungsmechanismen. Es werden verschiedene Liberalisierungs- und Regulierungsmodelle vorgestellt und bewertet, u.a. Monopolschutz, Alleinabnehmermodell, Common-Carrier-Modell, sowie verschiedene Modelle zur Regulierung von Netznutzungsentgelten (Kostenregulierung, Price-Cap, Revenue-Cap, Yardstick-Competition). Die Rolle der Bundesnetzagentur und politische Sonderlasten werden ebenfalls betrachtet. Die Kapitel untersuchen die Strompreisbildung und -entwicklung und die neuesten Entwicklungen im Hinblick auf die Vorgaben der EU.
4 Entflechtungsmodelle nach den Vorgaben der EU: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit verschiedenen Entflechtungsmodellen, die von der EU vorgeschrieben wurden, insbesondere dem Ownership Unbundling. Es werden unterschiedliche Modelle des Ownership Unbundlings vorgestellt, wie z.B. eine private oder staatliche Netz AG oder mehrere private Netzbetreiber. Die Argumente für und gegen ein Ownership Unbundling werden ausführlich diskutiert, sowie Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern (England und Wales, Schweden, Niederlande) analysiert. Zusätzlich werden das Independent System Operator (ISO) und das Independent Transmission Operator (ITO) Modell vorgestellt und bewertet.
Schlüsselwörter
Strommarkt, Liberalisierung, Regulierung, Ownership Unbundling, Wettbewerbsförderung, Energiekonzerne, Netznutzungsentgelte, Bundesnetzagentur, EU-Vorgaben, Entflechtung, ISO, ITO, Deutschland.
FAQ: Auswirkungen des Ownership Unbundlings auf den deutschen Strommarkt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen des Ownership Unbundlings auf den deutschen Strommarkt. Ziel ist die Analyse verschiedener Entflechtungsmodelle und die Bewertung ihrer Vor- und Nachteile hinsichtlich der Wettbewerbsförderung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte der Liberalisierung des deutschen Strommarktes, die Struktur des aktuellen Marktes und seine Herausforderungen, verschiedene Modelle des Ownership Unbundlings, deren Bewertung anhand internationaler Beispiele und die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung und beschreibt die Vorgehensweise. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte des deutschen Strommarktes von den Anfängen bis heute, inklusive der Liberalisierung und der Rolle der großen vier Energiekonzerne. Kapitel 3 analysiert den aktuellen Strommarkt mit seinen Strukturen, Problemen und Regulierungsmöglichkeiten. Kapitel 4 befasst sich ausführlich mit verschiedenen Entflechtungsmodellen, insbesondere dem Ownership Unbundling, und deren Bewertung anhand internationaler Beispiele (u.a. England, Wales, Schweden, Niederlande, Irland, Schweiz).
Welche Entflechtungsmodelle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Entflechtungsmodelle, die von der EU vorgeschrieben wurden, insbesondere das Ownership Unbundling mit verschiedenen Varianten (private/staatliche Netz AG, mehrere private Netzbetreiber). Zusätzlich werden das Independent System Operator (ISO) und das Independent Transmission Operator (ITO) Modell analysiert.
Welche Aspekte des Ownership Unbundlings werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Argumente für und gegen das Ownership Unbundling, analysiert Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern und bewertet die verschiedenen Modelle hinsichtlich ihrer Eignung für den deutschen Strommarkt und ihrer Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit.
Welche Rolle spielt die Bundesnetzagentur?
Die Rolle der Bundesnetzagentur bei der Regulierung von Netznutzungsentgelten und im Kontext der Liberalisierung des Strommarktes wird im Kapitel 3 behandelt.
Wie wird der aktuelle Strommarkt beschrieben?
Der aktuelle Strommarkt wird in Kapitel 3 im Detail beschrieben, inklusive der drei Stufen der Wertschöpfung (Erzeugung, Transport, Handel), der jeweiligen Strukturen, Probleme und Regulierungsmechanismen. Verschiedene Liberalisierungs- und Regulierungsmodelle werden vorgestellt und bewertet (z.B. Kostenregulierung, Price-Cap, Revenue-Cap, Yardstick-Competition).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Strommarkt, Liberalisierung, Regulierung, Ownership Unbundling, Wettbewerbsförderung, Energiekonzerne, Netznutzungsentgelte, Bundesnetzagentur, EU-Vorgaben, Entflechtung, ISO, ITO, Deutschland.
- Citar trabajo
- Dipl.-Volkswirt Florian Beck (Autor), 2010, Der deutsche Strommarkt im Umbruch - Ownership Unbundling zur Wettbewerbssteigerung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155320