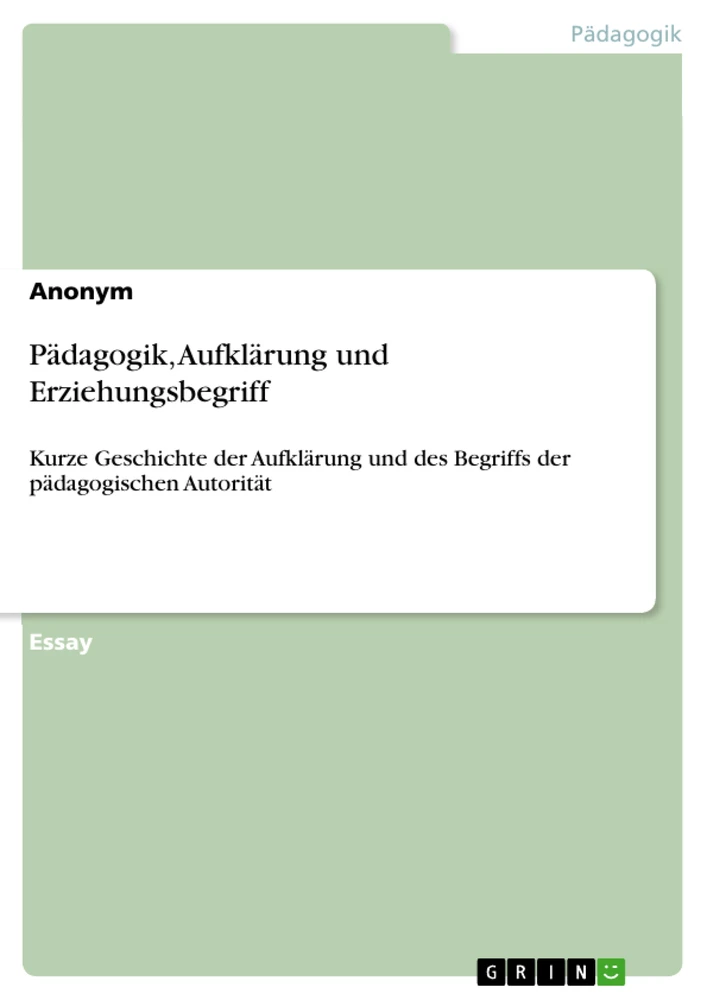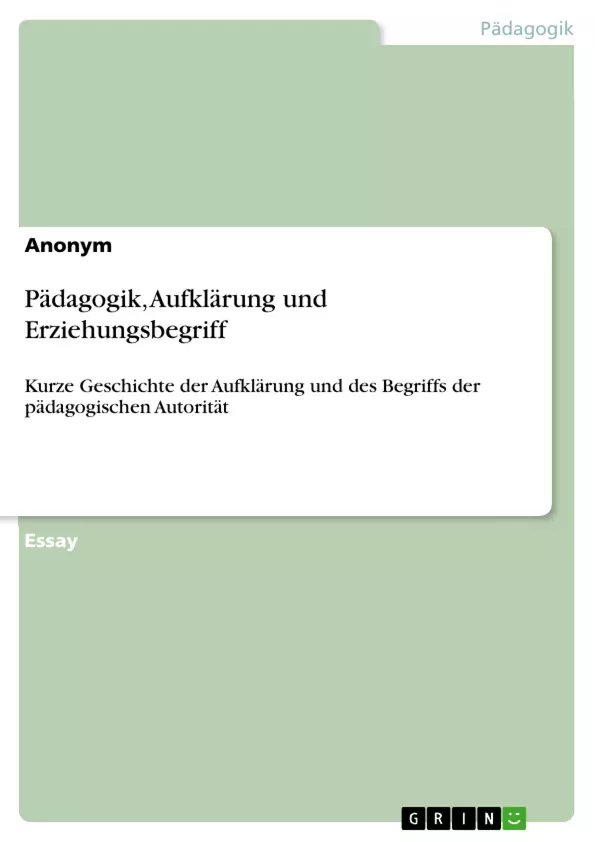In dem vorliegenden wissenschaftlichen Portfolio wird die komplexe Beziehung zwischen Schule, Erziehung und Autorität in querschnittartig in einem historischen und theoretischen Kontext analysiert. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie ein traditioneller Begriff der Autorität in der empirischen Unterrichtsforschung revitalisiert und für die Herausforderungen der heutigen Bildungslandschaft fruchtbar gemacht werden kann. Die erste Sektion der Arbeit widmet sich der Geschichte der Pädagogik von der Aufklärung bis zur Gegenwart, wobei insbesondere die Entwicklungen und Umbrüche im pädagogischen Denken des 18. und 19. Jahrhunderts in den Blick genommen werden. Anhand der grundlegenden Werke von Philosophen wie Immanuel Kant und Johann Heinrich Pestalozzi wird aufgezeigt, wie sich die Pädagogik von einer autoritätszentrierten zu einer zunehmend emanzipatorischen Disziplin entwickelt hat.
Im zweiten Abschnitt wird der Erziehungsbegriff der Aufklärung näher untersucht, speziell unter Bezug auf Kants Erziehungsverständnis. Kants Philosophie stellt den Menschen als vernunftbegabtes Wesen dar, dessen Erziehung nicht nur der Wissensvermittlung dient, sondern vor allem der Förderung der moralischen und praktischen Fähigkeiten. Dieser humanistische Ansatz ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für das Verständnis von Erziehung im Kontext von Selbstbestimmung und Mündigkeit. Die Auseinandersetzung mit Kants Pädagogik bietet tiefe Einblicke in die Weichenstellungen der modernen Erziehungswissenschaft und stellt den historischen Rahmen für das spätere Verständnis von Autorität in der Bildung dar.
Der dritte und zentrale Teil der Arbeit widmet sich der Frage der pädagogischen Autorität und ihrer Rolle im Unterricht. Autorität wird hier nicht als ein rein autoritärer Begriff verstanden, sondern als ein vielschichtiger pädagogischer Ansatz, der sowohl Vertrauen als auch Verantwortung umfasst. Anhand der empirischen Forschung von Jörg Twardella wird aufgezeigt, wie der Begriff der pädagogischen Autorität in der modernen Unterrichtsforschung eine neue Relevanz erlangt hat. Grundlage sind die Werke von Blankertz, Koller und Twardella.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart
- 2. Der Erziehungsbegriff der Aufklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Pädagogik von der Aufklärung bis zur Gegenwart und beleuchtet den Erziehungsbegriff der Aufklärung. Sie analysiert die Entwicklung des Bildungswesens, verschiedene Erziehungsansätze und die Rolle von Autorität in der Erziehung.
- Entwicklung der Pädagogik vom Mittelalter zur Aufklärung
- Der Erziehungsbegriff der Aufklärung und seine zentralen Aspekte
- Die Rolle von Vernunft und Freiheit in der Erziehung
- Vergleich verschiedener Bildungswege im Mittelalter
- Die Bedeutung von Institutionalisierung in der Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart: Dieser Abschnitt analysiert Herwig Blankertz' Werk und zeichnet einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Pädagogik vom Mittelalter bis zur Aufklärung nach. Blankertz beschreibt die mittelalterliche Bildung, die auf Klerus und Adel beschränkt war und sich auf die septem artes liberales konzentrierte. Die ritterliche Erziehung hingegen war praxisorientierter und auf Tugenden wie körperliche Tüchtigkeit und gesellschaftlichen Schliff ausgerichtet. Blankertz differenziert auch zwischen den Bildungswegen von Handwerkern und Kaufleuten im Vergleich zur landwirtschaftlichen Bevölkerung. Die Renaissance wird als Übergang zur Neuzeit dargestellt, mit ihrer Betonung antiker Werte und der Hinwendung zur weltlichen Bildung. Die Aufklärung wird als die Epoche beschrieben, in der das zuvor als sicher geltende Wissen infrage gestellt und an strenge Beweise und logische Schlussfolgerungen geknüpft wurde. Die Arbeit von Blankertz endet mit der Feststellung, dass sich die Schule im Laufe der Geschichte zunehmend von der Kirche emanzipierte, obwohl die geistliche Schulaufsicht erst 1919 endgültig abgeschafft wurde. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Institutionalisierung der Erziehung und dem Wandel der Bildungsziele.
2. Der Erziehungsbegriff der Aufklärung: Basierend auf Hans-Christoph Kollers Werk wird der Erziehungsbegriff der Aufklärung, insbesondere Kants Ansatz, vertieft. Kant sieht die Freiheit des Menschen, seine Vernunft öffentlich einzusetzen, als zentrale Bedingung für Erziehung. Koller analysiert die Vorstellung der Aufklärung, dass Kinder einen eigenen "Schonraum" benötigen, getrennt vom komplexen Erwachsenenleben. Kants Argument, dass der Mensch als einziges Wesen erzogen werden muss, aufgrund des Fehlens eines Instinkts im Gegensatz zu Tieren, wird diskutiert. Koller interpretiert Kants Aussage, dass Erziehung den Menschen zum Menschen macht, als eine Entfaltung des menschlichen Potentials. Die zwiespältige Natur der Erziehung, die von unvollkommenen Menschen betrieben wird und daher ein unbestimmtes Ziel hat, wird ebenfalls thematisiert. Der Text untersucht die Metaphern, die die Erziehung als handwerkliches Tun oder als Entfaltung eines natürlichen Prozesses beschreiben, und deren Spannung zueinander.
Schlüsselwörter
Pädagogik, Aufklärung, Erziehung, Bildung, Mittelalter, Renaissance, Vernunft, Freiheit, Institutionalisierung, Kant, Koller, Blankertz, septem artes liberales, Handwerk, Kaufleute, Landvolk.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter einer Arbeit über die Geschichte der Pädagogik von der Aufklärung bis zur Gegenwart enthält.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Hauptthemen sind die Entwicklung der Pädagogik vom Mittelalter zur Aufklärung, der Erziehungsbegriff der Aufklärung mit seinen zentralen Aspekten, die Rolle von Vernunft und Freiheit in der Erziehung, der Vergleich verschiedener Bildungswege im Mittelalter und die Bedeutung von Institutionalisierung in der Erziehung.
Welche Kapitel werden zusammengefasst?
Zusammengefasst werden die Kapitel "Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart" und "Der Erziehungsbegriff der Aufklärung".
Was behandelt das Kapitel "Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart"?
Dieses Kapitel analysiert Herwig Blankertz' Werk und zeichnet einen Überblick über die Geschichte der Pädagogik vom Mittelalter bis zur Aufklärung nach. Es beschreibt die mittelalterliche Bildung, die ritterliche Erziehung, die Bildungswege von Handwerkern, Kaufleuten und Landvolk, die Renaissance als Übergang zur Neuzeit und die Aufklärung als Epoche der Infragestellung sicheren Wissens. Es betont die Emanzipation der Schule von der Kirche und die Entwicklung der Institutionalisierung der Erziehung.
Was behandelt das Kapitel "Der Erziehungsbegriff der Aufklärung"?
Dieses Kapitel vertieft den Erziehungsbegriff der Aufklärung, insbesondere Kants Ansatz, basierend auf Hans-Christoph Kollers Werk. Es behandelt die Freiheit des Menschen zur Vernunftnutzung als Bedingung für Erziehung, die Vorstellung eines "Schonraums" für Kinder, Kants Argument der Notwendigkeit der Erziehung des Menschen aufgrund fehlender Instinkte, die Entfaltung des menschlichen Potentials durch Erziehung und die zwiespältige Natur der Erziehung durch unvollkommene Menschen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Pädagogik, Aufklärung, Erziehung, Bildung, Mittelalter, Renaissance, Vernunft, Freiheit, Institutionalisierung, Kant, Koller, Blankertz, septem artes liberales, Handwerk, Kaufleute, Landvolk.
Wer sind Herwig Blankertz und Hans-Christoph Koller in diesem Kontext?
Herwig Blankertz ist ein Autor, dessen Werk zur Geschichte der Pädagogik analysiert wird. Hans-Christoph Koller ist ein Autor, dessen Werk zum Erziehungsbegriff der Aufklärung, insbesondere zu Kant, analysiert wird.
Was sind die "septem artes liberales"?
Die "septem artes liberales" (sieben freie Künste) waren ein Kanon von Studienfächern im Mittelalter, die als Grundlage für höhere Bildung dienten. Sie umfassten Grammatik, Rhetorik, Logik (das Trivium) sowie Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie (das Quadrivium).
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Pädagogik, Aufklärung und Erziehungsbegriff, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1553380