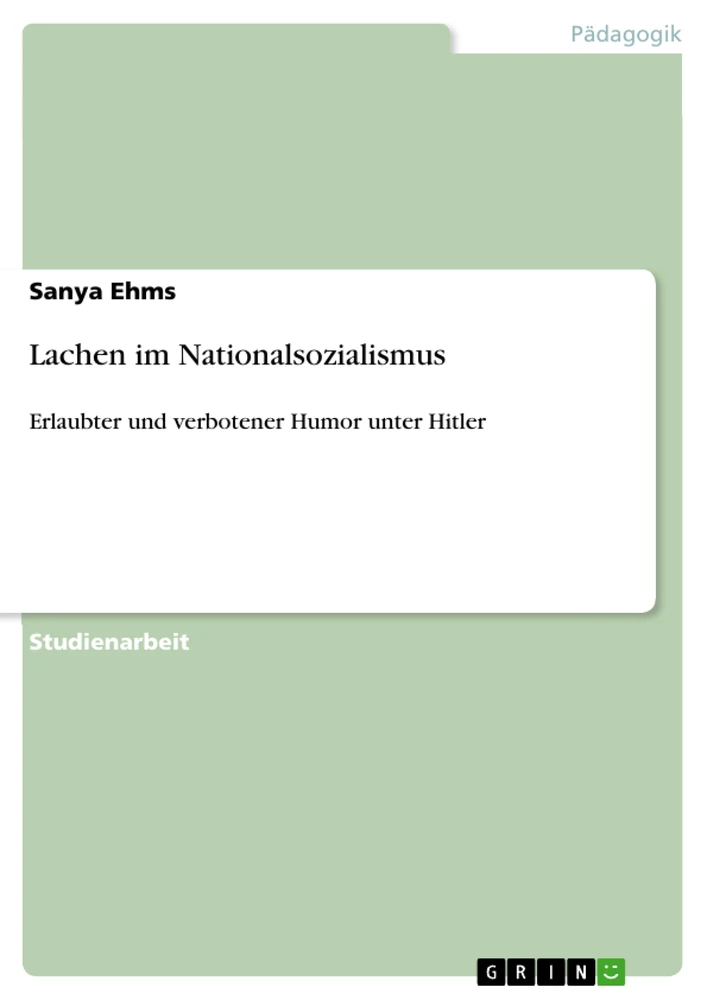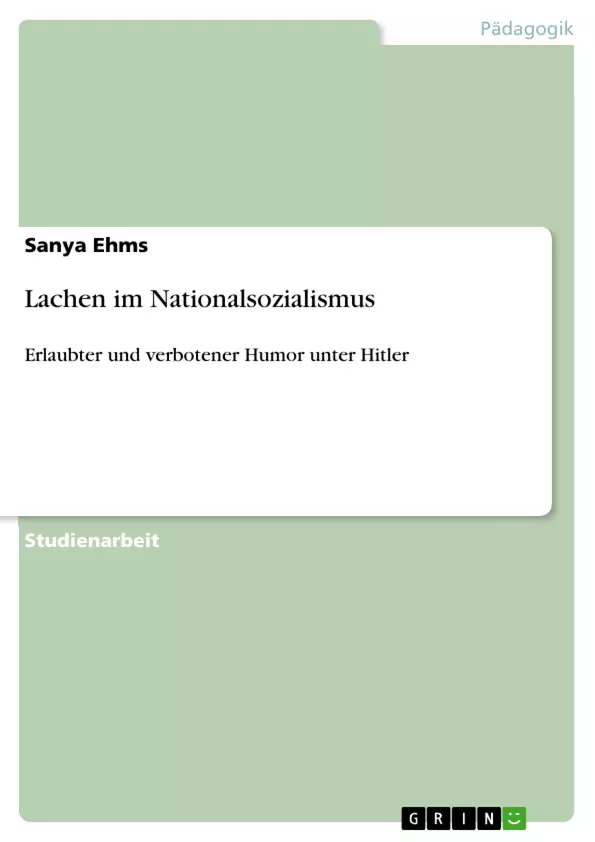In meiner Hausarbeit setze ich mich mit dem Humor im Nationalsozialismus auseinander.
Nach einer kurzen Behandlung der Begriffe „Humor“ und „Witz“ gehe ich auf die Komiktheorien von Immanuel Kant, Jean Paul, Henri Bergson und Thomas Hobbes ein, um herauszufinden, was uns zum Lachen bringt.
Danach kläre ich, was ein politischer Witz ist. Erst wenn man sich dieser Definition bewusst ist, kann man den Humor im Nationalsozialismus verstehen und analysieren.
Sich mit dem Humor des Dritten Reiches auseinanderzusetzen bedeutet auch, sich darüber Gedanken zu machen, ob es moralisch vertretbar ist, über Hitler und die Hitler-Zeit zu lachen. Mit dieser Frage setze ich mich im vierten Kapitel auseinander.
Darüber hinaus kläre ich in meiner Hausarbeit, welcher Humor in der NS-Zeit vorherrschte. Welche Art von Humor kursierte? Durfte das Volk frei lachen oder war dies gefährlich? Gab es evtl. einen Humor, der von den Nationalsozialisten unterstützt oder sogar gefördert wurde? Wobei verstand Hitler keinen Spaß?
Nachdem ich diese Fragen beantwortet habe, gehe ich darauf ein, was mit den Witze-Erzählern passierte, die mit ihrem Humor über die Stränge schlugen. Was hatten sie zu befürchten und wie wurde gegen sie vorgegangen?
Im Anschluss daran analysiere ich verschiedene Witze dieser Zeit unter Einbeziehung der im Voraus beschriebenen Komiktheorien.
Zu guter Letzt gebe ich ein abschließendes Fazit zu meiner Hausarbeit und den gewonnenen Einsichten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Humor und Witz
- Komiktheorien: Warum lachen wir?
- Der politische Witz
- Darf man über Hitler lachen?
- Erlaubter, zweckmäßiger und verbotener Humor im Nationalsozialismus
- Gesetze und Vorgehensweisen gegenüber politischen Gegnern
- Die Analyse ausgewählter Witze aus der NS-Zeit
- Abschließendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Humors im Nationalsozialismus. Neben einer einleitenden Definition von "Humor" und "Witz" werden die Komiktheorien von Immanuel Kant, Jean Paul, Henri Bergson und Thomas Hobbes beleuchtet, um die Ursachen des Lachens zu erforschen. Anschließend wird der Begriff des politischen Witzes definiert, um den Humor des Dritten Reiches verstehen und analysieren zu können. Die Frage nach der moralischen Vertretbarkeit von Humor über Hitler und die Hitler-Zeit wird im vierten Kapitel erörtert.
- Definition von "Humor" und "Witz"
- Analyse von Komiktheorien
- Definition des politischen Witzes
- Moralische Aspekte von Humor über Hitler und die Hitler-Zeit
- Analyse von Humor im Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Humors im Nationalsozialismus ein und stellt die Forschungsziele und -fragestellungen vor. Das zweite Kapitel behandelt die Begriffe "Humor" und "Witz" und beleuchtet deren unterschiedliche Bedeutungen im Laufe der Geschichte.
Kapitel 3 widmet sich verschiedenen Komiktheorien, um die Ursachen des Lachens zu erforschen. Die Theorien von Immanuel Kant, Jean Paul, Henri Bergson und Thomas Hobbes werden vorgestellt und diskutiert.
Das vierte Kapitel behandelt den politischen Witz und seine Bedeutung im Kontext der NS-Zeit. Die Rolle des Witzes als Mittel der Kritik und Meinungsäußerung sowie die Themen, die im politischen Witz der NS-Zeit aufgegriffen wurden, werden erläutert.
Kapitel 5 stellt die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, über Hitler und die Hitler-Zeit zu lachen. Die ethischen Aspekte des Humors im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus werden kritisch hinterfragt.
Kapitel 6 analysiert die verschiedenen Arten von Humor, die im Nationalsozialismus verbreitet waren. Die Unterscheidung zwischen erlaubtem, zweckmäßigem und verbotenem Humor wird vorgestellt, und es wird untersucht, welche Arten von Humor von den Nationalsozialisten unterstützt oder sogar gefördert wurden.
Kapitel 7 beschäftigt sich mit den Konsequenzen für Witzeerzähler, die mit ihrem Humor über die Stränge schlugen. Die Gesetze und Vorgehensweisen gegen politische Gegner, die durch ihre Witze das NS-Regime in Frage stellten, werden beleuchtet.
In Kapitel 8 werden ausgewählte Witze aus der NS-Zeit unter Einbeziehung der zuvor beschriebenen Komiktheorien analysiert.
Schlüsselwörter
Humor, Witz, Komiktheorien, Nationalsozialismus, politischer Witz, Hitler, NS-Zeit, Zensur, Propaganda, Satire, Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen
War Humor im Nationalsozialismus erlaubt?
Es gab eine strikte Unterscheidung zwischen erlaubtem, zweckmäßigem (Propaganda-Humor) und verbotenem Humor, der als staatsfeindlich galt.
Welche Konsequenzen drohten beim Erzählen politischer Witze?
Witzeerzähler mussten mit drakonischen Strafen, Verhaftung durch die Gestapo und Einweisung in Konzentrationslager rechnen, da dies als „Heimtücke“ gewertet wurde.
Ist es moralisch vertretbar, über Hitler zu lachen?
Die Arbeit setzt sich kritisch mit dieser ethischen Frage auseinander und beleuchtet die Rolle von Satire als Mittel des geistigen Widerstands.
Welche Komiktheorien werden in der Arbeit analysiert?
Es werden die Theorien von Immanuel Kant, Jean Paul, Henri Bergson und Thomas Hobbes herangezogen, um zu erklären, was Menschen zum Lachen bringt.
Was ist ein „politischer Witz“?
Ein politischer Witz ist eine Form der Kritik, die Missstände oder Machthaber durch Komik entlarvt und oft als Ventil für unterdrückte Meinungen dient.
- Citar trabajo
- Sanya Ehms (Autor), 2008, Lachen im Nationalsozialismus , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155345