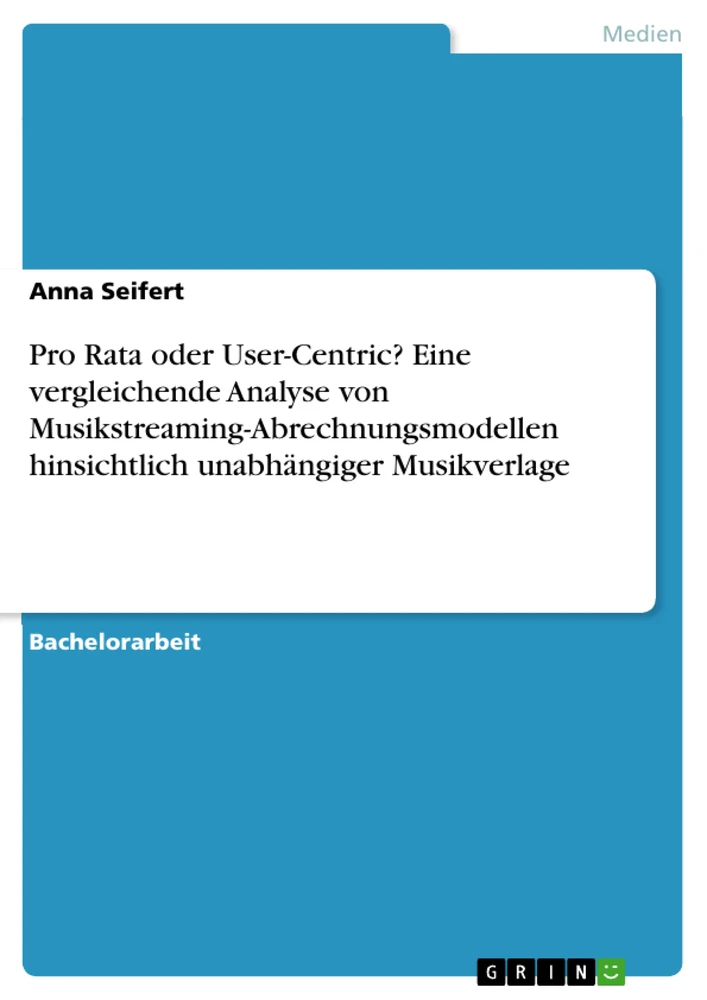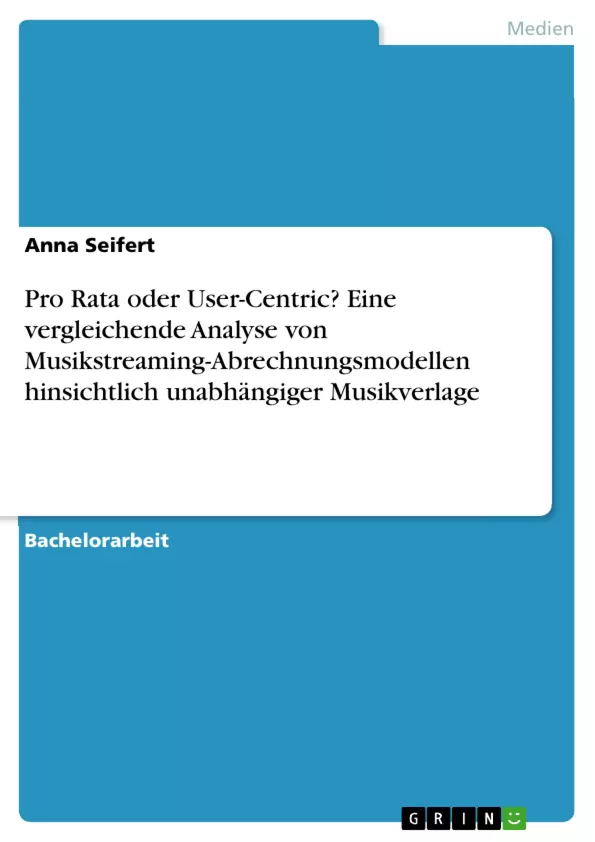Mit der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung des Musikstreamings rückt das dabei angewandte Abrechnungsmodell, welches die Verteilung der Lizenzausschüttungen an die Musikrechteinhaber regelt, in den Fokus der Branchendiskussion. Vor allem unabhängige Akteure der Musikwirtschaft kritisieren das aktuell genutzte Pro Rata-Modell und fordern eine Umstellung auf das sogenannte User-Centric Payment System. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich deshalb mit dem Vergleich der beiden Modelle in Bezug auf das unabhängige Musikverlagswesen in Deutschland anhand ausgewählter wirtschaftlicher und kultureller Kriterien. Sie verfolgt das Ziel, unabhängigen Musikverlagen eine fundierte Einschätzung hinsichtlich der zwei Modelle zu geben.
Dafür werden relevante empirische Studien, Konferenzbeiträge und Artikel aus Fachzeitschriften mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, sodass die zwei Verteilungsmodelle gegenübergestellt werden können. Die Ergebnisse der Analyse werden anschließend auf das unabhängige Musikverlagswesen übertragen. Dabei wird Bezug auf die vorher erarbeiteten theoretischen Grundlagen zum Musikverlagswesen genommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Musikstreaming
- 2.1 Definition und Begriffsabgrenzung
- 2.2 Geschichtliche Entwicklung des Musikstreamings
- 2.3 Aktuelle Marktsituation
- 2.3.1 Wirtschaftliche Bedeutung für den Musikmarkt
- 2.3.2 Die Anbieter von Musikstreaming
- 2.4 Das Geschäftsmodell von Musikstreaming
- 2.4.1 Das Geschäftsmodell auf Nachfragerseite
- 2.4.2 Das Geschäftsmodell auf Anbieterseite
- 3 Mögliche Abrechnungsmodelle beim Musikstreaming
- 3.1 Das Pro Rata-Modell
- 3.2 Das User-Centric Payment System
- 3.3 Kritik und Befürwortung
- 4 Das Musikverlagswesen
- 4.1 Die Entwicklung des Musikverlagswesens in Deutschland
- 4.1.1 Die Geschichte des Musikverlagswesens
- 4.1.2 Das moderne Musikverlagswesen
- 4.2 Die Arbeitsweise und das Geschäftsmodell von Musikverlagen
- 4.2.1 Die vertraglichen und rechtlichen Grundlagen
- 4.2.2 Die Auswertung von musikalischen Werken
- 4.3 Musikverlage und Streaming
- 4.3.1 Die Verteilung der Lizenzeinnahmen durch die GEMA
- 4.3.2 Besonderheit im Vergleich zur physischen Distribution
- 4.4 Musikverlage zwischen Wirtschaft und Kultur
- 4.1 Die Entwicklung des Musikverlagswesens in Deutschland
- 5 Methodik
- 5.1 Methodik
- 5.2 Verwendete Literatur und Forschungsstand
- 6 Ergebnisse
- 6.1 Die Abrechnungsmodelle aus wirtschaftlicher Sicht
- 6.1.1 Höhe der Lizenzeinnahmen
- 6.1.2 Effizienz
- 6.1.3 Transparenz
- 6.1.4 Manipulations- und Betrugspotential
- 6.2 Die Abrechnungsmodelle aus kultureller Sicht
- 6.2.1 Musikalische Diversität
- 6.2.2 Gerechtigkeit
- 6.3 Diskussion und kritische Würdigung
- 6.3.1 Diskussion der Ergebnisse
- 6.3.2 Kritische Würdigung
- 6.1 Die Abrechnungsmodelle aus wirtschaftlicher Sicht
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit vergleicht die Abrechnungsmodelle Pro Rata und User-Centric im Musikstreaming hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf unabhängige Musikverlage in Deutschland. Ziel ist eine fundierte Einschätzung beider Modelle für diese Verlage. Die Arbeit analysiert relevante Studien und Fachartikel mittels qualitativer Inhaltsanalyse.
- Wirtschaftliche Auswirkungen der Abrechnungsmodelle auf unabhängige Musikverlage
- Kulturelle Auswirkungen, insbesondere die Förderung musikalischer Diversität
- Vergleich der Transparenz und Effizienz beider Modelle
- Bewertung des Manipulations- und Betrugspotentials
- Theoretische Grundlagen des Musikverlagswesens und des Musikstreamings
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die steigende Bedeutung von Musikstreaming und die damit verbundene Debatte um geeignete Abrechnungsmodelle. Sie hebt die Kritik am Pro Rata-Modell durch unabhängige Musikverlage hervor und benennt das User-Centric Payment System als Alternative. Die Arbeit formuliert die Forschungsfrage und die Zielsetzung, nämlich den Vergleich beider Modelle hinsichtlich wirtschaftlicher und kultureller Kriterien für unabhängige deutsche Musikverlage.
2 Musikstreaming: Dieses Kapitel definiert Musikstreaming und beschreibt seine geschichtliche Entwicklung und die aktuelle Marktsituation. Es beleuchtet die wirtschaftliche Bedeutung des Musikstreamings für den Musikmarkt und analysiert die Geschäftsmodelle sowohl vonseiten der Anbieter als auch der Nachfrager. Die Darstellung der verschiedenen Marktteilnehmer und ihrer Interaktionen bildet die Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Analyse der Abrechnungsmodelle.
3 Mögliche Abrechnungsmodelle beim Musikstreaming: Dieses Kapitel stellt die beiden zentralen Abrechnungsmodelle, Pro Rata und User-Centric, detailliert vor. Es beschreibt die Funktionsweise jedes Modells, inklusive der jeweiligen Berechnungsmethoden und der Verteilung der Lizenzausschüttungen. Dabei werden sowohl Stärken als auch Schwächen beider Systeme herausgearbeitet und kritische Stimmen aus der Branche einbezogen. Der Vergleich legt den Grundstein für die spätere Analyse im Hinblick auf unabhängige Musikverlage.
4 Das Musikverlagswesen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung, der Arbeitsweise und dem Geschäftsmodell von Musikverlagen in Deutschland. Es beleuchtet die historischen Hintergründe und die aktuelle Situation der Branche, einschließlich der vertraglichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Fokus liegt auf der Rolle der Musikverlage im Streaming-Kontext, insbesondere auf der Verteilung der Lizenzeinnahmen über die GEMA. Der Abschnitt betont den Spannungsbogen zwischen wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten im Musikverlagswesen, der später in die Bewertung der Abrechnungsmodelle einfließt.
5 Methodik: Das Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es erläutert die angewandte qualitative Inhaltsanalyse und benennt die verwendeten Quellen wie empirische Studien, Konferenzbeiträge und Fachartikel. Die Beschreibung der Forschungsmethodik gewährleistet Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Die Auswahl der Quellen und die angewandte Methode werden detailliert erklärt, um die Validität und die Reliabilität der Studie sicherzustellen.
6 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der vergleichenden Analyse der beiden Abrechnungsmodelle. Es bewertet sowohl die wirtschaftlichen (Höhe der Lizenzeinnahmen, Effizienz, Transparenz, Manipulations- und Betrugspotenzial) als auch kulturellen Aspekte (musikalische Diversität, Gerechtigkeit) der Modelle. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und mit Bezug auf die im vorherigen Kapitel beschriebenen theoretischen Grundlagen diskutiert und kritisch gewürdigt. Der Vergleich ermöglicht ein differenziertes Bild der Vor- und Nachteile beider Systeme.
Schlüsselwörter
Musikstreaming, Abrechnungsmodelle, Pro Rata, User-Centric Payment System, unabhängige Musikverlage, Lizenzeinnahmen, wirtschaftliche Auswirkungen, kulturelle Auswirkungen, musikalische Diversität, GEMA, qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Sprachvorschau zur Bachelorarbeit über Musikstreaming?
Diese Sprachvorschau enthält das Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter der Bachelorarbeit. Sie dient dazu, einen Überblick über die Struktur und den Inhalt der Arbeit zu geben.
Was sind die Hauptthemen der Bachelorarbeit?
Die Hauptthemen sind Musikstreaming, Abrechnungsmodelle (Pro Rata und User-Centric Payment System), unabhängige Musikverlage in Deutschland, Lizenzeinnahmen, wirtschaftliche und kulturelle Auswirkungen der Abrechnungsmodelle, musikalische Diversität und die Rolle der GEMA.
Welche Abrechnungsmodelle werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Pro Rata-Modell und das User-Centric Payment System (UCPS) im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf unabhängige Musikverlage.
Was ist das Ziel der Bachelorarbeit?
Ziel der Arbeit ist eine fundierte Einschätzung der Abrechnungsmodelle Pro Rata und User-Centric Payment System für unabhängige Musikverlage in Deutschland, basierend auf einer Analyse relevanter Studien und Fachartikel.
Welche methodischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse, um relevante Studien, Konferenzbeiträge und Fachartikel auszuwerten.
Was wird in der Einleitung der Bachelorarbeit behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, erläutert die Bedeutung von Musikstreaming, thematisiert die Debatte um Abrechnungsmodelle und formuliert die Forschungsfrage und Zielsetzung der Arbeit.
Was wird im Kapitel über Musikstreaming behandelt?
Dieses Kapitel definiert Musikstreaming, beschreibt seine historische Entwicklung und die aktuelle Marktsituation. Es analysiert die Geschäftsmodelle von Anbietern und Nachfragern und beleuchtet die wirtschaftliche Bedeutung des Musikstreamings.
Was wird im Kapitel über Abrechnungsmodelle behandelt?
Dieses Kapitel stellt die Abrechnungsmodelle Pro Rata und User-Centric detailliert vor, beschreibt ihre Funktionsweise und vergleicht ihre Stärken und Schwächen.
Was wird im Kapitel über das Musikverlagswesen behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung, der Arbeitsweise und dem Geschäftsmodell von Musikverlagen in Deutschland. Es beleuchtet die Rolle der Musikverlage im Streaming-Kontext und die Verteilung der Lizenzeinnahmen über die GEMA.
Was wird im Ergebniskapitel der Bachelorarbeit behandelt?
Das Ergebniskapitel präsentiert die Ergebnisse der vergleichenden Analyse der beiden Abrechnungsmodelle hinsichtlich wirtschaftlicher (Lizenzeinnahmen, Effizienz, Transparenz, Betrugspotenzial) und kultureller (musikalische Diversität, Gerechtigkeit) Aspekte.
Welche Schlüsselwörter sind für die Bachelorarbeit relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Musikstreaming, Abrechnungsmodelle, Pro Rata, User-Centric Payment System, unabhängige Musikverlage, Lizenzeinnahmen, wirtschaftliche Auswirkungen, kulturelle Auswirkungen, musikalische Diversität, GEMA, qualitative Inhaltsanalyse.
- Arbeit zitieren
- Anna Seifert (Autor:in), 2021, Pro Rata oder User-Centric? Eine vergleichende Analyse von Musikstreaming-Abrechnungsmodellen hinsichtlich unabhängiger Musikverlage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1553539