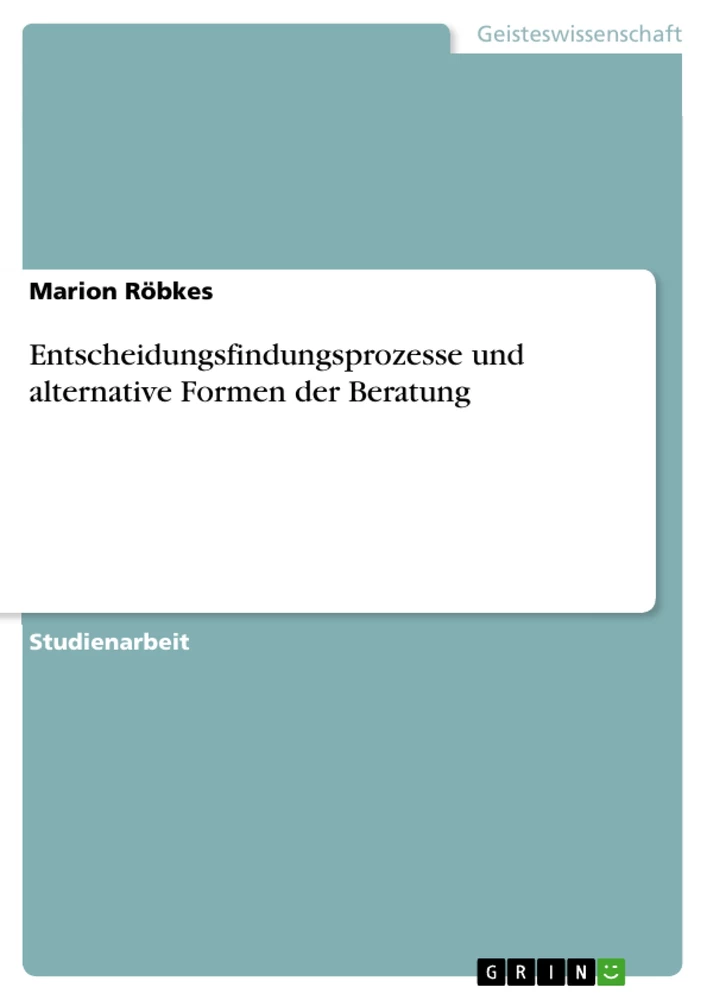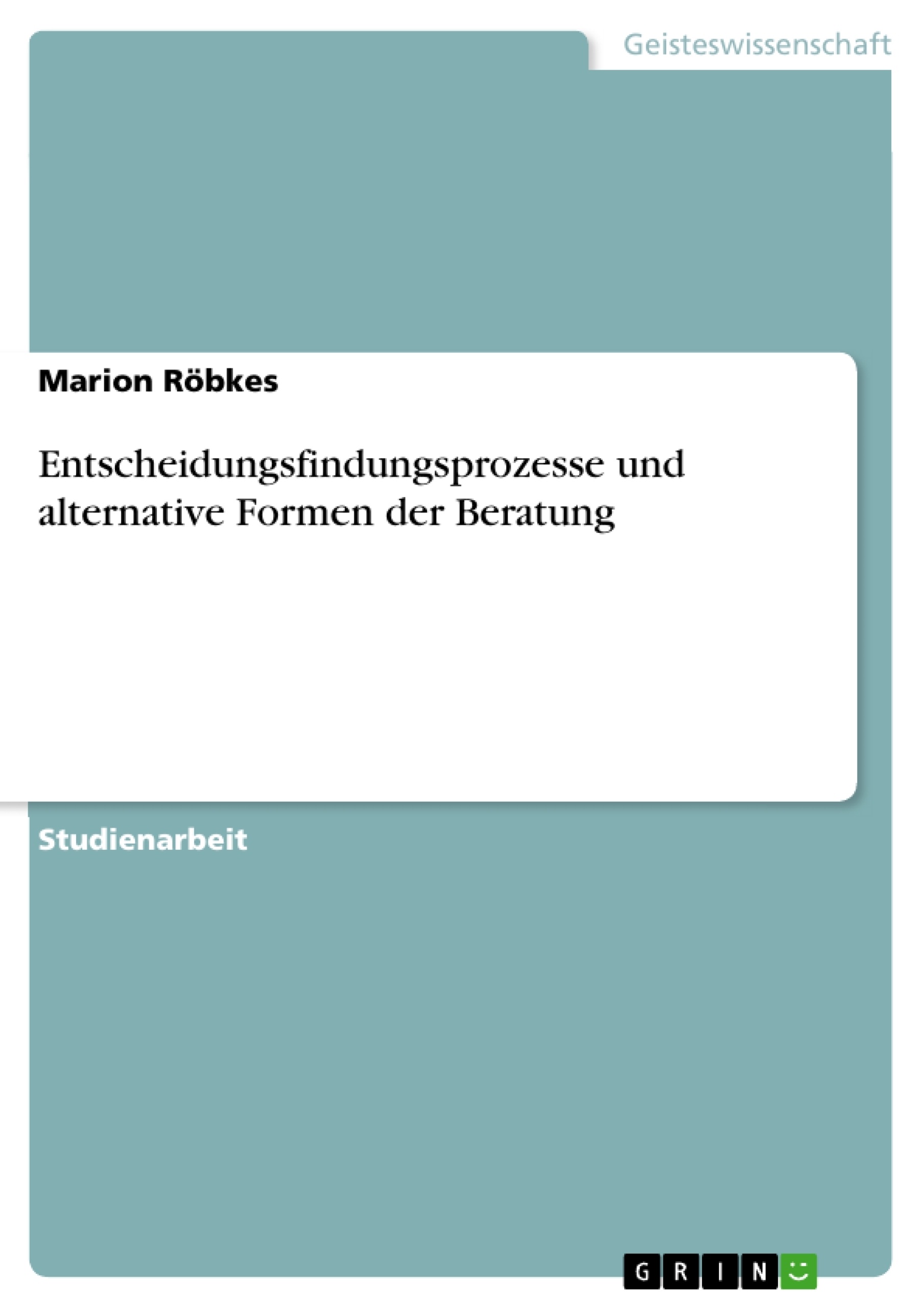Der Alltag ist erfüllt von Entscheidungssituationen mannigfaltiger Art. Verschiedene Lebenssituationen und damit verbundene Rollen erfordern Entscheidungen mit unterschiedlichen Auswirkungen bzw. Reichweiten und einhergehenden Verantwortungen. Die nachfolgende Arbeit will sich in einem ersten Teil kurz mit den verschiedenen Grundlagen der Entscheidungsfindungsprozesse auseinandersetzen. So geht es um die Fragen: Wer entscheidet? In welcher Intensität wird die Entscheidung getroffen? Welche tatsächlichen oder vermeintlichen Auswirkungen können Entscheidungen entfalten? Und: Welche Faktoren können Entscheidungen hemmen? Insbesondere der letzte Aspekt ist bedeutsam für die Betrachtung, warum und in welchen Situationen Menschen (für sich) Entscheidungen nicht zu treffen vermögen. An diesen Stellen wird Urteils- und Handlungsvermögen defizitär. Dies kann zum einen durch Persönlichkeitsmerkmale weiter bedingt werden, sich aber auch durch soziale oder kognitive Einflüsse verstärken. In solchen Situationen werden dann vielfach Berater in Anspruch genommen, denen Kompetenz in dieser Frage zugetraut wird. Die Lebensaspekte, die dabei berührt werden, reichen thematisch von der Ernährung über die Partnerschaft und Sexualität, bis hin zu Erziehungs- und Gesundheitsfragen, Schuldenberatung und vielen anderen mehr. Um Entscheidungshemmnisse aufzulösen, ist der Blick auf die maßgebenden Fak-toren wichtig, die sowohl die kognitive, als auch die emotive Seite betreffen. Dazu wird die Symbolik als Heuristik, wie sie in verschiedenen (tiefen-) psychologischen und soziologischen Theorien des letzten Jahrhunderts entwickelt worden ist, verstärkt in den Fokus genommen. Dies wird deshalb als wesentlich angesehen, weil sich in der kulturgeschichtlichen Entwicklung verschiedene Beratungsformen ausprägten, die auf einer symbolischen Basis entweder der konkrete Zukunftsdeutungen dienten oder aber zumindest Assoziationsmedien bereitstellten. Und so drückt KLEINING es für diese Arbeit brauchbar aus: "Daß bei der Bildung und der Entschlüsselung von Symbolen gesellschaftliche und individuell-psychische Bedingungen wirken, macht den Symbolbegriff zu einem zentralen sozialwissenschaftlichen Konzept." Ein Teil dieser symbolischen Techniken und Methoden, die noch heute zum Spektrum der so genannten Lebensberatung gehören, soll dann nachfolgend Gegenstand der Betrachtung sein.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Der Entscheider
- Handlungsintensität
- Tragweite der Entscheidungen
- Entscheidungshemmnisse
- Kognition und Emotion
- Symbol und Heuristik
- Kulturhistorische und gegenwärtige Formen der Entscheidungsfindung mittels Symbolsystemen
- Alternative Beratungsformen – Risiken und Nebenwirkungen?
- Empirische Implikationen – ein Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Entscheidungsfindungsprozesse und alternative Beratungsformen. Sie beleuchtet die verschiedenen Faktoren, die in Entscheidungssituationen eine Rolle spielen, von der individuellen Autonomie bis hin zu sozialen und institutionellen Kontexten. Ein besonderer Fokus liegt auf Entscheidungshemmnissen und der Rolle von Symbolen und Heuristik in der Entscheidungsfindung.
- Der Entscheider: Individuelle und soziale Aspekte der Entscheidungsfindung
- Entscheidungshemmnisse: Kognitive und emotionale Faktoren
- Symbol und Heuristik: Die Rolle von Symbolen in Entscheidungsfindungsprozessen
- Alternative Beratungsformen: Historische und gegenwärtige Ansätze
- Empirische Implikationen: Ausblick auf zukünftige Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen: Der einführende Abschnitt beleuchtet die Allgegenwärtigkeit von Entscheidungssituationen im Alltag und deren unterschiedliche Reichweiten und Verantwortlichkeiten. Er skizziert die zentralen Fragen der Arbeit: Wer entscheidet? Wie intensiv wird entschieden? Welche Auswirkungen haben Entscheidungen? Welche Faktoren hemmen Entscheidungen? Der Fokus liegt auf Entscheidungshemmnissen und der daraus resultierenden Inanspruchnahme von Beratungsleistungen in verschiedenen Lebensbereichen.
Der Entscheider: Dieses Kapitel betrachtet den Entscheider auf verschiedenen Ebenen: Mikroebene (Individuum), Mesoebene (Organisationen und Institutionen). Auf der Mikroebene wird die individuelle Autonomie und Autarkie des Entscheiders thematisiert. Auf der Mesoebene wird die zunehmende Komplexität von Entscheidungsprozessen aufgrund institutioneller Hierarchien und verfahrenstechnischer Prozesse hervorgehoben. Die soziale Einbettung der Entscheidung und der Einfluss des "Framings" auf die Entscheidungsfindung werden betont.
Schlüsselwörter
Entscheidungsfindungsprozesse, Entscheidungshemmnisse, alternative Beratungsformen, Symbol und Heuristik, kognitive und emotionale Faktoren, individuelle und soziale Aspekte, Autonomie, Autarkie, institutionelle Kontexte, Problemlösungsprozess.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entscheidungsfindungsprozesse und alternative Beratungsformen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Entscheidungsfindungsprozesse und alternative Beratungsformen. Sie beleuchtet die Faktoren, die in Entscheidungssituationen eine Rolle spielen, von individueller Autonomie bis zu sozialen und institutionellen Kontexten. Ein besonderer Fokus liegt auf Entscheidungshemmnissen und der Rolle von Symbolen und Heuristik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Der Entscheider (individuelle und soziale Aspekte), Entscheidungshemmnisse (kognitive und emotionale Faktoren), Symbol und Heuristik (deren Rolle in der Entscheidungsfindung), alternative Beratungsformen (historische und gegenwärtige Ansätze) und empirische Implikationen (Ausblick auf zukünftige Forschung).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Vorbemerkungen, dem Entscheider, Handlungsintensität, Tragweite der Entscheidungen, Entscheidungshemmnissen, Kognition und Emotion, Symbol und Heuristik, kulturhistorischen und gegenwärtigen Formen der Entscheidungsfindung mittels Symbolsystemen, alternativen Beratungsformen mit Risiken und Nebenwirkungen sowie empirischen Implikationen und einem Ausblick.
Was wird in den Vorbemerkungen behandelt?
Die Vorbemerkungen beleuchten die Allgegenwärtigkeit von Entscheidungssituationen, deren Reichweiten und Verantwortlichkeiten. Sie skizzieren zentrale Fragen: Wer entscheidet? Wie intensiv? Welche Auswirkungen haben Entscheidungen? Welche Faktoren hemmen Entscheidungen? Der Fokus liegt auf Entscheidungshemmnissen und der daraus resultierenden Inanspruchnahme von Beratungsleistungen.
Was ist der Fokus des Kapitels "Der Entscheider"?
Dieses Kapitel betrachtet den Entscheider auf Mikroebene (Individuum, Autonomie, Autarkie) und Mesoebene (Organisationen, Institutionen, Komplexität von Prozessen). Die soziale Einbettung der Entscheidung und der Einfluss des "Framings" werden betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entscheidungsfindungsprozesse, Entscheidungshemmnisse, alternative Beratungsformen, Symbol und Heuristik, kognitive und emotionale Faktoren, individuelle und soziale Aspekte, Autonomie, Autarkie, institutionelle Kontexte, Problemlösungsprozess.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Entscheidungsfindungsprozesse und alternative Beratungsformen, beleuchtet die verschiedenen Faktoren in Entscheidungssituationen und konzentriert sich auf Entscheidungshemmnisse und die Rolle von Symbolen und Heuristik.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die Inhalte jedes einzelnen Kapitels, von den einleitenden Vorbemerkungen bis hin zu den Schlussfolgerungen und dem Ausblick auf zukünftige Forschung.
- Arbeit zitieren
- Marion Röbkes (Autor:in), 2010, Entscheidungsfindungsprozesse und alternative Formen der Beratung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155358