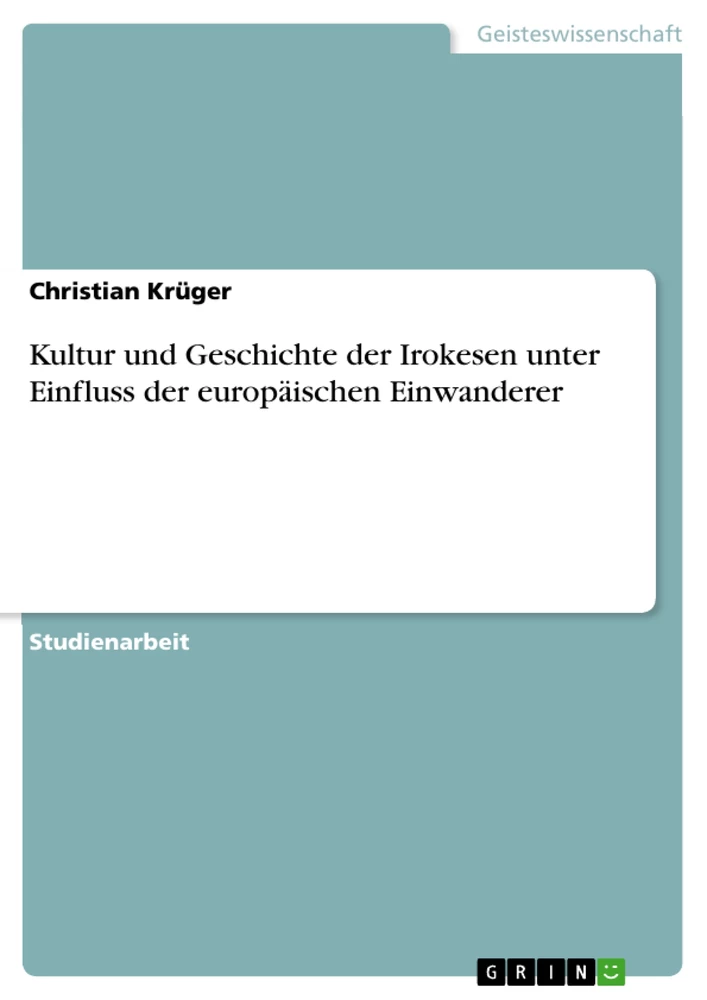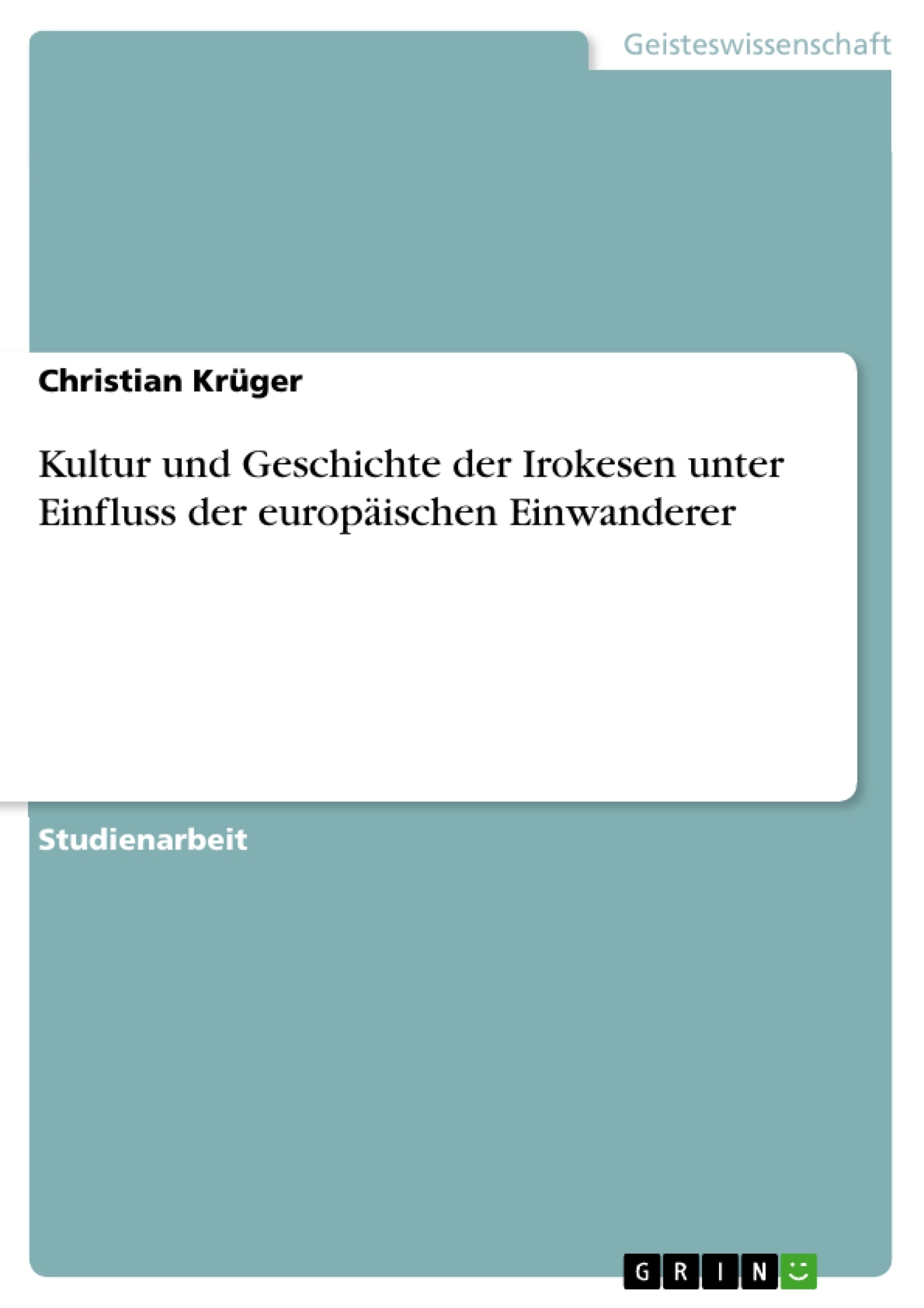1. Einleitung
2. Die Irokesen
2.1 Wohnverhältnisse
2.2 Ernährung und Landwirtschaft
2.3 Bekleidung
3. Familien- und Gesellschaftsstruktur der Irokesen
3.1 Struktur des Zusammenlebens
3.1.1 Ohwachira und Großfamilienhaushalt
3.1.2 Die Clans
3.1.3 Der Stamm
3.2 Gründung der Irokesenliga
4. Weltanschauung und Religion der Irokesen
4.1 Weltanschauung
4.2 Zeremonien
4.3 Maskentradition
4.4 Die Langhausreligion
5. Das Leben der Irokesen in der Kolonialzeit
5.1 Erste Kontakte mit den Einsiedlern durch den Handel
5.2 Begegnungen mit den Einsiedlern
5.3 Folgen der Begegnungen
5.4 Die Irokesenliga unter den europäischen Einwanderern
6. Das Leben der Irokesen in der Reservationszeit
6.1 Vertreibung der Irokesen
6.2 Das Leben in den Reservaten
7. Heutiges Leben der Irokesen
Literatur
Kultur und Geschichte der Irokesen unter Einfluss der europäischen Einwanderer
1. Einleitung
In der Geschichte der Amerikaner galten die Irokesen im 17. Jahrhundert als eine gefürchtete Kriegsmacht, der es gelang, während der Glanzzeit ihrer Macht fast den gesamten Osten der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika zu kontrollieren. Sie verstanden es nicht nur, sich zu koordinieren und sich mit anderen Stämmen zu verbünden, sondern gelang ihnen auch, dieses Bündnis Jahrhunderte lang aufrecht zu erhalten. „Die Irokesen standen durch ihre gesellschaftliche und politische Organisation an der Spitze aller Indianervölker Nordamerikas und übertrafen alle ohne Ausnahme durch den überraschenden Geist ihrer Staatskunst und die Erfolge ihrer Kriegsführung.“
Im Folgenden wird die Lebenssituation des Irokesenvolkes von seiner Entstehung bis zum heutigen Zeitpunkt erläutert und kommentiert. Es wird unter anderem verdeutlicht, wie sie ursprünglich wohnten, sich kleideten und ernährten und wie sie ihr Zusammenleben organisierten. Des Weiteren wird beschrieben, wie es den Irokesen durch die Bildung des oben genannten Bündnisses gelang, über Jahrhunderte hinweg zu überleben und sich gegen ihre Feinde durchzusetzen. Ein bedeutender Teil in der Geschichte des Irokesenstammes, der im Folgenden geschildert wird, ist der Einfluss der europäischen Einwanderer auf die ursprüngliche Lebenssituation der Irokesen. Dieser lang anhaltende Zusammenstoß zweier Rassen brachte Handel und Zusammenarbeit, aber auch Kriege und Gewalt hervor, aus denen die europäischen Einwanderer letztendlich als Sieger hervorgehen sollten.
Aus einer Vielzahl ....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Irokesen
- Wohnverhältnisse
- Ernährung und Landwirtschaft
- Bekleidung
- Familien- und Gesellschaftsstruktur der Irokesen
- Struktur des Zusammenlebens
- Ohwachira und Großfamilienhaushalt
- Die Clans
- Der Stamm
- Gründung der Irokesenliga
- Struktur des Zusammenlebens
- Weltanschauung und Religion der Irokesen
- Weltanschauung
- Zeremonien
- Maskentradition
- Die Langhausreligion
- Das Leben der Irokesen in der Kolonialzeit
- Erste Kontakte mit den Einsiedlern durch den Handel
- Begegnungen mit den Einsiedlern
- Folgen der Begegnungen
- Die Irokesenliga unter den europäischen Einwanderern
- Das Leben der Irokesen in der Reservationszeit
- Vertreibung der Irokesen
- Das Leben in den Reservaten
- Heutiges Leben der Irokesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung beleuchtet die Geschichte und Lebensweise des Irokesenvolkes von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Darstellung der Lebensverhältnisse, der gesellschaftlichen Strukturen, der Religion und der Auswirkungen des europäischen Einflusses auf die Irokesenkultur.
- Die Wohnverhältnisse und Lebensweise der Irokesen vor der Ankunft der Europäer
- Die soziale Organisation des Irokesenvolkes, einschließlich der Clan- und Stammesstrukturen
- Die traditionelle Religion und Weltanschauung der Irokesen
- Die Auswirkungen des europäischen Kolonialismus auf die Irokesen
- Die Situation der Irokesen in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen historischen Überblick über die Irokesen und hebt ihre Bedeutung als Kriegsmacht im 17. Jahrhundert hervor.
Kapitel 2 beschreibt die Wohnverhältnisse der Irokesen, ihre Ernährung und Landwirtschaft sowie ihre traditionelle Kleidung. Die Dörfer waren befestigt, die Häuser, sogenannte Langhäuser, boten mehreren Familien Platz. Die Irokesen betrieben einen erfolgreichen Ackerbau und ergänzten ihre Ernährung durch Jagd und Fischfang.
Kapitel 3 erläutert die Familien- und Gesellschaftsstruktur der Irokesen. Es wird die Organisation des Zusammenlebens innerhalb der Ohwachiras, Clans und Stämme sowie die Gründung der Irokesenliga beschrieben.
Kapitel 4 befasst sich mit der Weltanschauung und Religion der Irokesen. Es werden ihre spirituellen Überzeugungen, Zeremonien, Maskentradition und die Bedeutung der Langhausreligion behandelt.
Kapitel 5 schildert den Einfluss der europäischen Einwanderer auf das Leben der Irokesen. Es werden die ersten Kontakte durch den Handel, die Begegnungen und die Folgen der kolonialen Ausbreitung sowie die Auswirkungen auf die Irokesenliga behandelt.
Kapitel 6 beschreibt die Vertreibung der Irokesen und ihr Leben in den Reservaten.
Schlüsselwörter
Die Ausarbeitung befasst sich mit den Irokesen, einem indigenen Volk Nordamerikas, und deren Kultur, Geschichte und Gesellschaft. Wichtige Themen sind die Lebensweise, die gesellschaftliche Organisation, die Religion und die Auswirkungen der europäischen Kolonialisierung. Weitere wichtige Begriffe sind Langhäuser, Clans, Irokesenliga, Weltanschauung, Zeremonien und Reservationszeit.
- Arbeit zitieren
- Soz.Päd./Soz.Arb. (B.A.) Christian Krüger (Autor:in), 2008, Kultur und Geschichte der Irokesen unter Einfluss der europäischen Einwanderer , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155404