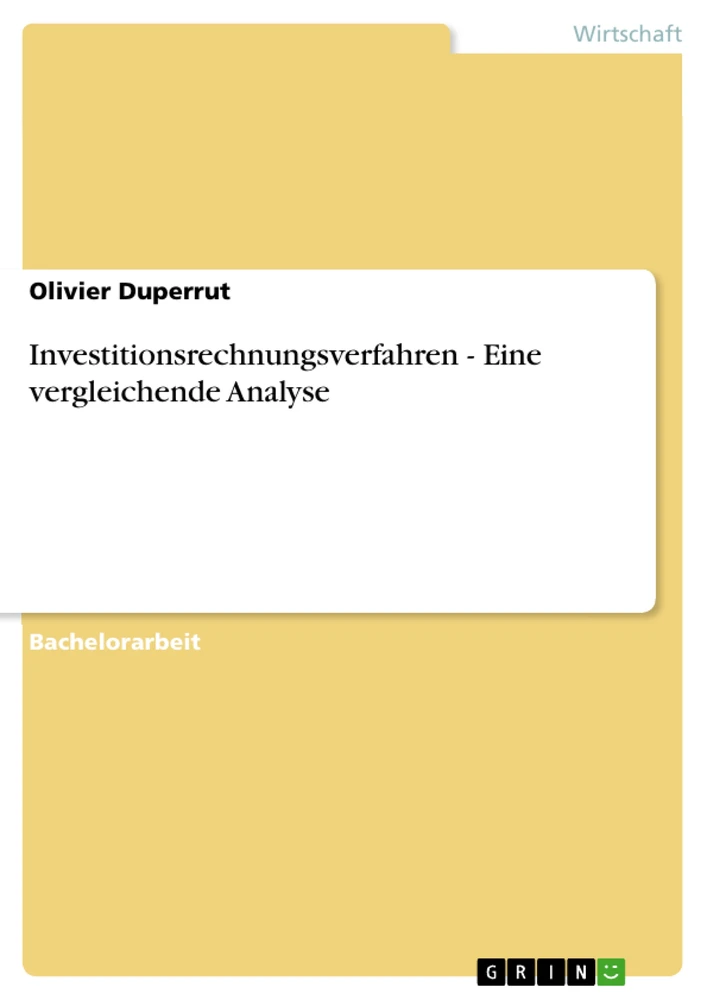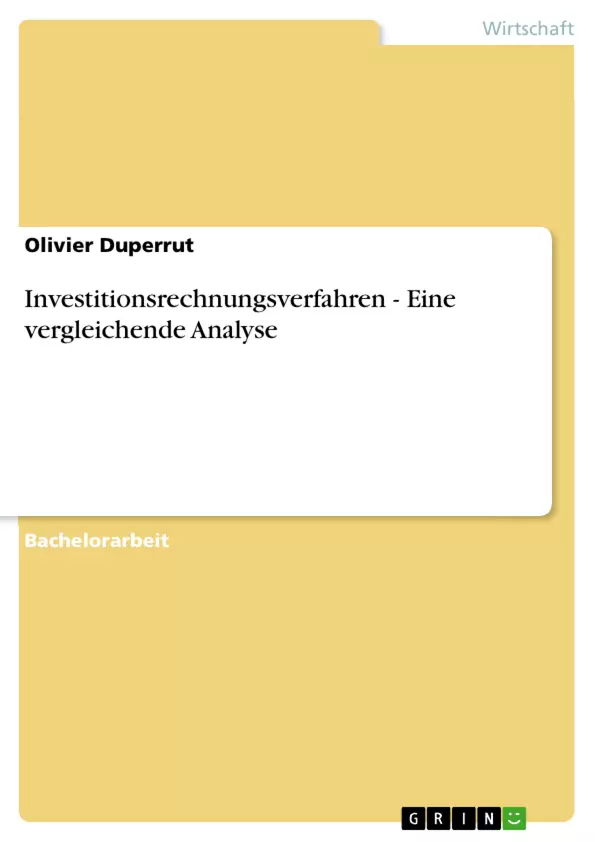Investition ist in der heutigen Zeit ein viel verwendetes Schlagwort. Alle können sich irgendetwas darunter vorstellen. Zum Beispiel kann das Ausgeben von größeren Geldsummen als Ausgabe oder Investition klassiert werden. Der Kauf einer Homecinema-Anlage stellt beispielsweise eine Ausgabe dar. Die Kosten für einen Weiterbildungskurs sind hingegen eine Investition, da sie im Gegensatz zur Homecinema-Anlage einen messbaren Nutzen in Form von mehr Lohn stiftet. Eine Investition soll also nicht nur Kosten verursachen, sondern auch einen Vorteil verschaffen. Ein möglicher Grundsatz kann dabei sein, heute auf etwas zu verzichten, um morgen mehr zu erhalten. Sowohl die Kosten als auch die Vorteile müssen nicht unbedingt einen materiellen Wert haben. Denkbar ist die Investition von Zeit in ein Projekt, wobei der erzielte Vorteil Anerkennung oder ein gutes Gefühl sein kann.
Besonders in Unternehmen ist das Tätigen von Investitionen von zentraler Bedeutung. Ohne Investitionen wären weder Fortschritt noch Wachstum möglich. Um langfristig wirtschaftliche Ziele verfolgen zu können, muss Geld zum Beispiel in Maschinen investiert werden, um eine gewinnbringende Produktion zu ermöglichen. Dabei wird im Fall von Sachinvestitionen zwischen Ersatz-, Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestitionen unterschieden. Daneben existieren noch die Finanzinvestitionen und die immateriellen Investitionen.
Es ist also eine heikle Frage, wann welches Investitionsrechnungsverfahren verwendet werden soll, da die Wahl des Verfahrens das Ergebnis beeinflussen kann. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dieser Problematik und vergleicht die verschiedenen Verfahren miteinander. Ziel dieses Vergleichs ist das Aufzeigen von Vor- und Nachteilen der Verfahren in verschiedenen Situationen und das Erkennen von Zusammenhängen und Unterschieden zwischen den Verfahren. Dabei konzentriert sich diese Arbeit auf Sachinvestitionen und lässt Finanzinvestitionen und immaterielle Investitionen außer Acht.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Zuerst wird in Kapitel 2 die Investitionsrechnung im Allgemeinen erklärt. Anschließend werden in Kapitel 3 die statischen und in Kapitel 4 die dynamischen Investitionsrechnungsverfahren erläutert. Abschließend werden in Kapitel 5 noch die Investitionsrechnungsverfahren bei Unsicherheit thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Investitionsrechnung
- Definition und Einordnung der Investitionsrechnung
- Verfahren der Investitionsrechnung
- Statische Investitionsrechnungsverfahren
- Kostenvergleichsrechnung
- Gewinnvergleichsrechnung
- Renditenvergleichsrechnung
- Amortisationsvergleichsrechnung
- Vergleich der statischen Investitionsrechnungsverfahren
- Dynamische Investitionsrechnungsverfahren
- Kapitalwertmethode
- Annuitätenmethode
- Interne Zinsfussmethode
- Vergleich der dynamischen Investitionsrechnungsverfahren
- Investitionsrechnungsverfahren bei Unsicherheit
- Korrekturverfahren
- Sensitivitätsanalyse
- Risikoanalyse
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Vergleich der Investitionsrechnungsverfahren bei Unsicherheit
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse und dem Vergleich verschiedener Investitionsrechnungsverfahren. Das Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Verfahren in verschiedenen Situationen aufzuzeigen sowie Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den Verfahren aufzudecken. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf Sachinvestitionen und lässt Finanzinvestitionen sowie immaterielle Investitionen ausser Acht.
- Definition und Einordnung der Investitionsrechnung
- Vergleich statischer und dynamischer Verfahren
- Analyse der einzelnen Investitionsrechnungsverfahren
- Bewertung von Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit
- Vergleich der Investitionsrechnungsverfahren bei Unsicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 erläutert die Investitionsrechnung im Allgemeinen, ihre Definition und Einordnung in den betriebswirtschaftlichen Kontext. In Kapitel 3 werden die statischen Investitionsrechnungsverfahren behandelt, die sich durch ihre einfache Berechnung auszeichnen. Die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Renditenvergleichsrechnung und die Amortisationsvergleichsrechnung werden detailliert vorgestellt und miteinander verglichen. Kapitel 4 befasst sich mit den dynamischen Investitionsrechnungsverfahren, die die Zeitwertanalyse berücksichtigen und somit eine genauere Aussage über die Vorteilhaftigkeit einer Investition ermöglichen. Die Kapitalwertmethode, die Annuitätenmethode und die Interne Zinsfussmethode werden erklärt und ihre Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. Kapitel 5 widmet sich dem Thema der Investitionsrechnung bei Unsicherheit. Es werden verschiedene Verfahren zur Berücksichtigung von Risiken und Unsicherheiten vorgestellt, wie Korrekturverfahren, Sensitivitätsanalyse, Risikoanalyse und das Capital Asset Pricing Model (CAPM). Abschliessend werden die verschiedenen Verfahren bei Unsicherheit miteinander verglichen.
Schlüsselwörter
Investitionsrechnung, statische Verfahren, dynamische Verfahren, Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode, Interne Zinsfussmethode, Kostenvergleichsrechnung, Gewinnvergleichsrechnung, Renditenvergleichsrechnung, Amortisationsvergleichsrechnung, Unsicherheit, Risikoanalyse, Sensitivitätsanalyse, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen statischen und dynamischen Investitionsrechnungsverfahren?
Statische Verfahren sind einfach zu berechnen, vernachlässigen aber den Zeitwert des Geldes. Dynamische Verfahren berücksichtigen Zinseszinseffekte und den Zeitpunkt der Zahlungsströme.
Nennen Sie Beispiele für statische Verfahren.
Dazu gehören die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Renditenvergleichsrechnung und die Amortisationsvergleichsrechnung.
Was ist die Kapitalwertmethode?
Ein dynamisches Verfahren, bei dem alle zukünftigen Ein- und Auszahlungen auf den Barwert (Gegenwartswert) abgezinst werden, um die Rentabilität zu prüfen.
Wie wird Unsicherheit in der Investitionsrechnung berücksichtigt?
Durch Methoden wie die Sensitivitätsanalyse, Risikoanalyse, Korrekturverfahren oder das Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Was ist eine Rationalisierungsinvestition?
Eine Investition, die darauf abzielt, Kosten zu senken und die Effizienz bestehender Prozesse zu steigern.
- Quote paper
- Olivier Duperrut (Author), 2007, Investitionsrechnungsverfahren - Eine vergleichende Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155411