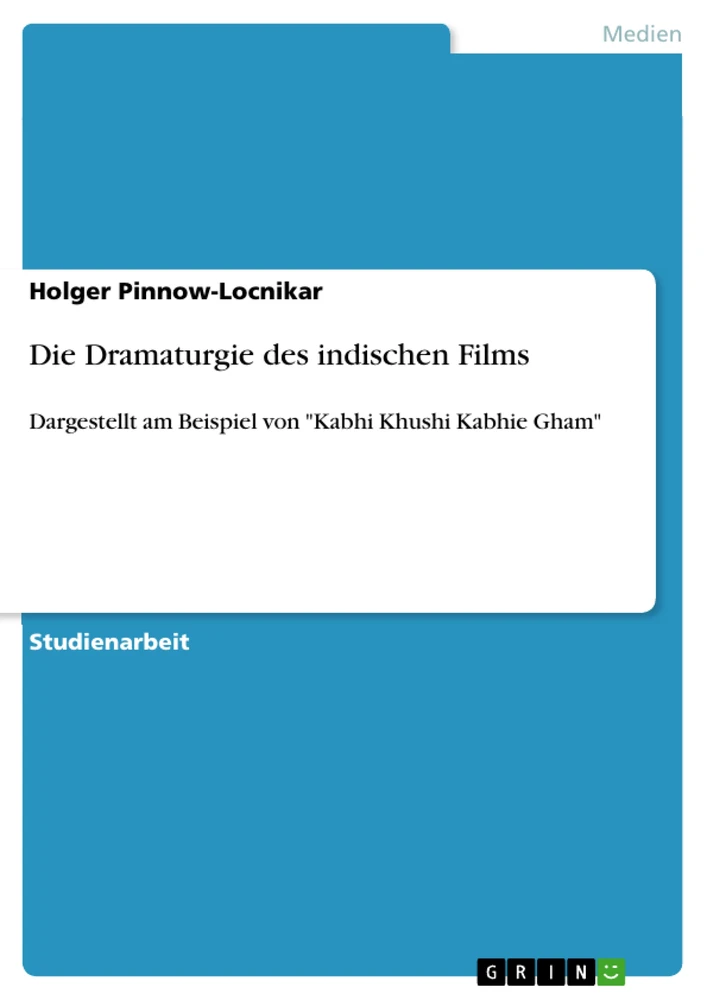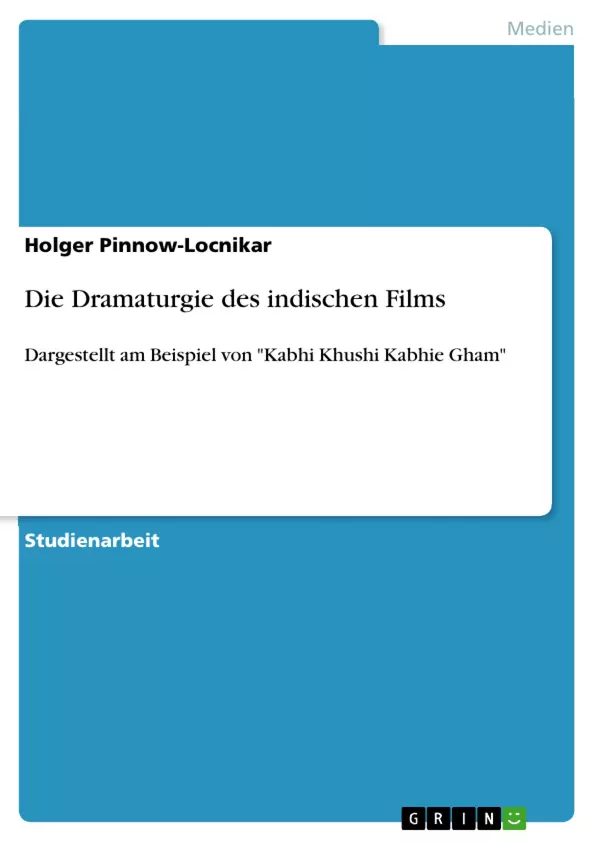Wer nur einmal einen modernen Film des indischen Populärkinos gesehen hat, dem wird eine eigentümliche Erfahrung zuteil. Diese besteht aus mehreren miteinander konkurrierenden Eindrücken: Zunächst stellt man fest, dass man soeben gut drei Stunden im Kino verbracht hat, ohne es recht bemerkt zu haben. Außerdem hat man das Gefühl, einen Film gesehen zu haben, zu dem im ersten Moment nur negativ konnotierte Beschreibungsformeln einfallen wollen: „Schmonzette“, Tanzfilm, Heimatfilm, Liebesmärchen, „Soap Opera“ – und sich dabei dennoch köstlich amüsiert zu haben.
Gegenwärtig ist ein Trend zu beobachten, vermehrt „indische Elemente“ auch in westlichen Film- und Theaterproduktionen zu verarbeiten. Diese als „Bollywood-Chic“ bezeichnete Tendenz hat Züge des Orientalismus des 19. Jahrhunderts, oder vereinfacht gesagt: Wenn man das Exotische einer fremden Kultur für die westlichen Sehgewohnheiten auf Hochglanz poliert, wird es für eine Gesellschaft, die des eigenen kulturellen Mainstreams überdrüssig wird, erst richtig interessant.
Was macht diese eigentümliche Faszination eines Bollywood-Films aus? Was reizt an einem Film, in dem „die Protagonisten unversehens und ohne Not und direkten Anlass ins Singen und Tanzen geraten“, wie es die Schweizer Filmwissenschaftlerin Dr. Alexandra Schneider ausdrückt? Diese Arbeit spürt diesem Phänomen nach und beleuchtet insbesondere die Dramaturgie, den Spannungsbogen, der dieses Konglomerat stilistischer Mittel zusammenschweißt zu einem rezeptiven Erlebnis, das den Betrachter über gut drei Stunden fesselt und auch hinterher einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Als Beispiel dient dafür in erster Linie der Film "Kabhi Khushi Kabhie Gham", der 2001 gedreht wurde und als erster Film aus Bollywood in die deutschen Programmkinos kam. Nachdem der Film dort nur mit deutschen Untertiteln zu sehen war, brachte ein Privatsender 2004 eine vollständig synchronisierte Fassung mit dem deutschen Titel „In guten wie in schweren Tagen“ ins Fernsehen. Damit dürfte „Kabhi Khushi Kabhie Gham“, was richtig übersetzt „Manchmal glücklich, manchmal traurig“ heißt, der bis dahin international erfolgreichste indische Film sein, der auch in Indien mit seinem enormen Staraufgebot zu einem „Gassenhauer“ wurde.
Ende Februar 2005 sendete außerdem „arte“ anlässlich des 100sten Geburtstags des indischen Films eine ganze Reihe neuerer indischer Filme und auch mehrere Dokumentationen, die auch in dieser Arbeit berücksichtigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Einführung
- Thematische Bestimmung
- Anmerkungen zur Gegenwartskultur Indiens
- Zur Geschichte des indischen Mainstream-Films
- Über die Besonderheiten der indischen Film- und Kinokultur
- Ein Wort zur Zensur
- Kabhi Khushi Kabhie Gham – eine kurze Inhaltsangabe...
- Über den typischen Aufbau eines indischen Mainstream-Films
- Typische dramaturgische Elemente
- Exkurs: Das Sanskrit-Drama im Beispiel
- Weitere dramaturgische Elemente
- Gesang und Tanz
- Hintergrundmusik
- Die,,rasas“
- Das Schicksal
- Die Verbundenheit im Geist
- Die Hochzeit..
- Das religiöse Ritual
- Wetter
- Tränen...
- Dramaturgische Funktion und Konzeption
- Traditionelle Rollenverteilungen....
- Handlungsraum „Familie“
- Figurennamen als Charakterstereotypen
- Die Figur der Mutter
- Das Adoptivkind
- Klassische dramatische Struktur
- Kabhi Khushi Kabhie Gham -Vorbemerkungen
- Kabhi Khushi Kabhie Gham - Szenen und Kommentare
- Grundkonstellation
- 01 Vorspann (00:00:55 - 00:04:20)
- 02 London, Manor House College (00:04:20 - 00:07:31)
- Anmerkungen (Szenen 01 und 02)
- 03 Hardwar, in einem Tempel (00:07:31 - 00:13:05)...
- Anmerkungen (Szene 03)...
- 04 Rückblende: Das Lichterfest (00:13:06 - 00:20:29)
- Anmerkungen (Szene 04)...
- 05 Familienleben / Das Versprechen (00:20:30 - 00:26:30)
- Anmerkungen (Szene 05)......
- 06 Anjali (00:26:30 - 00:30:36)
- Anmerkungen (Szene 06)...
- 07 Rahul und Naina / Ein erster Disput (00:30:37 – 00:33:16)
- Anmerkungen (Szene 07)...
- 08 Anjali und Rahul (00:33:17 – 00:40:59)
- Anmerkungen (Szene 08)...
- 09 Der 50. Geburtstag (00:41:00 – 00:51:57)
- 10 Die Entschuldigung (00:51:58 – 00:54:46)
- 11 Schulstress (00:54:47 - 00:55:42)
- 12 Die Versöhnung (00:55:43 – 00:58:14)
- 13 Volksfest in Ägypten (00:58:15 – 01:10:14)
- Anmerkungen (Szene 13)...
- 14 Dissonanzen (01:10:14 - 01:14:15)
- 15 Die Hochzeit (01:14:16 - 01:20:41)...
- 16 Naina gibt Rahul frei (01:20:42 - 01:23:27)
- 17 Liebe oder Gehorsam (01:23:28 – 01:24:52)
- 18 Die Liebe und der Tod (01:24:53 - 01:27:28)
- Anmerkungen (Szenen 14 bis 18)
- 19 Verstoßen (01:27:29 - 01:37:25)
- Anmerkungen (Szene 19)
- 20 Abschied von Rohan (01:37:26 - 01:38:47)
- Anmerkungen (Szene 20)...
- 21 Zurück in der Gegenwart (01:38:48 - 01:39:06)
- 22 Der Entschluss (01:39:07 - 01:40:59)...
- Anmerkungen (Szene 22)
- 23 Veränderungen (01:41:03 - 01:41:50)
- 24 Nachforschungen (01:41:51 - 01:43:55)
- 25 Abschied (01:43:45 - 01:46:34)...
- 26 London (01:46:34 - 01:49:01)
- 27 Rahuls neues Leben (01:49:02 - 01:54:35)
- 28 Das Wiedersehen (01:54:36 - 02:04:52)
- 29 Der Fremde (02:04:53 -02:11:49)
- 30 Annäherung (02:11:50 - 02:17:51)
- 31 King's College Party (02:17:52 - :02:27:40)
- 32 Väter (02:27:41 - 02:32:21)...
- 33 Karwa Chauth (02:32:21 - 02:36:43)
- 34 Das Fest (02:36:44 - 02:42:20)
- 35 Schulfest (02:42:21 - 02:57:01)
- 36 Brüder (02:57:02 – 03:00:28)
- 37 Der Lockvogel (03:00:28 – 03:01:50)...
- 38 Bluewater Einkaufszentrum (03:01:50 - 03:07:12)
- 39 Starrköpfigkeit (03:07:13 - 03:11:45)...
- 40 Höhere Gewalt (03:11:45 -03:13:31)
- 41 Abrechnung (03:13:32 - 03:19:30)
- 42 Happy End (03:19:31 – 03:28:05)
- Abspann (03:28:06 - 03:30:04)...
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Dramaturgie des modernen indischen Mainstream-Films anhand des Beispiels von Kabhi Khushi Kabhie Gham zu untersuchen und zu analysieren. Dabei soll die besondere Kombination aus traditionellen indischen Elementen und Einflüssen aus der westlichen Filmkultur beleuchtet werden.
- Die Geschichte und Entwicklung des indischen Mainstream-Films
- Die Rolle der Kultur und Religion in der indischen Filmindustrie
- Typische Elemente der Dramaturgie des indischen Mainstream-Films, wie Gesang, Tanz und die „rasas“
- Die Funktion von traditionellen Rollenverteilungen und Familienstrukturen in indischen Filmen
- Die Einbindung von westlichen Filmelementen und ihre Auswirkungen auf die Dramaturgie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Besonderheiten des indischen Mainstream-Films beleuchtet und den Fokus auf die Dramaturgie legt. Anschließend wird in Kapitel 2 die Thematische Bestimmung der Arbeit erläutert und der Einfluss der indischen Gegenwartskultur auf den Film dargestellt. Kapitel 3 gibt einen Einblick in die Geschichte und Kultur Indiens, um den Kontext für die Analyse des Films Kabhi Khushi Kabhie Gham zu schaffen. Die Kapitel 4 bis 10 befassen sich mit den Besonderheiten der indischen Film- und Kinokultur, sowie mit der Analyse typischer dramaturgischer Elemente, wie Gesang, Tanz und der „rasas“ sowie der klassischen dramatischen Struktur.
Die Kapitel 11 bis 42 analysieren die Szenen von Kabhi Khushi Kabhie Gham im Detail und zeigen, wie die einzelnen Elemente der Dramaturgie zusammenspielen, um die Geschichte zu erzählen und die Zuschauer zu fesseln.
Schlüsselwörter
Indischer Mainstream-Film, Bollywood, Dramaturgie, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Gesang, Tanz, „rasas“, Familienstruktur, Tradition, Modernität, Kultur, Religion.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet die Dramaturgie eines Bollywood-Films?
Typisch ist eine Mischung aus Melodram, Musik- und Tanzeinlagen sowie die Integration traditioneller indischer Werte und religiöser Rituale.
Welcher Film dient in der Arbeit als Hauptbeispiel?
Der Film „Kabhi Khushi Kabhie Gham“ (In guten wie in schweren Tagen) aus dem Jahr 2001.
Was sind „rasas“ im indischen Film?
Rasas sind emotionale Essenzen oder Stimmungen (wie Liebe, Zorn oder Mitleid), die gezielt eingesetzt werden, um beim Zuschauer eine bestimmte Wirkung zu erzielen.
Warum sind Gesang und Tanz so wichtig?
Sie dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern treiben oft die Handlung voran oder drücken Gefühle aus, die nicht in Worte gefasst werden können.
Welche Rolle spielt die Familie in indischen Mainstream-Filmen?
Die Familie ist der zentrale Handlungsraum; Konflikte zwischen Gehorsam gegenüber den Eltern und individueller Liebe sind ein Kernmotiv.
Wie unterscheidet sich indisches Kino vom westlichen Mainstream?
Durch die Überlänge (oft über 3 Stunden), die episodische Struktur und die bewusste Verknüpfung von Realität mit märchenhaften Elementen.
- Quote paper
- Holger Pinnow-Locnikar (Author), 2005, Die Dramaturgie des indischen Films, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155421