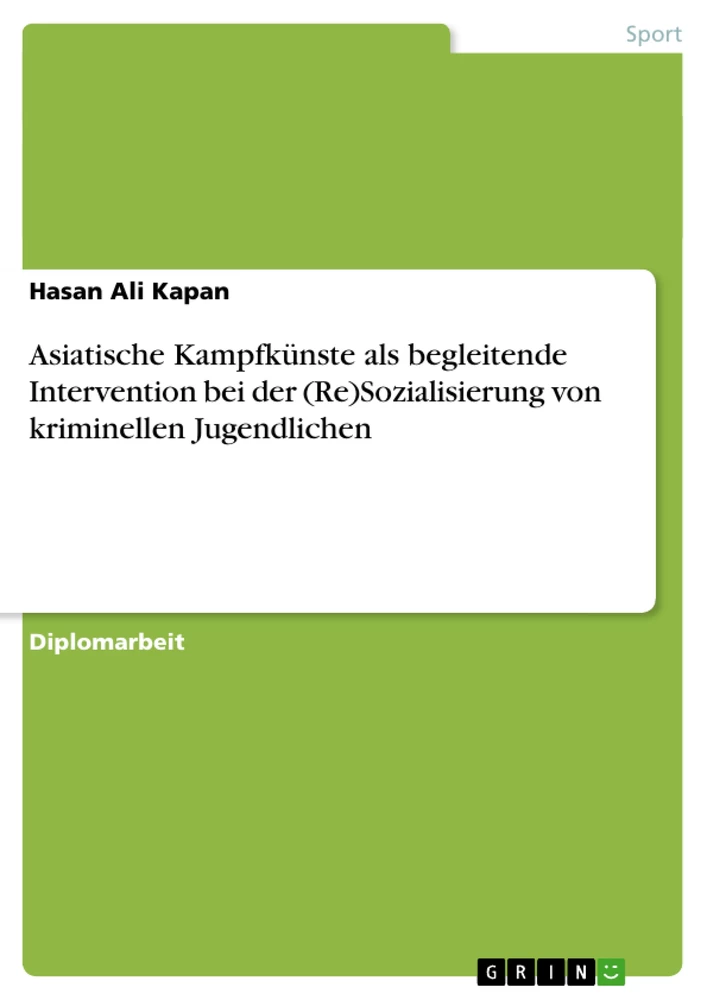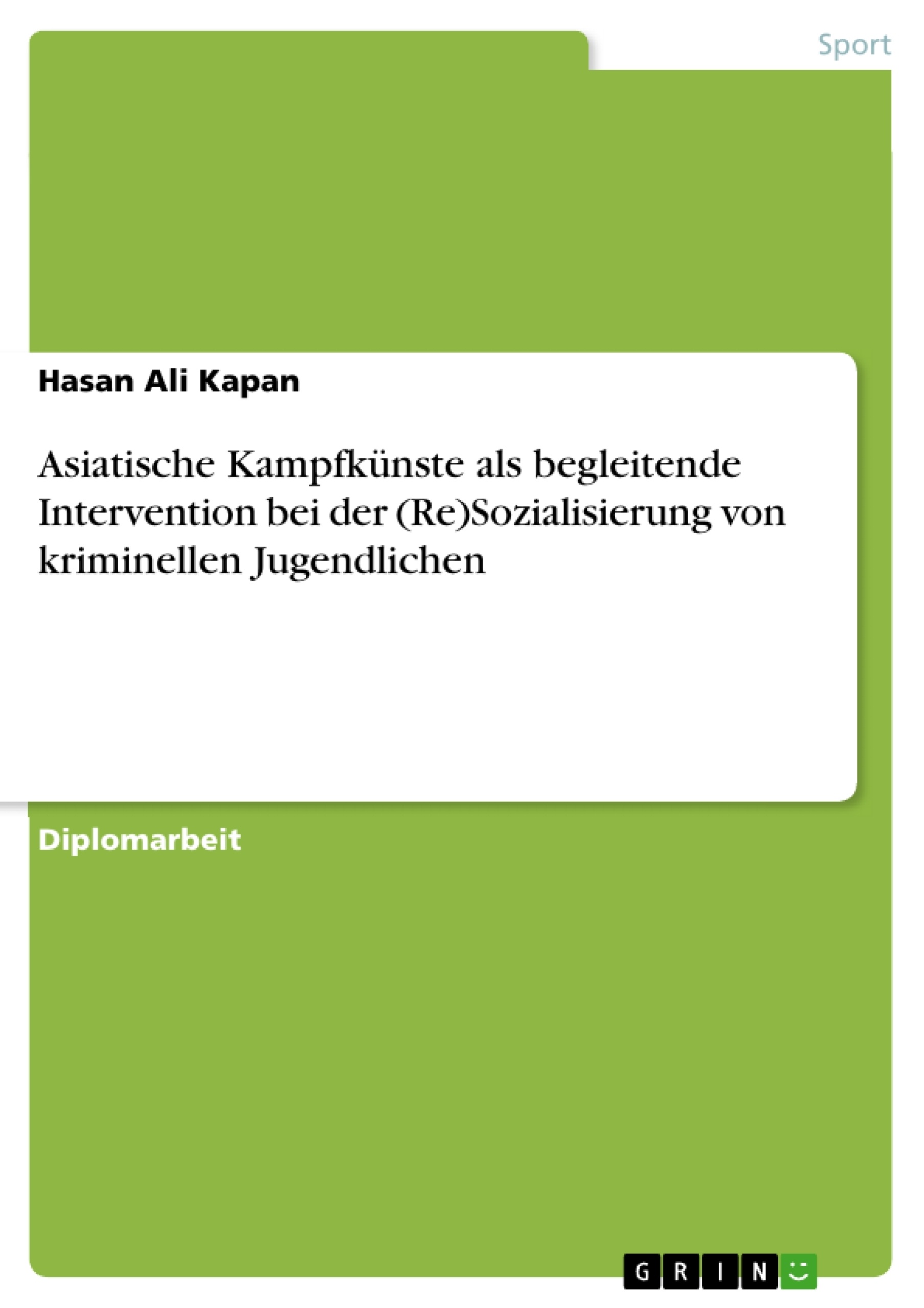Ziel dieser vorliegenden Arbeit besteht darin einen Überblick über die Alternativen Möglichkeiten aufzuzeigen die sich mit Hilfe asiatischer Kampfkünste auf die Resozialisierung von kriminellen Jugendlichen ergeben.
Zu Beginn der Arbeit werden die Begriffe, Jugendkriminalität und Resozialisierung veranschaulicht, wobei sich hier die Thematik auf die sozialen Ursachen beschränken bzw. eingegangen wird. Weiters werden unterschiedlichen Ansätze zu „Kriminalitätstheorien“ behandelt, welche für die Wirkung; „Sport als erzieherische Maßnahme“ hilfreich sein können.
Weiters werden die philosophischen Hintergründe der asiatischen Kampfkunst sowie die wichtigsten Elemente des Karatedô erläutert.
Im nächsten Abschnitt wird das Themenfeld „asiatische Kampfkunst“ charakterisiert, wobei hier auf die einzelnen Aspekte eingegangen wird die in Bezug auf die Resozialisierung stehen. Diese beinhalten; Gewalt zu reduzieren, negative Aggression zu kontrollieren, sowie eine individuelle Persönlichkeit zu entwickeln welche eine Balance hinsichtlich der Gerechtigkeit zwischen Bedürfnissen und Anspruch stellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jugendkriminalität
- 2.1 Was versteht man unter Jugendkriminalität?
- 2.2 Jugendkriminalität in unserer Gesellschaft
- 3. Kriminalitätstheorien
- 3.1 Psychoanalytischer Ansatz
- 3.2 Frustrations-Aggressions-Hypothese
- 3.3 Familie, Erziehungsstil und psychoanalytische Theorie nach Richter
- 3.4 Die Anomietheorie von Merton
- 3.5 Theorie der Differentiellen Assoziation nach Sutherland
- 3.6 Theorie der differentiellen Gelegenheiten nach Cloward/Ohlin
- 3.7 Theorien des Labeling Approach
- 3.8 Multikausalität als Erklärungsmodell
- 4. Resozialisierung
- 4.1 Resozialisierung und Sport
- 4.2 Ausgleich gegenüber den Wirkungen des Strafvollzugs
- 4.2.1 Sport als Lern- und Erfahrungsfeld
- 4.3 Anschluss an die Außenwelt
- 4.3.1 Glenn Mills School
- 5. Asiatische Kampfkünste
- 5.1 Die Entwicklung der Kampfkünste
- 5.1.1 Einfluss von Yoga
- 5.1.2 Einfluss des Tao
- 5.2 Unterschied Kampfkunst / Kampfsport
- 5.3 Budôpädagogik und Ihre Entwicklung
- 5.3.1 Die Überlieferung der Lehre
- 5.3.2 Die rechte Haltung
- 5.3.3 Dōjōkun – die Regeln des Budô
- 5.3.3.1 Die Suche nach dem vollkommenen Charakter
- 5.3.3.2 Der rechte Weg der Wahrheit
- 5.3.3.3 Verwirklichung seiner persönlichen Lebensziele
- 5.3.3.4 Die Grundregeln der Etikette ehren
- 5.3.3.5 Verzicht auf Gewalt
- 6. Asiatische Kampfkünste als begleitende Intervention
- 6.1 Welche Bedeutung nimmt die Kampfkunst ein?
- 6.2 Shorinji-Ryu (Karate-dô) als praktische Behandlungsmaßnahme
- 6.2.1 Bewegungs- und Zweikampfspiele
- 6.2.2 Chinesische Gymnastik und Yoga
- 6.2.3 Kihon die Grundschule
- 6.2.3.1 Stellungen (Tachikata)
- 6.2.3.2 Arm und Beintechniken
- 6.2.4 Kata – die Bewegungsabläufe
- 6.2.5 Kumite - der Kampf
- 6.2.6 T'ai Chi Meditative Bewegung
- 6.2.7 Za-Zen Meditative Versenkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Jugendkriminalität und asiatischen Kampfkünsten im Kontext der Resozialisierung. Ziel ist es, alternative Ansätze zur Bekämpfung von Jugendkriminalität aufzuzeigen und die potenziellen positiven Effekte asiatischer Kampfkünste in diesem Bereich zu beleuchten.
- Jugendkriminalität und deren Ursachen
- Kriminalitätstheorien und deren Relevanz für die Jugendkriminalität
- Resozialisierungsmöglichkeiten und die Rolle des Sports
- Asiatische Kampfkünste: Geschichte, Prinzipien und pädagogische Anwendung
- Asiatische Kampfkünste als Intervention in der Resozialisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die These auf, dass asiatische Kampfkünste einen positiven Beitrag zur Resozialisierung Jugendlicher leisten können. Sie begründet die Notwendigkeit alternativer Ansätze zur Bekämpfung von Jugendkriminalität, da herkömmliche Strafmaßnahmen oft ineffektiv sind. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Ziele der folgenden Kapitel.
2. Jugendkriminalität: Dieses Kapitel beleuchtet das Phänomen der Jugendkriminalität und diskutiert die Herausforderungen, die sie für die Gesellschaft darstellt. Es werden kritische Fragen bezüglich der Wirksamkeit harter Strafen aufgeworfen und die Notwendigkeit präventiver und resozialisierender Maßnahmen betont. Die zunehmende Gewaltbereitschaft Jugendlicher wird im Kontext mangelnder positiver Vorbilder und familiärer Schwierigkeiten diskutiert, wobei die Rolle des Staates als Verantwortungsträger hervorgehoben wird.
3. Kriminalitätstheorien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien zur Erklärung von Kriminalität, darunter psychoanalytische Ansätze, die Frustrations-Aggressions-Hypothese und soziologische Theorien wie die Anomietheorie Mertons, die Theorie der differentiellen Assoziation Sutherlands und die Theorie der differentiellen Gelegenheiten von Cloward/Ohlin. Der Labeling Approach und das Konzept der Multikausalität werden ebenfalls diskutiert, um ein umfassendes Verständnis der komplexen Ursachen von Kriminalität zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Theorien auf das Phänomen der Jugendkriminalität.
4. Resozialisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Resozialisierung und untersucht die Rolle des Sports in diesem Prozess. Es wird argumentiert, dass Sport als Lern- und Erfahrungsfeld einen positiven Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und zur sozialen Integration leisten kann. Der Ausgleich gegenüber den negativen Wirkungen des Strafvollzugs wird ebenso wie der Anschluss an die Außenwelt thematisiert. Das Beispiel der Glenn Mills School dient als Illustration erfolgreicher resozialisierender Maßnahmen.
5. Asiatische Kampfkünste: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und die Geschichte der asiatischen Kampfkünste, ihre philosophischen Grundlagen und den Unterschied zwischen Kampfkunst und Kampfsport. Es wird die Budôpädagogik und ihre Prinzipien detailliert dargestellt, einschließlich der Regeln des Dōjōkun und ihrer Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung. Das Kapitel legt den Schwerpunkt auf die Gewaltvermeidung und Selbstdisziplin als zentrale Aspekte der Kampfkünste.
6. Asiatische Kampfkünste als begleitende Intervention: Dieses Kapitel untersucht den Einsatz asiatischer Kampfkünste als Intervention in der Resozialisierung Jugendlicher. Es analysiert die Bedeutung der Kampfkünste in diesem Kontext und präsentiert Shorinji-Ryu (Karate-dô) als Beispiel für eine praktische Behandlungsmaßnahme. Die verschiedenen Aspekte des Karate-Trainings, wie Bewegungs- und Zweikampfspiele, chinesische Gymnastik, Yoga, Kihon, Kata, Kumite, T'ai Chi und Za-Zen, werden als Methoden der Selbstfindung, Disziplin und Gewaltprävention vorgestellt.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Kriminalitätstheorien, Resozialisierung, Sport, Asiatische Kampfkünste, Budôpädagogik, Gewaltprävention, Selbstdisziplin, Shorinji-Ryu, Karate-dô, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Jugendkriminalität und Asiatische Kampfkünste in der Resozialisierung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Jugendkriminalität und asiatischen Kampfkünsten im Kontext der Resozialisierung. Sie beleuchtet alternative Ansätze zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und die potenziellen positiven Effekte asiatischer Kampfkünste in diesem Bereich.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Jugendkriminalität und deren Ursachen, verschiedene Kriminalitätstheorien, Resozialisierungsmöglichkeiten und die Rolle des Sports, die Geschichte und Prinzipien asiatischer Kampfkünste, sowie deren pädagogische Anwendung und ihren Einsatz als Intervention in der Resozialisierung.
Welche Kriminalitätstheorien werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Kriminalitätstheorien, darunter psychoanalytische Ansätze, die Frustrations-Aggressions-Hypothese, die Anomietheorie Mertons, die Theorie der differentiellen Assoziation Sutherlands, die Theorie der differentiellen Gelegenheiten von Cloward/Ohlin, den Labeling Approach und das Konzept der Multikausalität.
Welche Rolle spielt der Sport in der Resozialisierung?
Die Arbeit argumentiert, dass Sport als Lern- und Erfahrungsfeld einen positiven Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und sozialen Integration leisten kann und als Ausgleich gegenüber negativen Wirkungen des Strafvollzugs dient. Die Glenn Mills School wird als Beispiel für erfolgreiche resozialisierende Maßnahmen genannt.
Was wird über asiatische Kampfkünste beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung und Geschichte asiatischer Kampfkünste, ihre philosophischen Grundlagen und den Unterschied zwischen Kampfkunst und Kampfsport. Die Budôpädagogik und ihre Prinzipien, einschließlich der Regeln des Dōjōkun, werden detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf Gewaltvermeidung und Selbstdisziplin.
Wie werden asiatische Kampfkünste als Intervention eingesetzt?
Die Arbeit untersucht den Einsatz asiatischer Kampfkünste als Intervention in der Resozialisierung. Shorinji-Ryu (Karate-dô) wird als Beispiel vorgestellt, wobei verschiedene Aspekte des Karate-Trainings (Bewegungsspiele, chinesische Gymnastik, Yoga, Kihon, Kata, Kumite, T'ai Chi, Za-Zen) als Methoden der Selbstfindung, Disziplin und Gewaltprävention präsentiert werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendkriminalität, Kriminalitätstheorien, Resozialisierung, Sport, Asiatische Kampfkünste, Budôpädagogik, Gewaltprävention, Selbstdisziplin, Shorinji-Ryu, Karate-dô, Prävention, Intervention.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Jugendkriminalität, Kriminalitätstheorien, Resozialisierung, asiatischen Kampfkünsten und deren Einsatz als Intervention, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Ein Inhaltsverzeichnis erleichtert die Navigation.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit vertritt die These, dass asiatische Kampfkünste einen positiven Beitrag zur Resozialisierung Jugendlicher leisten können und stellt eine Alternative zu herkömmlichen, oft ineffektiven Strafmaßnahmen dar.
- Quote paper
- Hasan Ali Kapan (Author), 2009, Asiatische Kampfkünste als begleitende Intervention bei der (Re)Sozialisierung von kriminellen Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155430