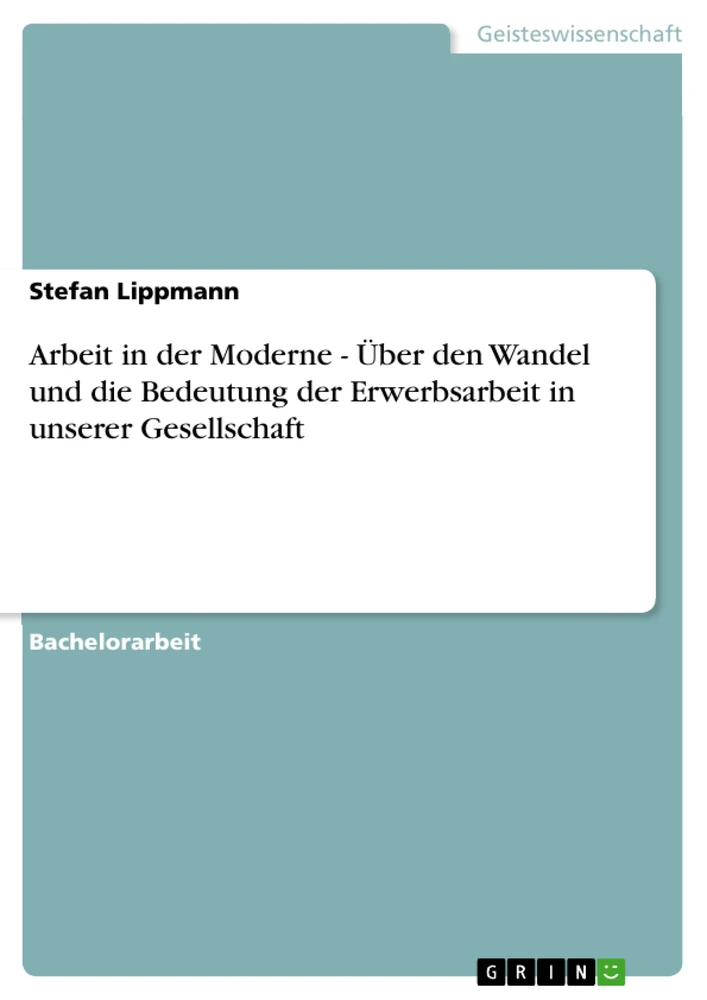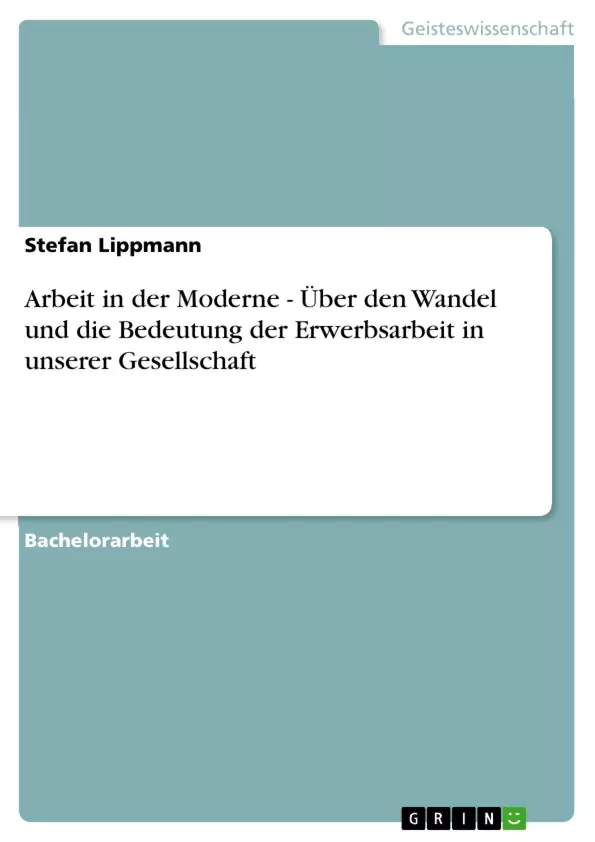„Arbeit! Arbeit! Arbeit!“ – war der Slogan der SPD im Europawahlkampf 1994. Mit dem Wahlkampfmotto „Sozial gerecht ist, was Arbeit schafft“, versuchte die CDU/CSU im Vorfeld der Bundestagswahl 2005 die Wählerstimmen der Bundesbürger zu mobilisieren. Doch was versteht man eigentlich unter Arbeit? Sind der Schulbesuch eines Kindes oder die mit einem Studium verknüpften Tätigkeiten Arbeit? Auch wenn die genannten Personen oder Tätigkeitsbereiche in der individuellen Wahrnehmung der Ausführenden als Arbeit empfunden werden, werden sie trotz dessen in der Regel nicht zu den Arbeitenden gezählt. Für Schulkinder und Studenten beginnt die Phase der Arbeit erst nach dem erfolgreichen Abschluss der jeweiligen Bildungsinstitutionen und dem Eintritt in das Berufsleben. Diese Aspekte offenbaren die vielfältige Bedeutung von Arbeit. Thomas Eberle definiert Arbeit unter dieser Prämisse folgendermaßen: „Im weitesten Sinne meint sie jedes menschliche Eingreifen in die Wirklichkeit, in einem engeren Sinn meint sie lediglich Erwerbsarbeit“ (Eberle, 1991, S. 3).
Die aufgeführten Beispiele zeigen auf, dass Arbeit in unserer Gesellschaft zumeist mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt wird und eine positive Bewertung erfährt. Es genügt allerdings ein Blick in die griechische und römische Antike um festzustellen, dass dies in der Vergangenheit nicht immer so war. Arbeit galt in dieser Zeit als minderwertig und wurde lediglich von den unteren Schichten ausgeführt. Demnach waren Handwerker, Kaufleute oder Bauern, durch die Übernahme von „banausischen“ Tätigkeiten, nicht nur unfähig für den Kriegsdienst, sondern vielmehr auch unfähig für anspruchsvolle geistliche Tätigkeiten, soziale Beziehungen und die Mitgestaltung zur idealen Polis (vgl. Nippel, 2000, S. 55). Dies liegt darin begründet, dass Personen, die auf Erwerbsarbeit angewiesen waren, nicht genügend Muße für die Erkenntnis von Wahrheit, Schönheit oder dem Guten hatten. Gerade bei Aristoteles findet sich eine äußerst negative Bewertung von Arbeit oder auch arbeitender Menschen wieder, da er, wie alle Bürger Griechenlands in dieser Zeit, weder Arbeiten noch Herstellen als eine Lebensweise betrachtete, die eines freien Mannes würdig wäre (vgl. Arendt, 1958/1994, S. 19).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlage
- 3 Stand der Forschung
- 4 Vom Taylorismus und Fordismus der Industriegesellschaft zur entgrenzten Arbeit in der Wissensgesellschaft
- 4.1 Erwerbsarbeit unter den Prinzipien von Frederick Winslow Taylor und Henry Ford in der Industriegesellschaft der deutschen Nachkriegszeit
- 4.2 Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft und die Anforderungen an die Erwerbsarbeit im Postfordismus
- 4.3 Die Wissensgesellschaft und die aktuellen Anforderungen der Erwerbsarbeit
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Wandel der Erwerbsarbeit in Deutschland nach 1950, fokussiert auf die Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung. Ziel ist die Herausarbeitung struktureller Veränderungen (Arbeitszeit, Beschäftigungsniveau und -struktur, Arbeitsform und -inhalt) und deren Einfluss auf die Bedeutung von Erwerbsarbeit. Die zentrale These besagt, dass Erwerbsarbeit zunehmend ihre rein instrumentelle Bedeutung und standardisierte Form verliert und sich zu einem individualisierten und pluralisierten Lebensbereich entwickelt, der Erfüllung und Selbstverwirklichung ermöglicht.
- Struktureller Wandel der Erwerbsarbeit in Deutschland nach 1950
- Entwicklung von der Industrie- zur Wissensgesellschaft und deren Auswirkungen auf die Arbeit
- Veränderung der Bedeutung von Erwerbsarbeit im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen
- Entgrenzung der Lebenssphären und die zunehmende Vermischung von Arbeit und Freizeit
- Subjektive Ansprüche an die Arbeit in Abhängigkeit vom Qualifikationsniveau
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die vielschichtige Bedeutung von Arbeit, insbesondere den Unterschied zwischen Arbeit im weitesten und engeren Sinne (Erwerbsarbeit). Sie zeigt die historische Entwicklung der Wertschätzung von Arbeit auf, von der negativen Bewertung in der Antike bis hin zum heutigen Arbeitsethos, der Arbeit als tugendhaft darstellt. Die Arbeit untersucht den Wandel der Erwerbsarbeit in Deutschland nach 1950 und fragt nach der Veränderung ihrer Bedeutung im Zuge struktureller Veränderungen. Die zentrale These lautet: Erwerbsarbeit verliert an rein instrumenteller Bedeutung und entwickelt sich zu einem individualisierten Lebensbereich, der Selbstverwirklichung ermöglicht. Die These wird anhand der Entwicklung des sektoralen Strukturwandels und der damit verbundenen Veränderungen der Arbeitsbedingungen untersucht.
2 Theoretische Grundlage: Dieses Kapitel beleuchtet die volkswirtschaftliche Diskussion um den langfristigen Strukturwandel von agrarisch geprägten Volkswirtschaften zu Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. Die Hypothese eines Entwicklungsprozesses durch permanente Produktions- und Beschäftigungsverschiebungen zwischen den Sektoren wird vorgestellt und bildet die theoretische Grundlage für die weitere Analyse des Wandels der Erwerbsarbeit.
4 Vom Taylorismus und Fordismus der Industriegesellschaft zur entgrenzten Arbeit in der Wissensgesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Erwerbsarbeit von der Industriegesellschaft (Taylorismus/Fordismus) zur Wissensgesellschaft. Es untersucht die Prinzipien von Taylor und Ford im Kontext der deutschen Nachkriegszeit, den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft und die damit verbundenen neuen Anforderungen an die Erwerbsarbeit, sowie die spezifischen Anforderungen an die Erwerbsarbeit in der Wissensgesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf den Veränderungen der Arbeitsstrukturen, des Arbeitsinhalts und der Bedeutung von Erwerbsarbeit in den jeweiligen Phasen.
Schlüsselwörter
Erwerbsarbeit, Strukturwandel, Industriegesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Wissensgesellschaft, Taylorismus, Fordismus, Postfordismus, Arbeitszeit, Beschäftigung, Arbeitsinhalt, Individualisierung, Pluralisierung, Selbstverwirklichung, Sektoraler Strukturwandel.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Wandel der Erwerbsarbeit in Deutschland nach 1950
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel der Erwerbsarbeit in Deutschland nach 1950, speziell in der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung. Sie analysiert strukturelle Veränderungen (Arbeitszeit, Beschäftigungsniveau und -struktur, Arbeitsform und -inhalt) und deren Einfluss auf die Bedeutung von Erwerbsarbeit.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These lautet, dass Erwerbsarbeit zunehmend ihre rein instrumentelle Bedeutung und standardisierte Form verliert und sich zu einem individualisierten und pluralisierten Lebensbereich entwickelt, der Erfüllung und Selbstverwirklichung ermöglicht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den strukturellen Wandel der Erwerbsarbeit, die Entwicklung von der Industrie- zur Wissensgesellschaft und deren Auswirkungen auf die Arbeit, die Veränderung der Bedeutung von Erwerbsarbeit im gesellschaftlichen Kontext, die Entgrenzung der Lebenssphären und die Vermischung von Arbeit und Freizeit sowie subjektive Ansprüche an die Arbeit in Abhängigkeit vom Qualifikationsniveau.
Welche Phasen der Erwerbsarbeit werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Erwerbsarbeit im Kontext des Taylorismus und Fordismus der Industriegesellschaft mit der entgrenzten Arbeit in der Wissensgesellschaft. Sie untersucht den Wandel von der Industrie- über die Dienstleistungs- zur Wissensgesellschaft und die damit verbundenen Veränderungen der Arbeitsstrukturen, des Arbeitsinhalts und der Bedeutung der Erwerbsarbeit.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die volkswirtschaftliche Diskussion um den langfristigen Strukturwandel von agrarisch geprägten Volkswirtschaften zu Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. Die Hypothese eines Entwicklungsprozesses durch permanente Produktions- und Beschäftigungsverschiebungen zwischen den Sektoren bildet die theoretische Grundlage.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur theoretischen Grundlage, einem Kapitel zum Stand der Forschung, einem Kapitel zum Wandel der Erwerbsarbeit von der Industrie- zur Wissensgesellschaft (inkl. Unterkapiteln zu Taylorismus/Fordismus, Dienstleistungsgesellschaft und Wissensgesellschaft) und einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erwerbsarbeit, Strukturwandel, Industriegesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Wissensgesellschaft, Taylorismus, Fordismus, Postfordismus, Arbeitszeit, Beschäftigung, Arbeitsinhalt, Individualisierung, Pluralisierung, Selbstverwirklichung, Sektoraler Strukturwandel.
Welche Zeitperiode wird untersucht?
Die Arbeit fokussiert sich auf die Entwicklung der Erwerbsarbeit in Deutschland nach 1950, mit einem Schwerpunkt auf der Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung.
- Citar trabajo
- Stefan Lippmann (Autor), 2009, Arbeit in der Moderne - Über den Wandel und die Bedeutung der Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155445