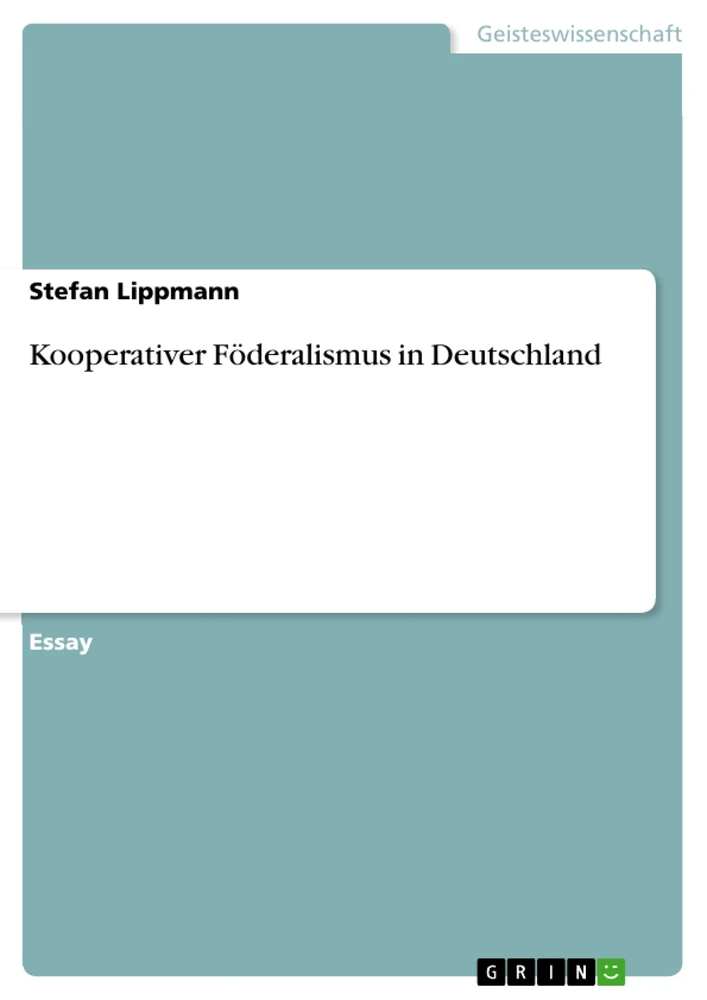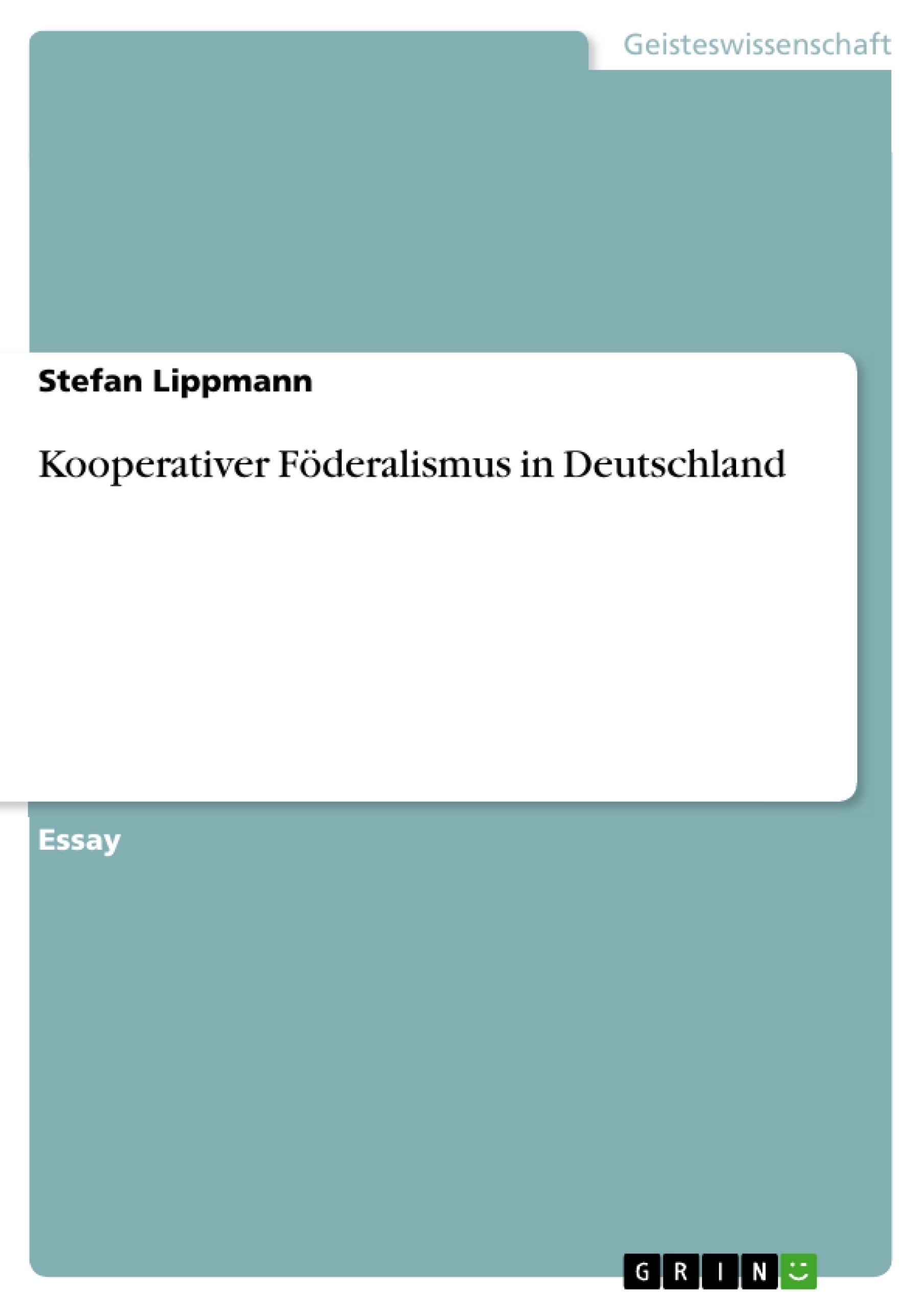Die Bundesrepublik Deutschland ist wie der Name bereits vermuten lässt, nach dem föderalistischen System aufgebaut. Dieser föderalistische Aufbau gehört neben der Demokratie, der Republik, dem Rechtsstaat und dem Sozialstaat zu den fünf grundlegenden Verfassungsprinzipien und gilt nach Art. 79 Abs. 3 GG als unabänderlich. In dem Politiklexikon von Schubert und Klein (2006) ist Föderalismus grundsätzlich als ein Ordnungsprinzip definiert, „das auf weitgehender Unabhängigkeit einzelner Einheiten beruht, die zusammen aber ein Ganzes bilden“. In der deutschen Geschichte hat dieses bundesstaatliche Ordnungsprinzip nach Ansicht von Sontheimer und Bleek (2002) eine lange Tradition, wie sie an Beispielen des Römischen Reiches Deutscher Nationen, dem Deutschen Bund Anfang des 19. Jahrhunderts oder des Deutschen Reiches von 1871 darstellen. Allerdings ist der politische Wiederufbau der Bundesrepublik nach föderalen Prinzipien nach dem Zweiten Weltkrieg weniger auf regionale Unterschiede zurückzuführen, sondern hat vielmehr verfassungspolitische Überlegungen zur Grundlage. Es sollte neben der horizontalen Gewaltenteilung zwischen den staatlichen Institutionen Legislative, Exekutive und Judikative, noch eine vertikalen Dimension zur Sicherung der Gewaltenteilung eingeführt werden (vgl. Sontheimer & Bleek, 2002, S. 357). Betrachtet man den heutigen deutschen Föderalismus genauer, fällt auf, dass dieser einige Besonderheiten aufweist, die ihn von der zu Beginn dargestellten Definition unterscheiden. In der Literatur wird dies mit den Begriffen kooperativer Föderalismus, Verbundföderalismus oder auch unitarischer Bundesstaat umschrieben. Dieser Aspekt hat zur Folge, dass sich der aktuelle Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland grundlegend und nachhaltig von seinen Vorgängern unterscheidet. In dem folgenden Essay soll nun geklärt werden, was den deutschen kooperativen Föderalismus ausmacht und in welcher Weise dieser in der Bundesrepublik Deutschland institutionalisiert ist. Anschließend werden dann die spezifischen Vor- und Nachteile dieser Variante des Föderalismus diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. KOOPERATIVER FÖDERALISMUS IN DEUTSCHLAND
- 3. INSTITUTIONALISIERUNG DES KOOPERATIVEN FÖDERALISMUS
- 4. VOR- UND NACHTEILE DES KOOPERATIVEN FÖDERALISMUS
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht den kooperativen Föderalismus in Deutschland. Die Zielsetzung ist es, die Charakteristika dieses Systems zu erläutern, seine Institutionalisierung zu beschreiben und seine Vor- und Nachteile zu diskutieren. Der Essay basiert auf der Analyse bestehender Literatur und beleuchtet die Entwicklung und den aktuellen Stand des deutschen Föderalismus.
- Definition und Entwicklung des kooperativen Föderalismus in Deutschland
- Institutionalisierung des kooperativen Föderalismus durch Bund-Länder-Kooperation
- Analyse der Finanzreform von 1969 und ihrer Auswirkungen
- Bewertung der Vor- und Nachteile des kooperativen Föderalismus
- Vergleich des kooperativen Föderalismus mit anderen föderalen Modellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung stellt den föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland vor und hebt seine Bedeutung als Verfassungsprinzip hervor. Sie definiert Föderalismus und skizziert dessen historische Entwicklung in Deutschland. Die Einleitung führt in die Thematik des kooperativen Föderalismus ein und benennt die zentralen Forschungsfragen des Essays: Was zeichnet den deutschen kooperativen Föderalismus aus, und wie ist er institutionalisiert? Die Einleitung leitet über zur detaillierten Auseinandersetzung mit dem Thema und den nachfolgenden Kapiteln.
2. KOOPERATIVER FÖDERALISMUS IN DEUTSCHLAND: Dieses Kapitel beschreibt den kooperativen Föderalismus als eine politische Praxis der gegenseitigen Unterstützung, Absprache und übereinstimmenden Entscheidungsfindung zwischen Bund und Ländern. Es analysiert den Entwicklungsprozess hin zu diesem Modell, der aus einer Kritik an der Ineffizienz des ursprünglichen föderalen Systems resultierte. Die Finanzreform von 1969 wird als wichtiger Wendepunkt hervorgehoben, der die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern intensivierte und die strikte Trennung von Aufgaben und Ausgaben aufhob. Das Kapitel betont die Bedeutung von Selbstkoordination der Länder, Gesetzgebungskompetenzen des Bundes, bilateralen Abmachungen und der Bund-Länder-Kooperation. Es zeigt, wie der deutsche Föderalismus trotz seiner Gliederung in Bund und Länder Züge eines Einheitsstaates aufweist, da er eine bundesweite Einheitlichkeit in Wirtschaft und Recht anstrebt.
3. INSTITUTIONALISIERUNG DES KOOPERATIVEN FÖDERALISMUS: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die institutionalisierten Formen der Bund-Länder-Kooperation. Es werden verschiedene Beispiele genannt, wie etwa die Zusammenarbeit von Fachministern und Spitzenbeamten, Bund-Länder-Ausschüsse zur Angleichung von Gesetzen und Verordnungen, sowie Koordinationsgremien wie der Wissenschaftsrat oder der Planungsausschuss für den Hochschulbau. Die Kapitel erläutert die verfassungsrechtliche Grundlage dieser Zusammenarbeit, etwa durch Artikel 91a und 91b GG, die Investitionshilfen des Bundes und den Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft der Länder. Es unterstreicht, wie diese Institutionen den kooperativen Föderalismus strukturieren und ermöglichen.
Schlüsselwörter
Kooperativer Föderalismus, Bundesstaat, Deutschland, Bund-Länder-Kooperation, Finanzreform 1969, Gewaltenteilung, Länderfinanzausgleich, Verbundföderalismus, Einheitsstaat, Gesetzgebungskompetenz, institutionelle Gestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Essay: Kooperativer Föderalismus in Deutschland
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht den kooperativen Föderalismus in Deutschland. Er beschreibt dessen Charakteristika, Institutionalisierung und diskutiert Vor- und Nachteile.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt die Definition und Entwicklung des kooperativen Föderalismus, seine Institutionalisierung durch Bund-Länder-Kooperation, die Analyse der Finanzreform von 1969 und deren Auswirkungen, eine Bewertung der Vor- und Nachteile sowie einen Vergleich mit anderen föderalen Modellen. Die verfassungsrechtliche Grundlage und verschiedene Kooperationsformen zwischen Bund und Ländern werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kooperativer Föderalismus in Deutschland, Institutionalisierung des kooperativen Föderalismus, Vor- und Nachteile des kooperativen Föderalismus und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und definiert die zentralen Forschungsfragen. Kapitel 2 beschreibt den kooperativen Föderalismus und seine Entwicklung. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Institutionalisierung. Die Vor- und Nachteile werden in Kapitel 4 diskutiert. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist unter kooperativem Föderalismus zu verstehen?
Kooperativer Föderalismus wird im Essay als politische Praxis der gegenseitigen Unterstützung, Absprache und übereinstimmenden Entscheidungsfindung zwischen Bund und Ländern beschrieben. Er entstand als Reaktion auf die Ineffizienz des ursprünglichen föderalen Systems.
Welche Rolle spielte die Finanzreform von 1969?
Die Finanzreform von 1969 wird als wichtiger Wendepunkt im deutschen Föderalismus gesehen. Sie intensivierte die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und hob die strikte Trennung von Aufgaben und Ausgaben auf.
Wie ist der kooperative Föderalismus institutionalisiert?
Die Institutionalisierung erfolgt durch verschiedene Formen der Bund-Länder-Kooperation, wie die Zusammenarbeit von Fachministern und Spitzenbeamten, Bund-Länder-Ausschüsse, Koordinationsgremien (z.B. Wissenschaftsrat) und verfassungsrechtliche Grundlagen (z.B. Artikel 91a und 91b GG).
Welche Vor- und Nachteile werden im Essay diskutiert?
Der Essay analysiert die Vor- und Nachteile des kooperativen Föderalismus, jedoch werden die konkreten Argumente im HTML-Auszug nicht detailliert dargestellt. Dies ist Gegenstand der entsprechenden Kapitel im vollständigen Essay.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter sind: Kooperativer Föderalismus, Bundesstaat, Deutschland, Bund-Länder-Kooperation, Finanzreform 1969, Gewaltenteilung, Länderfinanzausgleich, Verbundföderalismus, Einheitsstaat, Gesetzgebungskompetenz, institutionelle Gestaltung.
Wo finde ich den vollständigen Essay?
Der hier gezeigte HTML-Code stellt nur einen Auszug dar. Der vollständige Essay enthält die detaillierten Informationen zu den oben genannten Punkten.
- Quote paper
- Stefan Lippmann (Author), 2008, Kooperativer Föderalismus in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155455