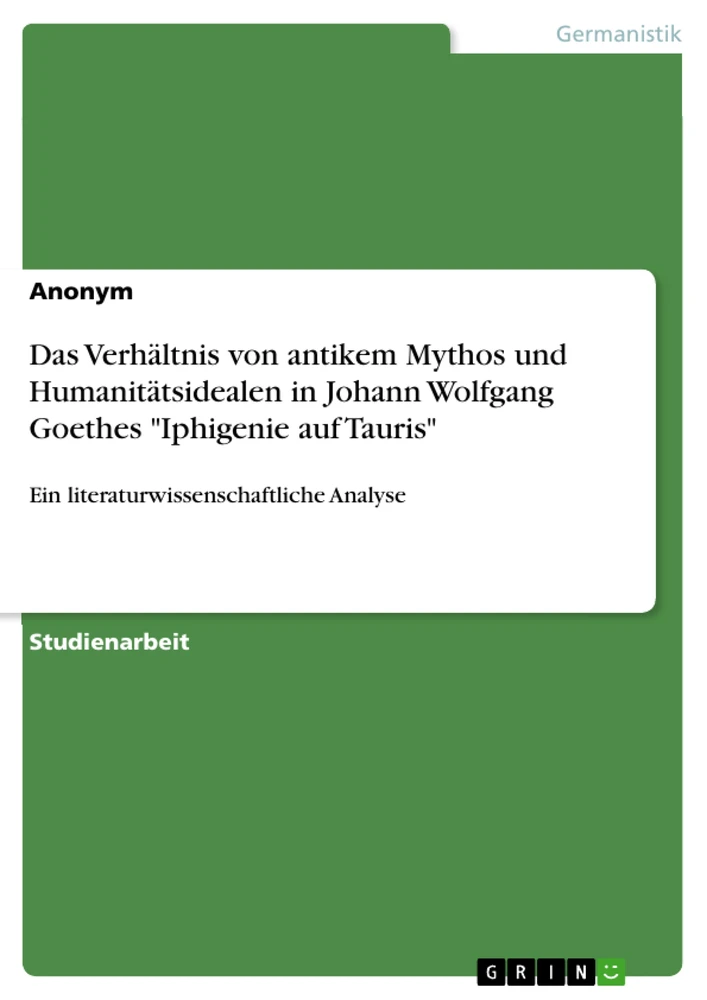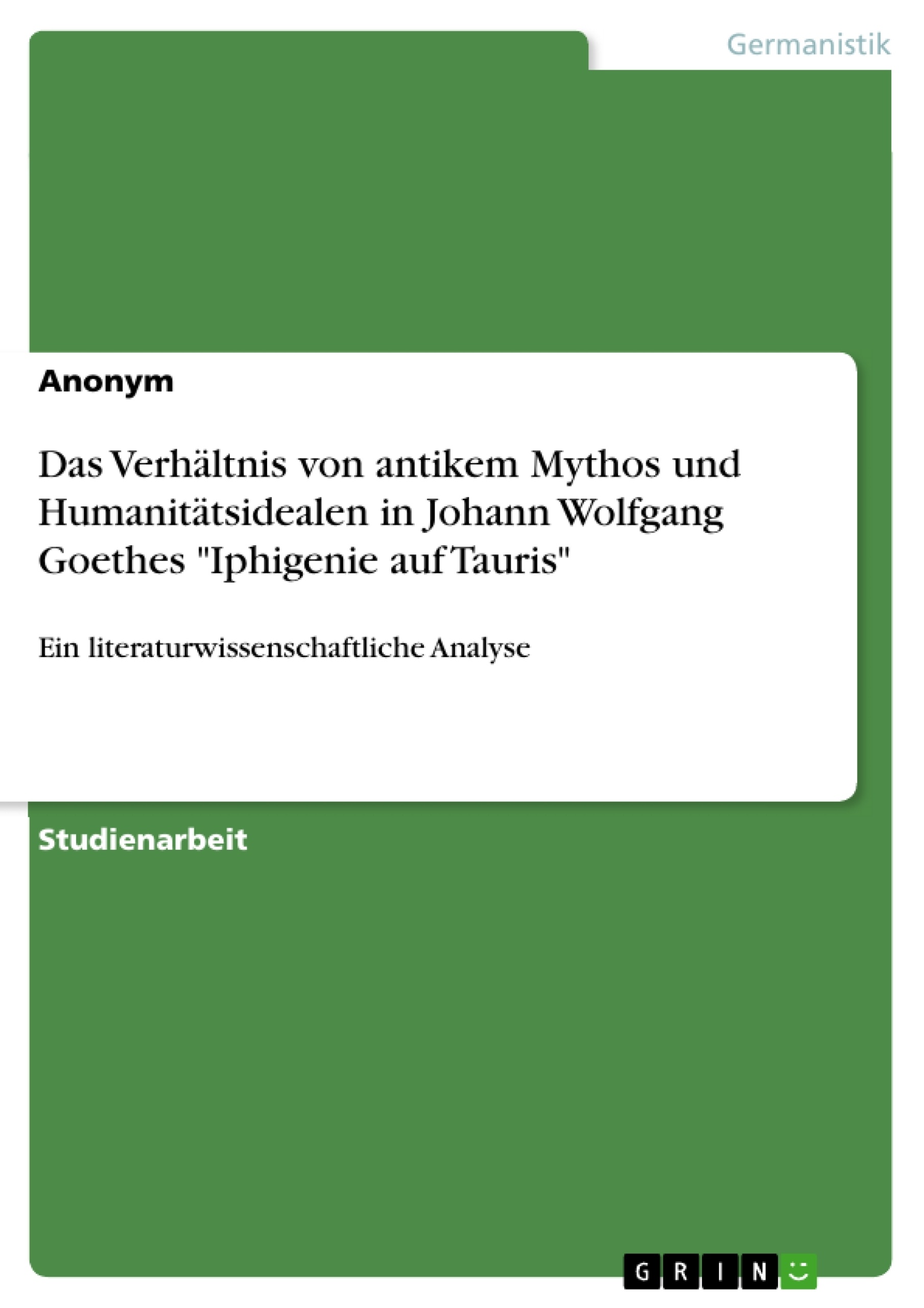Die Hausarbeit stellt die Rolle des Tantalidenfluchs in dem Drama dar, indem der Einfluss des Fluchs auf die Figuren Iphigenie, Orest und Pylades und deren Handlungen untersucht wird. Dabei werden auch die Figuren charakterisiert. Besonders Iphigenie wird hinsichtlich ihres moralischen Dilemmas und ihrer Rolle in einer patriarchischen Gesellschaft untersucht. Abschließend wird die Konfliktlösung im Spiegel von Humanitätsidealen analysiert.
Johann Wolfgang von Goethes Drama Iphigenie auf Tauris ist ein bedeutendes Werk der deutschen Literaturgeschichte. Laut Goethes Tagebuch entsteht 1779 die erste mit Versen durchsetzte Prosafassung der Iphigenie auf Tauris innerhalb von 42 Tagen. Mit dieser Urfassung jedoch bald unzufrieden, überarbeitet Goethe seine Iphigenie auf Tauris während seiner ersten Italienreise (1786-1788) und versifiziert das Drama im jambischen Rhythmus. Dieses Drama hat es geschafft, auch über 200 Jahre später, immer wieder Gegenstand schulischer als auch universitärer Lehre zu sein und nach wie vor auf Bühnen inszeniert zu werden. Dies liegt einerseits daran, dass es durch die Inhaltsfelder Familie, moralisches Dilemma und Willensfreiheit überzeitlich aktuell und relevant ist. Andererseits stellt es ein Schlüsselwerk der Weimarer Klassik dar und spiegelt die Ideale dieser Epoche gerade durch das Zusammenspiel von aufklärerischen Humanitätsidealen und antikem Mythos, in Form des Tantalidenfluchs, wider.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Goethes Klassizismus
- Der Tantalidenmythos in Iphigenie auf Tauris
- Drei literarische Figuren im Vergleich: Ihre Einstellungen zum Tantalidenmythos
- Iphigenies Einstellung zum antiken Mythos
- Orests Einstellung zum antiken Mythos
- Pylades Einstellung zum antiken Mythos
- Zwischenfazit
- Iphigenie im moralischen Dilemma
- Iphigenie als autonome Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft
- Die Konfliktlösung im Spiegel von Humanitätsidealen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von antikem Mythos und Humanitätsidealen in Goethes „Iphigenie auf Tauris“. Das Hauptziel ist die Analyse der Rolle dieses Verhältnisses für die Konfliktlösung des Dramas. Die Arbeit ordnet das Drama in Goethes Klassizismus ein und beleuchtet den Tantalidenmythos als zentralen Bestandteil der Handlung.
- Die Einordnung von Goethes Iphigenie in den Kontext seines Klassizismus
- Die Darstellung des Tantalidenmythos und seine Bedeutung für das Drama
- Der Vergleich der Einstellungen der Hauptfiguren (Iphigenie, Orest, Pylades) zum Mythos
- Die Analyse von Iphigenies moralischem Dilemma im Kontext einer patriarchalischen Gesellschaft
- Der Einfluss des Verhältnisses von Mythos und Humanitätsidealen auf die Konfliktlösung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Goethes „Iphigenie auf Tauris“ als bedeutendes Werk der deutschen Literaturgeschichte, das aufgrund seiner überzeitlichen Themen (Familie, moralisches Dilemma, Willensfreiheit) bis heute Relevanz besitzt. Es wird die Forschungsfrage formuliert: Wie verhält sich der antike Tantalidenmythos zu den Humanitätsidealen im Drama und welche Rolle spielt dieses Verhältnis für die Konfliktlösung?
Goethes Klassizismus: Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale von Goethes Klassizismus, der sich durch die Rückbesinnung auf antike Formen und Ideale auszeichnet. Die „klassizistische Strenge der Form und das (scheinbar) modellhaft Humane des Inhalts“ werden als repräsentativ für Goethes Klassizismus in „Iphigenie auf Tauris“ beschrieben. Weiterhin wird die Verwendung antiker Mythologie und die Betonung von Tugenden wie Mitgefühl und Gerechtigkeit behandelt. Goethes pädagogische Intention, mit dem Drama die Empathie- und Urteilsfähigkeit der Zuschauer zu schulen, wird ebenfalls diskutiert, wobei die mythischen Stoffe als Mittel zur Erreichung dieses Ziels dienen.
Der Tantalidenmythos in Iphigenie auf Tauris: Dieses Kapitel erläutert den Tantalidenmythos und seine Bedeutung für die Handlung. Es wird der Fluch auf die Nachkommen des Tantalus beschrieben und die Rolle Iphigenies und Orests als Nachkommen des Tantalus im Kontext des Trojanischen Krieges dargestellt. Der Fluch manifestiert sich in einem Kreislauf aus Bluttat und Rache, in dem die Betroffenen abwechselnd zu Tätern und Opfern werden. Die scheinbare Ausweglosigkeit dieser Situation wird hervorgehoben, was die zentrale Frage nach der Positionierung der Figuren zu diesem Fluch aufwirft.
Schlüsselwörter
Iphigenie auf Tauris, Goethe, Klassizismus, antiker Mythos, Tantalidenmythos, Humanitätsideale, moralisches Dilemma, Autonomie, Patriarchat, Konfliktlösung, Blutrache, Empathie, Urteilsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Goethes "Iphigenie auf Tauris"?
Diese Analyse von Goethes "Iphigenie auf Tauris" untersucht das Verhältnis von antikem Mythos und Humanitätsidealen im Drama. Das Hauptziel ist es, die Rolle dieses Verhältnisses für die Konfliktlösung zu analysieren. Die Arbeit ordnet das Drama in Goethes Klassizismus ein und beleuchtet den Tantalidenmythos als zentralen Bestandteil der Handlung.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Themenschwerpunkte:
- Die Einordnung von Goethes Iphigenie in den Kontext seines Klassizismus.
- Die Darstellung des Tantalidenmythos und seine Bedeutung für das Drama.
- Der Vergleich der Einstellungen der Hauptfiguren (Iphigenie, Orest, Pylades) zum Mythos.
- Die Analyse von Iphigenies moralischem Dilemma im Kontext einer patriarchalischen Gesellschaft.
- Der Einfluss des Verhältnisses von Mythos und Humanitätsidealen auf die Konfliktlösung.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Goethes „Iphigenie auf Tauris“ als bedeutendes Werk der deutschen Literaturgeschichte, das aufgrund seiner überzeitlichen Themen (Familie, moralisches Dilemma, Willensfreiheit) bis heute Relevanz besitzt. Es wird die Forschungsfrage formuliert: Wie verhält sich der antike Tantalidenmythos zu den Humanitätsidealen im Drama und welche Rolle spielt dieses Verhältnis für die Konfliktlösung?
Was beschreibt das Kapitel "Goethes Klassizismus"?
Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale von Goethes Klassizismus, der sich durch die Rückbesinnung auf antike Formen und Ideale auszeichnet. Die „klassizistische Strenge der Form und das (scheinbar) modellhaft Humane des Inhalts“ werden als repräsentativ für Goethes Klassizismus in „Iphigenie auf Tauris“ beschrieben. Weiterhin wird die Verwendung antiker Mythologie und die Betonung von Tugenden wie Mitgefühl und Gerechtigkeit behandelt. Goethes pädagogische Intention, mit dem Drama die Empathie- und Urteilsfähigkeit der Zuschauer zu schulen, wird ebenfalls diskutiert, wobei die mythischen Stoffe als Mittel zur Erreichung dieses Ziels dienen.
Welche Bedeutung hat der Tantalidenmythos in "Iphigenie auf Tauris"?
Das Kapitel über den Tantalidenmythos erläutert den Mythos und seine Bedeutung für die Handlung. Es wird der Fluch auf die Nachkommen des Tantalus beschrieben und die Rolle Iphigenies und Orests als Nachkommen des Tantalus im Kontext des Trojanischen Krieges dargestellt. Der Fluch manifestiert sich in einem Kreislauf aus Bluttat und Rache. Die scheinbare Ausweglosigkeit dieser Situation wird hervorgehoben, was die zentrale Frage nach der Positionierung der Figuren zu diesem Fluch aufwirft.
Welche Schlüsselwörter sind mit der Analyse verbunden?
Die Schlüsselwörter sind: Iphigenie auf Tauris, Goethe, Klassizismus, antiker Mythos, Tantalidenmythos, Humanitätsideale, moralisches Dilemma, Autonomie, Patriarchat, Konfliktlösung, Blutrache, Empathie, Urteilsfähigkeit.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2024, Das Verhältnis von antikem Mythos und Humanitätsidealen in Johann Wolfgang Goethes "Iphigenie auf Tauris", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1554783