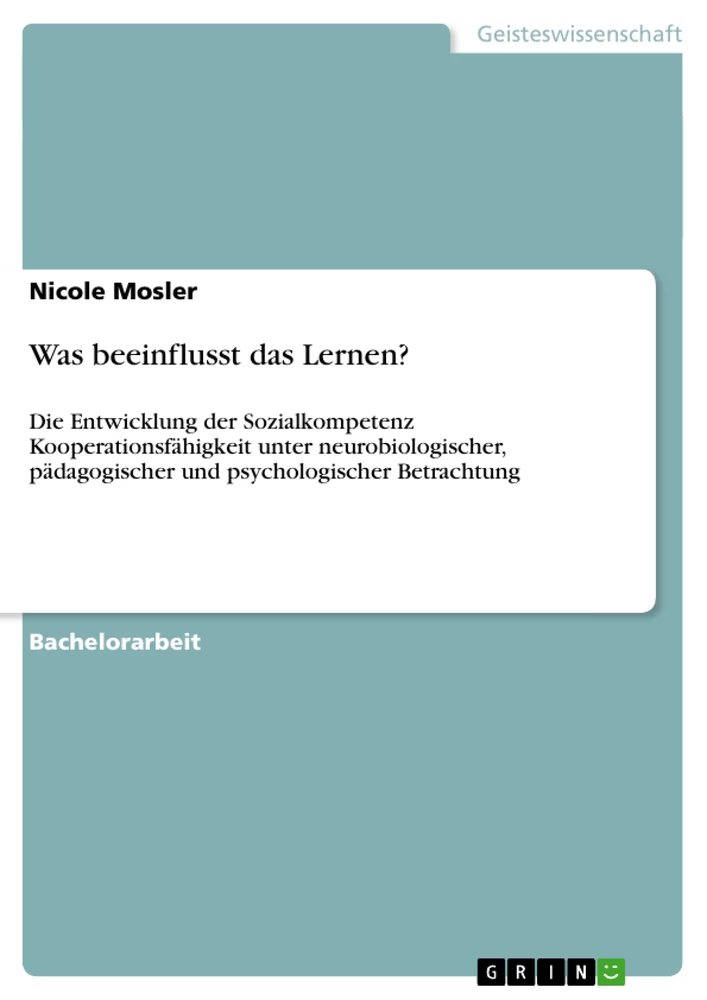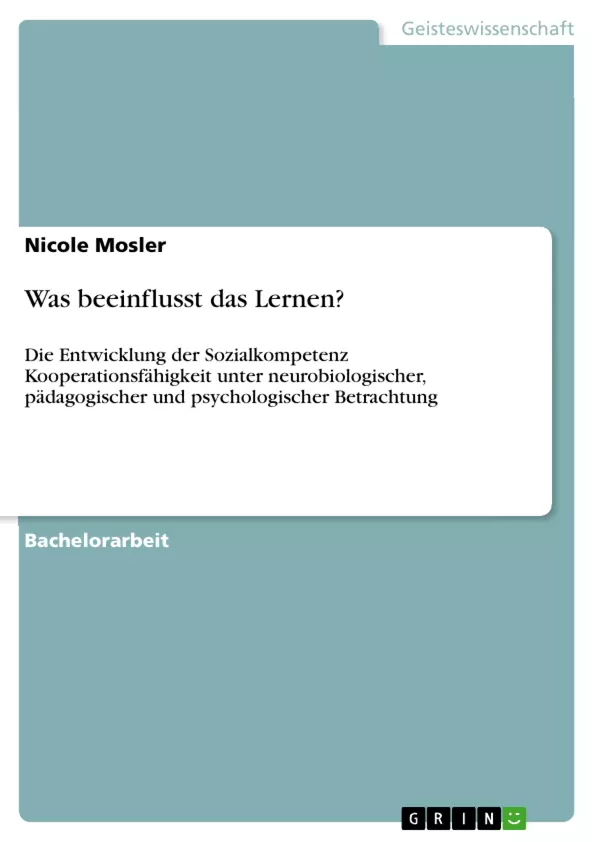Die altlateinischen Spruchweisheiten „quid pro quo“ und „manus manum lavat“ drücken eine Erfahrung aus, die ein verlässliches Zusammenwirken von Menschen beschreibt. Jedoch ist diese noch selbstverständlich? Ist dieser „Ehrenkodex“ noch gültig? Das Prinzip von Nehmen und Geben ist offensichtlich nicht mehr modern. Längst scheinen Gewinnmaximierung und Vorteilssuche, auch durch eine neoliberale Wirtschaftswelt, vorherrschendes Prinzip zu sein; das gegenseitige Tragen in einem Sozialstaat wird herausgefordert. Spielt in unserem Zusammenleben Reziprozität oder Altruismus noch eine Rolle? Oder hat sich die darwinistische von den Sozialbiologen favorisierte Annahme eines „egoistischen Gens“ durchgesetzt? Stecken wir in einem Dilemma, indem wir uns nach gegenseitig unterstützenden Strukturen sehnen, jedoch nicht bereit sind für das Allgemeinwohl auf persönliche Vorteile zu verzichten?
In der Literatur, in den Medien, in der Politik und im persönlichen Umfeld sind Entwicklungen und Ansätze in die entgegengesetzte Richtung erkennbar. Angesichts der Konflikte, der Klimaveränderungen, der Globalisierungsfolgen und der Wirtschaftskrise erleben Verantwortungsbewusstsein, bürgerschaftliches Engagement und soziale Teilhabegedanken eine Renaissance. Diese Bewegungen sehen die Zukunft nicht im Gegeneinander und in der Konkurrenz, sondern im zusammen-wirken-den Miteinander, im Aufbau langfristiger und verlässlicher Beziehungen, sei es persönlich, ökonomisch oder politisch. Eine Herausforderung! Diese Bewältigungsstrategie, diese Art der Problemmeisterung erfordert Fähigkeiten kommunikativer, emotionaler, sozialer Art. Ist dabei Kooperation, kooperatives Verhalten und Handeln eine dienliche Größe? Ist diese Fähigkeit, Strategie angeboren? Erlernen wir sie? Kann sie durch Trainings gefördert werden? Oder liegt die Lösung in der „Sozialpille“ , wo wir eine Dosis Stimmungsaufheller oder Oxytocin einnehmen, um freundlicher, kooperativer, friedlicher zu werden?
Kooperationsfähigkeit als eine Soziale Kompetenz ist auf unterschiedlichen Ebenen gefragt. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, was sich hinter dem Begriff Kompetenz verbirgt, um im Folgenden Sozialkompetenz zu erläutern. In diesem Rahmen findet eine Darstellung von Kooperation, Kooperativität statt. Im Weiteren wird betrachtet wie sich kooperatives Denken, Handeln und Verhalten aus neurobiologischer, pädagogischer und psychologischer Sicht entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE SOZIALE KOMPETENZ KOOPERATIONSFÄHIGKEIT
- Kompetenz: ein mehrdeutiger Begriff
- Was bedeutet Soziale Kompetenz?
- Kooperation erfordert Kooperativität?
- WIE ERLERNEN WIR KOOPERATIVES DENKEN, VERHALTEN UND HANDELN?
- Neurobiologische Betrachtung
- Ausstattung, Entwicklung und Funktionen des Gehirns
- Neuronale Plastizität und Spiegelphänomen
- Neurotransmitter-, Belohnungs- und Bewertungssystem
- Was beeinflusst das Lernen?
- Pädagogische Betrachtung
- Erlebnispädagogik
- Ganzheitlichkeit und Menschenbild
- Handlungs- und Prozessorientierung
- Erlebnis- und Erfahrungsorientierung
- Was beeinflusst das Lernen?
- Psychologische Betrachtung
- Theorie des sozialen Lernens
- Kognitive und moralische Entwicklungstheorie
- Die personenzentrierte Persönlichkeitstheorie
- Was beeinflusst das Lernen?
- Soziale Kompetenz erlernen
- WIE KANN KOOPERATIVITÄT ENTWICKELT WERDEN?
- Neurodidaktische Folgerungen und das Züricher Ressourcen Modell
- Erlebnispädagogische Folgerungen und Trainings
- Sozialpsychologische Folgerungen und Modelle
- IST KOOPERATION EINE EVOLUTIONÄRE STRATEGIE?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Sozialkompetenz Kooperationsfähigkeit unter neurobiologischer, pädagogischer und psychologischer Betrachtung. Ziel ist es, die Entstehung und Förderung von kooperativem Denken, Verhalten und Handeln zu beleuchten und die Frage zu beantworten, was Lernen im Kontext von sozialer Kompetenz beeinflusst. Dabei werden verschiedene Modelle und Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen herangezogen.
- Die Bedeutung von Sozialkompetenz und Kooperationsfähigkeit im Kontext von Bildung und Gesellschaft
- Die Rolle von neurobiologischen Faktoren bei der Entwicklung von Kooperationsfähigkeit
- Die Bedeutung von pädagogischen Ansätzen und Erlebnispädagogik für die Förderung von Kooperationsfähigkeit
- Die Relevanz psychologischer Theorien wie der Theorie des sozialen Lernens und der personenzentrierten Persönlichkeitstheorie für das Verständnis von kooperativem Verhalten
- Die Frage, ob Kooperation eine evolutionäre Strategie ist.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung von Kooperation und dem Dilemma zwischen individuellem Gewinnstreben und der Notwendigkeit gemeinschaftlichen Handelns. Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Kompetenz“ und erläutert den Zusammenhang zwischen sozialer Kompetenz und Kooperationsfähigkeit.
Kapitel 3 untersucht die Entwicklung von kooperativem Denken, Verhalten und Handeln aus drei Perspektiven: neurobiologisch, pädagogisch und psychologisch. Dabei werden die Rolle des Gehirns, die Bedeutung von Erfahrung und die Einflüsse von Lernmodellen beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Frage, wie Kooperativität entwickelt werden kann und stellt verschiedene Ansätze aus der Neurodidaktik, Erlebnispädagogik und Sozialpsychologie vor.
Schlüsselwörter
Soziale Kompetenz, Kooperationsfähigkeit, Neurobiologie, Pädagogik, Psychologie, Lernen, Entwicklung, Erlebnispädagogik, Soziales Lernen, Personenzentrierte Theorie, Evolutionäre Strategie.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht diese Arbeit zum Thema Lernen und Kooperation?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der sozialen Kompetenz „Kooperationsfähigkeit“ aus drei Perspektiven: der Neurobiologie, der Pädagogik und der Psychologie.
Welche neurobiologischen Faktoren beeinflussen das Erlernen von Kooperation?
Untersucht werden die Funktionen des Gehirns, die neuronale Plastizität, das Spiegelphänomen (Spiegelneuronen) sowie das Belohnungs- und Bewertungssystem durch Neurotransmitter wie Oxytocin.
Welche Rolle spielt die Erlebnispädagogik bei der Förderung von Sozialkompetenz?
Die Erlebnispädagogik setzt auf Ganzheitlichkeit, Handlungs- und Erfahrungsorientierung, um kooperatives Verhalten durch praktische Herausforderungen und Gruppenprozesse zu trainieren.
Ist Kooperation eine angeborene evolutionäre Strategie?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob der Mensch primär durch ein „egoistisches Gen“ (Darwinismus) gesteuert wird oder ob Reziprozität und Altruismus als überlebenswichtige evolutionäre Strategien verankert sind.
Was ist das Züricher Ressourcen Modell (ZRM)?
Das ZRM wird im Text als neurodidaktischer Ansatz vorgestellt, um Kooperativität und persönliche Ressourcen gezielt zu entwickeln und zu stärken.
- Citation du texte
- Nicole Mosler (Auteur), 2010, Was beeinflusst das Lernen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155498