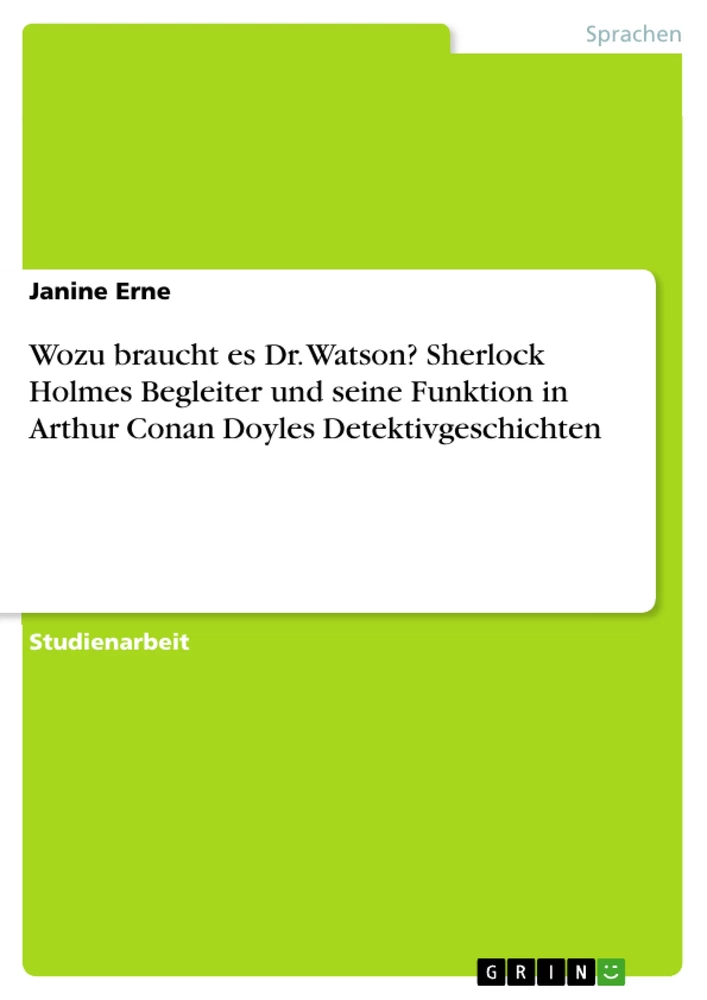Der Autor Hesketh Pearson schreibt in einem seiner Werke, das das Leben Arthur Conan Doyles behandelt:
“Like Hamlet, Sherlock Holmes is what every man desires to be; like Don Quixote, he is a knight-errant who rescues the unfortunate and fights single-handed against the powers of darkness; and like Quixote he has a Sancho Panza in the person of Dr. Watson.“
Wie Sancho Panza in Miguel de Cervantes Roman tritt auch Watson ‚nur’ als Begleiter der Hauptfigur auf. Aus diesem Umstand heraus ergibt sich die Frage, wozu es die Figur Dr. Watson überhaupt braucht, wenn doch Sherlock Holmes der Held sämtlicher Erzählungen ist. Die folgende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Fragestellung, welche Funktion Dr. Watson in seiner Rolle als Weggefährte von Sherlock Holmes in Doyles Detektivgeschichten erfüllt. Hierzu soll zum einen betrachtet werden, welchen Zweck die Figur des Dr. Watson hinsichtlich der Erzählungen, als auch in Bezug auf den Rezipienten hat. Vor allem seine Funktion als Ich-Erzähler, Komplementärfigur und Identifikationsfigur soll einer eingehenderen Untersuchung unterzogen werden und bilden den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dr. Watsons Funktion innerhalb der Erzählungen
- Die Watson-Perspektive
- Dr. Watson versus Sherlock Holmes
- Die falsche Lösung
- Dr. Watson und der Leser
- Sympathieträger und Identifikationsfigur
- Zwischen Ver- und Bewunderung
- Sympathielenkung und Charakterisierung des Detektivs
- Sympathielenkung und Charakterisierung der übrigen Figuren
- Mehr als nur Fiktion?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion von Dr. Watson in Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes-Geschichten. Sie analysiert Watsons Rolle als Erzähler, seine komplementäre Beziehung zu Holmes und seine Bedeutung für die Leser. Der Fokus liegt auf der Frage, warum die Figur Dr. Watson notwendig ist, obwohl Sherlock Holmes der zentrale Detektiv ist.
- Watsons Funktion als Ich-Erzähler und seine Auswirkung auf die Erzählperspektive.
- Der Kontrast zwischen Watson und Holmes als komplementäre Figuren.
- Watsons Rolle als Sympathieträger und Identifikationsfigur für den Leser.
- Die Wirkung von Watsons Perspektive auf die Spannung und den Lesefluss.
- Die Bedeutung von Watsons Fehlschlüssen und Fragen für das Verständnis von Holmes' deduktiven Fähigkeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Funktion von Dr. Watson in den Sherlock Holmes-Geschichten. Sie verweist auf Hesketh Pearsons Vergleich von Watson mit Sancho Panza und skizziert den Fokus der Arbeit auf Watsons Rolle als Erzähler, Komplementärfigur und Identifikationsfigur.
Dr. Watsons Funktion innerhalb der Erzählungen: Dieses Kapitel analysiert Watsons Funktion innerhalb des erzählerischen Gefüges. Es untersucht die „Watson-Perspektive“ als Ich-Erzähler-Perspektive und deren Einfluss auf die Spannung und den Informationsfluss für den Leser. Der Kontrast zwischen Watsons begrenztem Wissen und Holmes' scharfer Beobachtungsgabe wird hervorgehoben, wodurch die Spannung und die Bewunderung für Holmes gesteigert werden. Die Kapitel befasst sich auch mit dem Gegensatz zwischen Watson und Holmes als komplementäre Figuren und ihrer jeweiligen Rolle in der Geschichte.
Dr. Watson und der Leser: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Wirkung von Watson auf den Leser. Es beleuchtet Watsons Funktion als Sympathieträger und Identifikationsfigur, die es dem Leser ermöglicht, sich mit der Geschichte zu identifizieren und die Ereignisse aus einer menschlichen Perspektive zu betrachten. Die Kapitel diskutiert die Gratwanderung zwischen Bewunderung und Verständnis für Holmes' exzentrische Natur, welche durch Watson vermittelt wird. Abschließend hinterfragt es die fiktionale Natur der Geschichten und deren möglichen Bezug zur Realität.
Schlüsselwörter
Sherlock Holmes, Dr. Watson, Detektivgeschichte, Erzählperspektive, Ich-Erzähler, Komplementärfigur, Identifikationsfigur, Spannung, Sympathieträger, Deduktion, Charakterisierung, Erzähltechnik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Rolle von Dr. Watson in den Sherlock Holmes-Geschichten
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Funktion von Dr. Watson in Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes-Geschichten. Im Fokus steht die Analyse von Watsons Rolle als Erzähler, seine komplementäre Beziehung zu Holmes und seine Bedeutung für die Leser. Es wird insbesondere der Frage nachgegangen, warum die Figur Dr. Watson notwendig ist, obwohl Sherlock Holmes der zentrale Detektiv ist.
Welche Aspekte von Dr. Watsons Rolle werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte von Watsons Rolle: seine Funktion als Ich-Erzähler und den Einfluss seiner Perspektive auf die Erzählperspektive, den Kontrast zwischen Watson und Holmes als komplementäre Figuren, Watsons Rolle als Sympathieträger und Identifikationsfigur für den Leser, die Wirkung seiner Perspektive auf Spannung und Lesefluss sowie die Bedeutung seiner Fehlschlüsse und Fragen für das Verständnis von Holmes' deduktiven Fähigkeiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage vor und skizziert den Fokus der Arbeit. Die Kapitel analysieren Watsons Funktion innerhalb der Erzählungen (inkl. der "Watson-Perspektive"), seine Bedeutung für den Leser (als Sympathieträger und Identifikationsfigur) und beleuchten die Beziehung zwischen Watson und Holmes als komplementäre Figuren. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt die Einleitung als Einführung in die Thematik und die Forschungsfrage. Das Kapitel zu Watsons Funktion innerhalb der Erzählungen analysiert die "Watson-Perspektive" und den Kontrast zwischen Watson und Holmes. Das Kapitel zu Watson und dem Leser beleuchtet Watsons Funktion als Sympathieträger und Identifikationsfigur und die Gratwanderung zwischen Bewunderung und Verständnis für Holmes.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Sherlock Holmes, Dr. Watson, Detektivgeschichte, Erzählperspektive, Ich-Erzähler, Komplementärfigur, Identifikationsfigur, Spannung, Sympathieträger, Deduktion, Charakterisierung und Erzähltechnik.
Warum ist Dr. Watson eine wichtige Figur, obwohl Sherlock Holmes der zentrale Detektiv ist?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage. Watson dient als Ich-Erzähler, vermittelt die Geschichte aus einer menschlichen Perspektive, schafft einen Kontrast zu Holmes' genialer, aber oft unzugänglicher Natur und fungiert als Sympathieträger und Identifikationsfigur für den Leser, wodurch die Geschichten zugänglicher und spannender werden.
Welche Rolle spielt die "Watson-Perspektive"?
Die "Watson-Perspektive" als Ich-Erzähler-Perspektive beeinflusst die Spannung und den Informationsfluss für den Leser. Watsons begrenztes Wissen im Vergleich zu Holmes' scharfer Beobachtungsgabe erzeugt Spannung und Bewunderung für Holmes. Gleichzeitig ermöglicht Watsons Perspektive ein menschlicheres Verständnis der Ereignisse.
- Quote paper
- Janine Erne (Author), 2009, Wozu braucht es Dr. Watson? Sherlock Holmes Begleiter und seine Funktion in Arthur Conan Doyles Detektivgeschichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155506