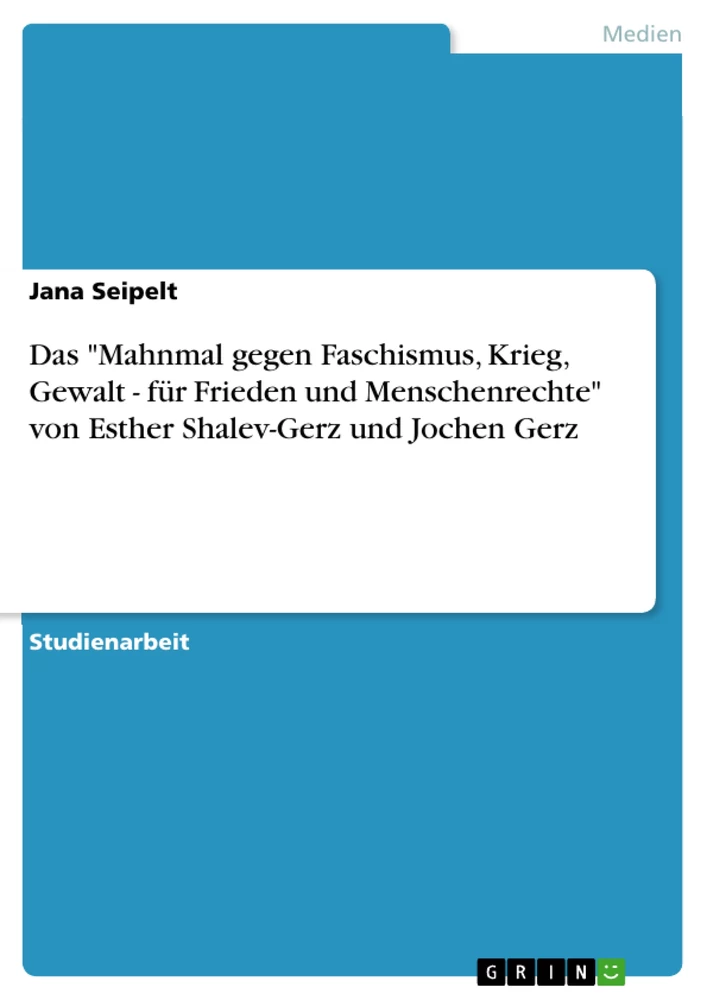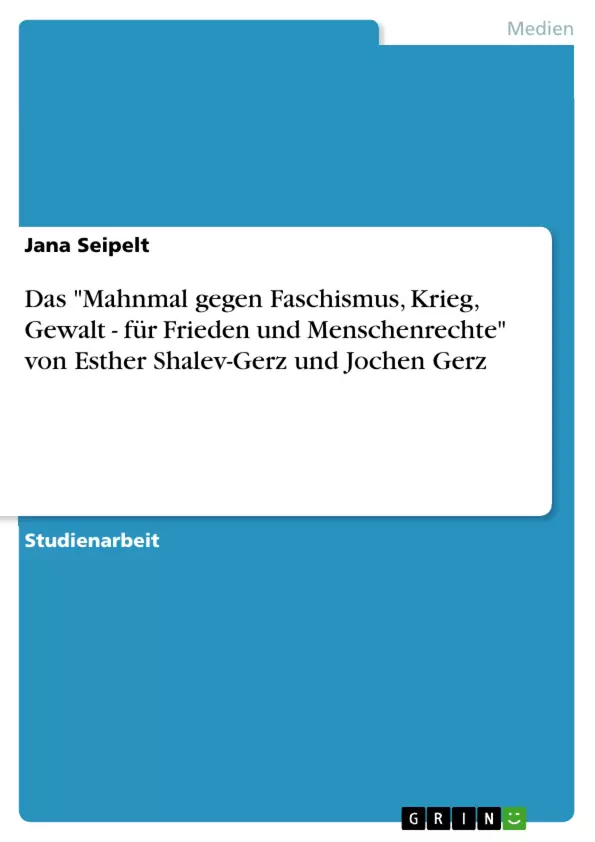Das "Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt – für Frieden und Menschenrechte" in Hamburg-Harburg (1986-1993) von Jochen Gerz entsteht in Zusammenarbeit mit seiner damaligen Frau, der Bildhauerin Esther Shalev-Gerz. Der deutsche Künstler Jochen Gerz, dessen Interesse der Literatur gilt, arbeitet seit den 1967er Jahren im Bereich der Visuellen Poesie. Seine häufig im öffentlichen Raum entstehenden Arbeiten suchen eine Verbindung zwischen Bild und Wort. Seit der Installation "EXIT – Material. Zum Dachau-Projekt" von 1972-74 wendet sich Gerz verstärkt in seinen Arbeiten den Themen des Gedenkens zu und zur Diagnose einer Kultur, für die alle verantwortlich sind. Diesem Schlüsselwerk folgen viele weitere Arbeiten zu diesen Themen. In dieser Reihe gliedert sich auch das "Mahnmal gegen Faschismus" ein, das eine mehrjährige Arbeit im öffentlichen Raum darstellt und in dem sich die Thematik des Gedenkens mit dem Prinzip der Interaktion verbindet. Die Idee für das Mahnmal war von der Hoffnung der Künstler getragen „die Bürde der Erinnerung an diejenigen zurückzugeben, die später danach suchen würden“. Dabei missachtet es eine ganz Reihe von konventionellen Merkmalen von Mahnmalen.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das "Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt – für Frieden und Menschenrechte" von Jochen Gerz und Esther Shalev-Gerz. Beginnend mit einigen Überlegungen zur Herausbildung eines „öffentlichen Gedächtnisses“, rückt das Mahnmal selbst in den Vordergrund. Dabei gilt hier insbesondere die Frage nach der Bedeutung der Öffentlichkeit zu klären, da die Öffentlichkeit beziehungsweise die öffentliche Auseinandersetzung ein wesentliches Material des Kunstwerkes darstellt. In einem weiteren Schritt nähere ich mich dem Gerz’schen Mahnmal von der Entwicklung des traditionellen Denkmals her und gegrenzt es davon ab. Ein Mahnmal, das als Reagenzglas angelegt ist, ist das noch ein Mahnmal? Woran wird gemahnt? Diesen Fragen folgend, wende ich mich im Anschluss dem Thema des Ephemeren zu. Geht das Konzept von Gerz auf, dass durch das Verschwinden des Mahnmals – wenn uns also die Sichtbarkeit genommen wird – uns ebenfalls die Möglichkeit zu verdrängen entzogen wird? Mit anderen Worten gesagt, gelingt es, dass das verschwindende Mahnmal von Hamburg-Harburg zu „einem Messer in einer offenen Wunde“ wird?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Schaffung eines öffentlichen Gedächtnisses
- Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt – für Frieden und Menschenrechte – das Gerz'sche Gegenmonument
- Konzept versus Ausführung
- Der Dialog mit der Öffentlichkeit
- Gegen-Monument
- Das Phänomen des Verschwindens
- Schlussbetrachtung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt - für Frieden und Menschenrechte von Jochen Gerz und Esther Shalev-Gerz. Sie untersucht die Herausbildung eines „öffentlichen Gedächtnisses“ im Kontext der Erinnerungskultur nach dem Nationalsozialismus und die Einordnung des Mahnmals in diesen zeitlichen Entstehungskontext.
- Die Entstehung eines öffentlichen Gedächtnisses in den 1980er Jahren und die Auseinandersetzung mit dem Holocaust.
- Die Idee des Gerz'schen Mahnmals und seine Entstehungsgeschichte.
- Die Rolle der Öffentlichkeit und die öffentliche Auseinandersetzung als wesentliches Material des Kunstwerks.
- Die Abgrenzung des Gerz'schen Mahnmals vom traditionellen Denkmal und das Konzept des Verschwindens.
- Die Frage, ob das verschwindende Mahnmal von Hamburg-Harburg zu „einem Messer in einer offenen Wunde“ wird.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort stellt das Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt - für Frieden und Menschenrechte von Jochen Gerz und Esther Shalev-Gerz vor und gibt einen Überblick über die künstlerische Arbeit von Jochen Gerz im Kontext des Gedenkens. Es wird zudem die Thematik des Gedenkens und die Interaktion mit der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Mahnmal beleuchtet.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehung eines öffentlichen Gedächtnisses in den 1980er Jahren. Es beschreibt die Ausprägung einer Erinnerungskultur, die sich insbesondere auf den Holocaust konzentriert. Darüber hinaus wird der Bruch in der Denkmaltradition nach 1945 und die Frage nach einer authentischen Kunst der Erinnerung diskutiert.
- Im dritten Kapitel wird das Gerz'sche Mahnmal selbst in den Fokus gerückt. Die Idee des Mahnmals und seine Entstehungsgeschichte werden beleuchtet. Anschließend wird der Aspekt der Öffentlichkeit und die Rolle der Signatur im Kontext des öffentlichen Raums untersucht.
- Das vierte Kapitel betrachtet das Mahnmal aus der Perspektive der Entwicklung des traditionellen Denkmals und grenzt es davon ab. Es wird die Frage gestellt, ob das Konzept des Verschwindens, wie es Gerz anstrebt, tatsächlich die Verdrängung der Vergangenheit verhindern kann.
Schlüsselwörter
Öffentliches Gedächtnis, Erinnerungskultur, Holocaust, Mahnmal, Denkmal, Jochen Gerz, Esther Shalev-Gerz, Interaktion, Öffentlichkeit, Verschwinden, Tradition, Konzept, Ausführung, Gegen-Monument.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Harburger Mahnmal von Jochen Gerz?
Es ist ein „Gegen-Monument“, das darauf ausgelegt ist, durch das Versenken in den Boden physisch zu verschwinden, um die Erinnerung in die Verantwortung der Bürger zu übergeben.
Welche Rolle spielte die Öffentlichkeit bei diesem Kunstwerk?
Die Bürger waren aufgerufen, ihre Namen auf die Bleimantel-Säule zu gravieren. Diese Interaktion und die daraus resultierenden Diskussionen waren wesentlicher Bestandteil des Mahnmals.
Wogegen richtet sich das Mahnmal offiziell?
Es ist ein Mahnmal gegen Faschismus, Krieg und Gewalt sowie für Frieden und Menschenrechte.
Was bedeutet der Begriff „Gegen-Monument“?
Es bezeichnet Kunstwerke, die traditionelle Merkmale von Denkmälern (wie Ewigkeit und Sichtbarkeit) ablehnen und stattdessen auf Vergänglichkeit und aktive Auseinandersetzung setzen.
Wer sind die Künstler hinter dem Projekt?
Das Mahnmal wurde von Jochen Gerz in Zusammenarbeit mit der Bildhauerin Esther Shalev-Gerz realisiert.
- Quote paper
- Jana Seipelt (Author), 2010, Das "Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt - für Frieden und Menschenrechte" von Esther Shalev-Gerz und Jochen Gerz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155528