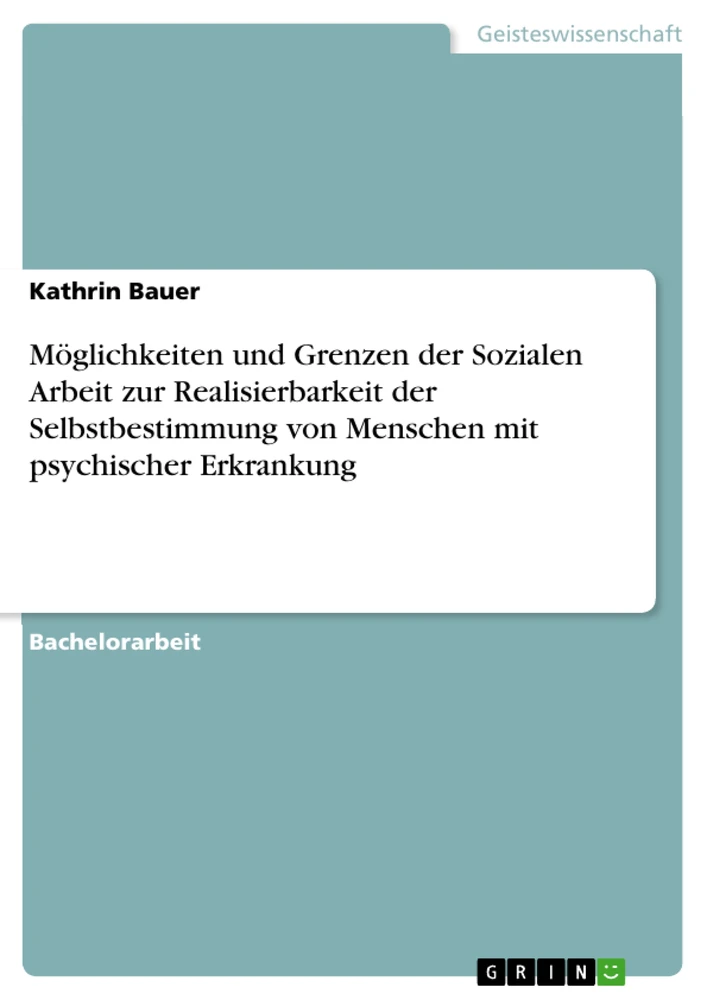Aus Sicht der Sozialen Arbeit werden sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen sowie Handlungsansätze aufgezeigt, die auf die Realisierbarkeit von Selbstbestimmung in der Arbeit mit Menschen mit psychischer Erkrankung abzielen. Im beruflichen Alltag stationärer sowie auch ambulanter Psychiatrie ist der schmale Grat zwischen Selbst- und Fremdbestimmung allgegenwärtig. Einerseits geht es um das Selbstbestimmungsrecht der uns anvertrauten Menschen, andererseits erleben genau diese Menschen Übergriffe, die mit Gewalt und Zwang einhergehen.
Diese Arbeit widmet sich übergeordnet den folgenden Leitfragen:
Mit welchen Möglichkeiten können Fachkräfte die Betroffenen professionell dabei unterstützen ihre Rechte auf Selbstbestimmung realisierbar und geltend zu machen? Wo stoßen sie an Grenzen und wie sehen diese aus?
Zur theoretischen Einbindung werden unter anderem Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und Dieter Röh herangezogen.
Darüber hinaus wird in Anbetracht des oftmals immer noch stigmatisierenden Umgangs mit psychischen Erkrankungen durch die Gesellschaft, die Relevanz dieses Themas verdeutlicht und als Gegenstand eines aktuellen, sozialpolitischen Diskurses dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Psychische Erkrankungen
- 2.1. Geschichtlicher Hintergrund der Psychiatrie
- 2.2. Beispiel - Affektive Störung
- 2.3. Beispiel Angststörung
- 3. Selbstbestimmung - Rechte und Grenzen
- 3.1. Begriffsbestimmung
- 3.2. Menschenrechte und Grundgesetz
- 3.3. UN-Behindertenrechtskonvention
- 3.4. Bundesteilhabegesetz
- 3.5. Psychisch-Kranken-Gesetz
- 3.6. Paternalismus
- 4. Theoretische Grundlagen
- 4.1. Salutogenese
- 4.2. Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession nach Staub-Bernasconi
- 4.3. Soziale Arbeit als Daseinsmächtige Lebensführung nach Röh
- 5. Methoden zur Realisierbarkeit von Selbstbestimmung
- 5.1. Empowerment
- 5.2. Psychoedukation
- 5.3. Case Management
- 5.4. Recovery
- 5.5. Open Dialogue
- 6. Fazit & Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit, die Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu fördern. Die Arbeit basiert auf persönlichen Erfahrungen der Autorin im Bereich der Psychiatrie und der Gemeindepsychiatrie. Ziel ist es, handlungsrelevante Ansätze aufzuzeigen und die Herausforderungen in diesem Kontext zu beleuchten.
- Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Rechte und Grenzen der Selbstbestimmung im Kontext psychischer Erkrankungen
- Theoretische Grundlagen der Sozialen Arbeit im Umgang mit Selbstbestimmung
- Methoden zur Förderung von Selbstbestimmung in der Sozialen Arbeit
- Herausforderungen und Grenzen sozialer Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das persönliche Interesse der Autorin an dem Thema Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, basierend auf ihren Erfahrungen in der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gemeindepsychiatrie. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit in diesem Kontext und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2. Psychische Erkrankungen: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über psychische Erkrankungen bei Erwachsenen und beleuchtet den historischen Kontext der Psychiatrie, um die aktuelle Relevanz des Themas zu verdeutlichen. Zwei Beispiele psychischer Erkrankungen (affektive Störungen und Angststörungen) werden genauer beschrieben, um das Verständnis zu fördern.
3. Selbstbestimmung - Rechte und Grenzen: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesetzlichen Grundlagen und rechtlich festgelegten Möglichkeiten und Grenzen der Selbstbestimmung. Es werden Menschenrechte, das Grundgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention, das Bundesteilhabegesetz, das Psychisch-Kranken-Gesetz und der Aspekt des Paternalismus in der Sozialen Arbeit diskutiert.
4. Theoretische Grundlagen: Das Kapitel etabliert einen theoretischen Rahmen für die Arbeit, indem es das salutogenetische Modell von Gesundheit und Krankheit sowie die Theorien der Sozialen Arbeit von Silvia Staub-Bernasconi und Dieter Röh heranzieht. Diese theoretischen Ansätze bilden die Basis für die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen sozialer Interventionen.
5. Methoden zur Realisierbarkeit von Selbstbestimmung: In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden und Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Selbstbestimmung in der Praxis vorgestellt und erläutert, einschließlich Empowerment, Psychoedukation, Case Management, Recovery und Open Dialogue. Die Kapitel beschreibt die praktische Anwendbarkeit der verschiedenen Methoden.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmung, psychische Erkrankung, Soziale Arbeit, Menschenrechte, Empowerment, Psychoedukation, Case Management, Recovery, Open Dialogue, Paternalismus, Salutogenese, Gesetzgebung, Stigmatisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Einleitung; Psychische Erkrankungen (mit Unterpunkten zu historischem Hintergrund der Psychiatrie, Affektive Störung, Angststörung); Selbstbestimmung - Rechte und Grenzen (mit Unterpunkten zu Begriffsbestimmung, Menschenrechte und Grundgesetz, UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesteilhabegesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Paternalismus); Theoretische Grundlagen (mit Unterpunkten zu Salutogenese, Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession nach Staub-Bernasconi, Soziale Arbeit als Daseinsmächtige Lebensführung nach Röh); Methoden zur Realisierbarkeit von Selbstbestimmung (mit Unterpunkten zu Empowerment, Psychoedukation, Case Management, Recovery, Open Dialogue); Fazit & Schlussfolgerung.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte?
Die Bachelorarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit, die Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu fördern, basierend auf persönlichen Erfahrungen. Zu den Themenschwerpunkten gehören: Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Erkrankungen; Rechte und Grenzen der Selbstbestimmung im Kontext psychischer Erkrankungen; Theoretische Grundlagen der Sozialen Arbeit im Umgang mit Selbstbestimmung; Methoden zur Förderung von Selbstbestimmung in der Sozialen Arbeit; Herausforderungen und Grenzen sozialer Interventionen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt das persönliche Interesse der Autorin an der Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, basierend auf Erfahrungen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gemeindepsychiatrie. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Was beinhaltet das Kapitel über psychische Erkrankungen?
Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über psychische Erkrankungen bei Erwachsenen und beleuchtet den historischen Kontext der Psychiatrie. Es werden Beispiele für affektive Störungen und Angststörungen gegeben, um das Verständnis zu fördern.
Welche Themen werden im Kapitel über Selbstbestimmung - Rechte und Grenzen behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit den gesetzlichen Grundlagen und rechtlich festgelegten Möglichkeiten und Grenzen der Selbstbestimmung. Es werden Menschenrechte, das Grundgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention, das Bundesteilhabegesetz, das Psychisch-Kranken-Gesetz und der Aspekt des Paternalismus in der Sozialen Arbeit diskutiert.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Arbeit herangezogen?
Das Kapitel etabliert einen theoretischen Rahmen, indem es das salutogenetische Modell von Gesundheit und Krankheit sowie die Theorien der Sozialen Arbeit von Silvia Staub-Bernasconi und Dieter Röh heranzieht.
Welche Methoden zur Realisierung von Selbstbestimmung werden vorgestellt?
Es werden verschiedene Methoden und Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Selbstbestimmung in der Praxis vorgestellt, einschließlich Empowerment, Psychoedukation, Case Management, Recovery und Open Dialogue.
Welche Schlüsselwörter werden in der Arbeit verwendet?
Die Schlüsselwörter umfassen: Selbstbestimmung, psychische Erkrankung, Soziale Arbeit, Menschenrechte, Empowerment, Psychoedukation, Case Management, Recovery, Open Dialogue, Paternalismus, Salutogenese, Gesetzgebung, Stigmatisierung.
- Citar trabajo
- Kathrin Bauer (Autor), 2022, Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit zur Realisierbarkeit der Selbstbestimmung von Menschen mit psychischer Erkrankung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1555616