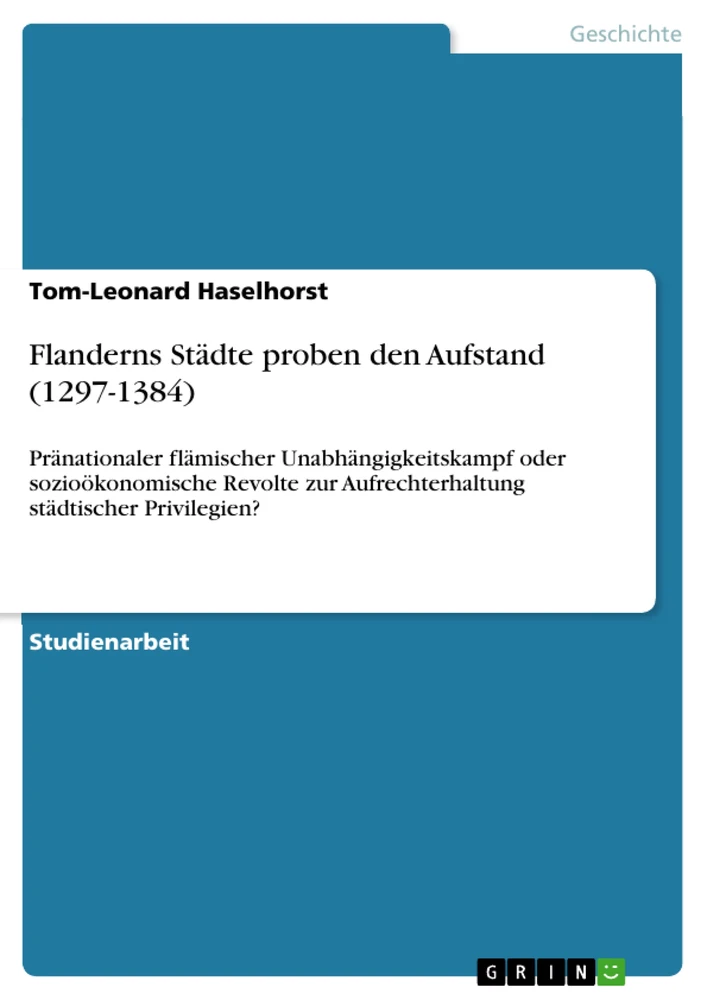Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die flandrischen Revolten im 13. und 14. Jahrhundert in das Konzept des Pränationalismus passen oder, ob es sich dabei lediglich um nicht zusammenhängende Strohfeuer handelt, die mehr ökonomisch, denn national-kulturell motiviert sind.
Im Lichte der in der Geschichtswissenschaft anscheinend vorherrschenden Auffassung darüber, dass der Begriff des Nationalismus hauptsächlich auf das 19te und die erste Hälfte des 20sten Jahrhunderts sinnvoll anwendbar sei, mag es anmaßend verstanden werden, wenn ich nun den sprichwörtlichen Hut für einen Pränationalismus in Flandern während des Spätmittelalters in den Ring werfe. Dies veranlasst mich in diesem Zuge eine Vorankündigung über die Sinnhaftigkeit einer Thesenbildung in diesem Felde zu verfassen.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
I.I. Vorgehen, These und thematische Einordnung
II. Beginnender Nationalismus im Mittelalter? Perspektiven und Ansätze
II.I. Forschungsansätze Hastings, Beumann, Graus, Ehlers
II.II. Position und Ansatz dieser Arbeit
III. Auftreten pränationaler Indikatoren in Flandern (c.1300-c.1385)
III.I. Französische Besatzung und Sporenschlacht (1297-1302)
III.II. Flämischer Aufstand (1322/23-1328)
III.III. Flandern im Hundertjährigen Krieg bis Crecy (1337-1346)
III.IV. Die Herrschaft Ludwigs II. Graf von Flandern (1346-1384)
IV. Fazit
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
I. Einleitung
Im Lichte der in der Geschichtswissenschaft anscheinend vorherrschenden Auffassung darüber, dass der Begriff des Nationalismus hauptsächlich auf das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sinnvoll anwendbar sei, mag es anmaßend verstanden werden, wenn ich nun den sprichwörtlichen Hut für einen Pränationalismus in Flandern während des Spätmittelalters in den Ring werfe. Dies veranlasst mich in diesem Zuge eine Vorankündigung über die Sinnhaftigkeit einer Thesenbildung in diesem Felde zu verfassen.
Wenn man das Wörtchen Prä ausblendet und den Begriff Nationalismus zu Nationalstaat umformt, kann wohl niemand abstreiten, dass erstens Belgien nun eben tatsächlich erst 1830 unabhängig geworden1 und zweitens den nördlichen Niederlanden, also den Vereinigten Provinzen, nach einem achtzigjährigen Unabhängigkeitskrieg gegen das habsburgische Spanien, erst am Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 ihre staatliche Souveränität als Republik vom übrigen Europa anerkannt worden ist.2 Nun waren beide nationale Konstrukte, Belgien und die Niederlande, seit ihrer Gründung von Zeiten der Besatzung3, äußerer Einflussnahme4, innerer Unruhen oder Spannungen5 als auch von selbstoder fremdverschuldeten Kriegen6 betroffen. Dennoch bestehen sie bis heute, mit Landesflaggen, die zuallererst nicht das Königshaus, die Herrschenden, sondern die nationale Einheit als Volk beschwören.
Und doch kann wohl niemand ernstlich behaupten, die nationalen Ideen seien urplötzlich, wie ein Paukenschlag und aus einem unergründlichen Dunkeln in der Geschichte aufgetaucht und hätten feudale Strukturen und Ideen von Gebietsherrschaft augenblicklich und überall in gleichem Maße unwiederbringlich aus den Angeln gehoben. Lehnt man sich aus dem Fenster, kann man sogar die These denken, erst die repressive Politik der Monarchen Europas, die nach 1815 sehr wohl noch lange als selbstbewusste Herrscherhäuser auftraten7, bei gleichzeitiger eigennütziger Instrumentalisierung und Vergiftung nationaler, völkischer Ideen über das 19. Jahrhundert hinweg bis 1918, hätten die Vorhänge geöffnet für das wohl dunkelste, nur mit Abscheu und purer Verachtung zu betrachtende Kapitel europäischer, aber speziell deutscher Geschichte in den Jahren 1933 bis 1945. Hier zeigt sich, wie sehr die Vorstellung einer Nation sehr wohl noch lange Hand in Hand ging mit vermeintlich vergangenen Ideen von Staat und Gesellschaft.
Napoleon indes, der in Fragen des beginnenden europäischen Nationalismus gewöhnlicherweise hoch gehandelt wird, hat, das kann man kaum abstreiten, ab 1800 sicherlich sein Übriges zu einer Dynamik gegeben, die wohl schon weitaus früher, auch schon vor den aufklärerischen Gedanken der Staatsphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts und in Gestalt oft anderer Indikatoren als auch vor dem Hintergrund anderer sozioökonomischer Rahmenbedingungen, ihre Wurzeln zu haben scheint. Ein geschichtstheoretisches Nebelfeld zwischen Hochmittelalter und Neuzeit, zwischen einem Feudalismus der Personenherrschaft und dem Nationalkönigtum oder, wenn es an einem gottgegebenen Herrscher mangelte, dem republikanischem Nationalstaat muss offenbar noch weiter gelichtet werden.
Solche Indikatoren, die von diversen Historikern in unterschiedlicher Ausprägung bereits erdacht worden sind, sollen durch mich in der nun folgenden Arbeit deshalb noch ergänzt und ausgeführt werden und insbesondere auf ihre Existenz im spätmittelalterlichen Flandern und seiner Umgebung hin untersucht werden. Dabei bleibt bei aller Mutmaßung doch schon jetzt die Erkenntnis: Ob pränationale Elemente und Dynamiken in Flandern vor der beginnenden Frühen Neuzeit nun zu erkennen sein werden oder nicht, ein Abstreifen äußerer Usurpatoren zugunsten eines entstehenden Nationalstaates, wie ihn die nördlichen Niederlande erkämpften, ist den südlichen Provinzen bis ins 19. Jahrhundert letztendlich nie gelungen und vielleicht auch nie die bessere Option gewesen.
Abschließend muss angemahnt werden, dass die Anwendung des Nationenbegriffs auf das Mittelalter in dieser Arbeit nicht dazu führen darf, dass das neuzeitliche Verständnis von Gestalt und Bedeutung einer Nation schlicht auf vormoderne, in diesem Fall spätmittelalterliche, Phänomene und Ereignisse gestülpt wird. Ich hoffe, dass mir dies nach besten Kräften gelingt.
1.1. Vorgehen, These und thematische Einordnung
Grundlegender Ausgangspunkt der hier vollzogenen Untersuchung ist die Fragestellung nach einem theoretischen Konstrukt des Pränationalismus in Flandern und den flämischen Regionen des heutigen Belgiens zwischen 1300 und 1384. Dies scheint mir deshalb passend, da der Konflikt der Grafschaft Flandern mit dem französischen König Philipp IV. dem Schönen zu Beginn des 14. Jahrhunderts ausbrach und bis heute als nationalidentitäres, flämisches Ereignis verstanden wird8, außerdem auch der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England im 14. Jahrhundert ausbrach9, wobei zeitweise auch insbesondere die flandrischen Städte eine Nebenrolle einnahmen10, und letztlich die Burgunderherrschaft 1384 nach dem Tod Ludwigs II. von Male einkehrte und Flandern anders als bisher zu prägen begann.11
Um die Frage annähernd beantworten zu können, ist es zunächst erforderlich eine These zu pränationalen Indikatoren und deren Auftreten in dem genannten Zeitraum zu formulieren:
Die für ihre Zeit ungewöhnliche Macht und Wirtschaftskraft der flämischen, insbesondere der flandrischen Städte und die unvergleichliche Bevölkerungsdichte der Region, die periphere Lage der Region gegenüber den großen hegemonialen Anspruchstellern von außen bei gegebener Bedeutung genannter Städte als Zentrum und Monopolregion ebendieser Peripherie, sowie eine sich entwickelnde niederländisch-flämische Sprache und (Arbeits-) Kultur (Handwerk, Webereien, Binnen- und Hanseschifffahrt, Händlertum) hat während des Zeitraumes zwischen 1297 und 1384 dazu geführt, dass die erblich und oder lehensrechtlich legitimierte oder militärisch erzwungene Zugehörigkeit zu größeren Staatengebilden der Umgebung nie ohne anhaltenden oder immer wiederkehrenden Protest und Widerstand der Flamen stattgefunden hat, der seinerseits, wie auch alle zuvor genannten Faktoren, selbst Ausdruck und Grundlage einer vornationalen flämischen Identität im Spätmittelalter war. Erst die Angliederung an Burgund schwächte die pränationale Dynamik zunächst wieder ab.
Um die These ihrerseits prüfen zu können, soll im Folgenden zunächst ein Blick auf einige Forschungsmeinungen zu einem Nationalismus im Mittelalter geworfen werden und deren Erkennungsmerkmale beschrieben werden, um dann die zentralen Punkte der obigen These noch einmal zu beschreiben. Anschließend werden dann die zentralen Widerstands- und Krisenereignisse zwischen 1297 und 1384, also der Konflikt mit dem französischen König zu Beginn des 14. Jahrhunderts, die Beteiligung der flandrischen Städte während des Hundertjährigen Krieges und die Eingliederung in den burgundischen Staat erläutert, immer unter Berücksichtigung der zuerst behandelten pränationalen Indikatoren und deren Auftreten und Wirken während der Ereignisse.
Zum Schluss, so das angestrebte Ziel, soll dann auch deutlich werden, ob die von mir erdachten Indikatoren überhaupt eine Bedeutung für den Verlauf und die Gestalt der Konflikte hatten und warum sie zum Schluss nicht zu einem eigenen Flämischen Staat geführt haben, während die nördlichen Niederlande später sehr wohl ihre Unabhängigkeit und vollständige Souveränität erstritten.
II. Beginnender Nationalismus im Mittelalter? Perspektiven und Ansätze
Bis heute scheint die Übertragung des Nationenbegriffs auf das Mittelalter in der deutschen Geschichtswissenschaft trotz entsprechender inhaltlicher Transformation und Anpassung ein Wagnis zu sein. Dies jedenfalls lässt sich aus der eher spärlichen Auswahl an deutschsprachigen Texten zum Thema schließen, wenngleich es doch solche gibt. Womöglich erklärt sich dieses Bild aus der negativen Assoziation mit dem Nationalismus in Deutschland. Im Folgenden habe ich plakativ einige unterschiedliche Perspektiven aufgeführt, um die Komplexität des Problems nur anzudeuten.
II.I. Forschungsansätze Hastings, Beumann, Graus, Ehlers.
Hastings
Adrian Hastings fand sich 1997 vor ähnliche Herausforderungen in der Ordnung und Erarbeitung von Ansichten und Kriterien für einen vormodernen Nationalismus gestellt wie ich zum Zeitpunkt der hier verfassten Arbeit. In seinem ebenda erschienenen Buch The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism. beklagt Hastings einen vorherrschenden Konservatismus in der Nationalismusforschung, die sich schwer damit tue, von einer modernistischen These zurückzuweichen, wenngleich sie bereits damals schon von einigen Historikern aus der Mittelalterforschung kritisiert worden war.
Hastings vermutet seinerseits, dass der entscheidendste Faktor für die Entwicklung eines Nationalgefühls umgangssprachliche Verbreitungsmedien literarischer Art seien12 und lange Widerstände gegen externe Bedrohungen ebenso signifikante nationale Effekte hervorrufen könnten. Dabei folge die Nation einem schon bestehenden Staat oder gehe aus ihm hervor, sei aber in jedem Fall in unmittelbarer Wechselwirkung mit ihm. Eine Ethnie als Bestandteil jeder Nation sei dabei eine solche Gruppe von Menschen, die durch Sprache und Kultur eine eigene Identität ausbilden. Ethnien verschwänden nicht zugunsten der Nation, sondern bedingten diese. Die Nation jedoch sei das gesellschaftliche Konstrukt mit dem stärkeren Selbstbewusstsein, das politische Unabhängigkeit, Volksautonomie und Territorium anstrebe. Der Nationalstaat erhebe sein Nationalvolk idealerweise auf Augenhöhe mit den staatlichen Institutionen und mache sich und sein Bestehen zumindest in gewisser Weise abhängig vom Nationalbegriff.13 Nationalismus sei im 19. Jahrhundert als Theorie und Praktik entwickelt worden, die den Wert der eigenen ethnischen oder nationalen Traditionen und Kulturen über denjenigen anderer äußerer Gruppen oder den vorherrschenden Staat stelle. Dies, so Hastings, könne man aber auch schon lange vor dem 19. Jahrhundert entdecken.
Und letztlich sei es die Religion, die sowohl Staatsidee als auch Kultur und gesellschaftliches Leben maßgeblich beeinflusse und somit alle Grundlagen der Nationenbildung von Beginn an infiltriere und vorausgestalte. England sei für eine solche vormoderne Nationenbildung prototypisch.14
Beumann
Schaut man sich Helmut Beumanns Sammelbandbeitrag Zur Nationenbildung im Mittelalter aus dem Jahr 1986 an, dann wird seine ablehnende Haltung gegenüber einem vorschnellen Rückschluss des Wortes Nation auf das im Mittelalter verwendete Wort natio deutlich, das in seiner Bedeutung nämlich mehr oder weniger das Gegenteil der modernen Nation ausdrücke. Es bezeichne eher den Stammbaum und die Abstammung innerhalb eines Stammes und damit eben nicht die Einheit eines Volkes, jenseits familiärer Grenzen.15
Vorsicht sei außerdem dabei walten zu lassen, Deutungsmuster der Moderne ungeprüft an das Mittelalter heranzutragen, „wenn er [der Mediävist] in ihm Nationen, deren Bildung oder wenigstens deren Wurzeln zu suchen unternimmt.“16 Er verdeutlicht aber unter Bezugnahme auf Walter Schlesinger, dass man vergeblich nach konkreten Begriffen zur Nationalidee in mittelalterlichen Quellen suchen würde, weil die Idee von Nation, wenn sie denn in irgendeiner Form existiert hat, dort nicht in Worten oder Begriffen allgemeingültig und wiedererkennbar formuliert worden sei.17
Beumann meint also, dass man zwar Kategorien von Nationalismus im Mittelalter finden könne, diese jedoch aus dem neuzeitlichen Verständnis kämen, wenngleich dies, also das fehlende nationale Selbstbewusstsein in Wort und Schrift während des Mittelalters, aber nicht bedeute, dass derlei Dynamiken nicht dennoch existiert haben könnten.18
Graus
Zeitgleich zu Beumann hat auch Frantisek Graus mit seinem Eintrag Nationale Deutungsmuster der Vergangenheit in spätmittelalterlichen Chroniken einen Ansatz gefunden, der sich jedoch stärker auf das Auftreten unterschwelliger, vornationaler Andeutungen in Schriftquellen beschränkt.
Er hält das Spätmittelalter für den Ausgangspunkt eines neuartigen Bewusstseins über Eigenes und Fremdes in Europa, allerdings nicht überall und nicht als Ergebnis einer linearen Entwicklung. Vielmehr sei das Bild von Wellen und Brüchen geprägt und vor allem dann habe es punktuelle Kristallisationen nationaler oder völkischer Abgrenzung in den Niederschriften gegeben, wenn zuvor eine siegreiche Schlacht zur richtigen Zeit, bei richtiger Dringlichkeit geschlagen worden war.19
Und auch Begriffe zur Beschreibung großer Territorien in Chroniken meinten zunächst keine nationalen Volksterritorien moderner Denkart, sondern schlicht „[transpersonale] Begriffe, die zur Symbolisierung von Gebieten oder von Herrschaftsbereichen verwendet wurden, [...], wie etwa [...] die Polonia, die Francia, [der] Reichsbegriff oder [...] Corona, regnum.“20
Ehlers
Zuletzt, um dann aber aus dieser Arbeit über pränationale Muster im spätmittelalterlichen Flandern keine rein begriffstheoretische, historiographische Untersuchung zu machen, soll Joachim Ehlers mit seinem Sammelbandbeitrag Was sind und wie bilden sich nationes im mittelalterlichen Europa aus dem Jahr 1995 zu Wort kommen.
Er bekräftigt in ihrem Sinne die Aussagen Hastings, wenn er schreibt, gerade starke Dynastien wie Frankreich hätten es seit dem Mittelalter verstanden, durch eine relative Kontinuität in der Erweiterung und Sicherung ihrer Herrschaftsräume, ganz automatisch auch einen politisch-rechtlichen Raum und damit gleichzeitig einen real-nationalen Staat geschaffen zu haben, in dem das einfache Volk nun schlicht keine große Wahl gehabt habe als sich selbst zu Frankreich zu zählen, und der später in der Französischen Revolution nur in seiner politischen Struktur verändert werden würde.21
Er weist außerdem auf eine Dynamik hin, nach der im Spätmittelalter Herrschaften, wie das englische Königreich oder das burgundische Herzogtum, in Konfrontation mit Frankreich und oder dem Reich dazu provoziert worden seien, auch endlich eine nationale Theoriebildung anzustoßen, um manifestes Herrschaftsgebiet jenseits von Erbrecht oder Lehensbindung legitimieren zu können.22
Fest steht für Ehlers aber, dass vor einem Bewusstsein für Volk und Nation in jedem Fall eine lange Tradition einer Dynastie, eines Reiches oder zumindest eines Staatswesens Voraussetzung gewesen sei.23 Das Vorhandensein einer königlichen Dynastie sei im Spätmittelalter für nationale Empfindungen unabdingbar gewesen, weil sie als Institution für die Beherrschten zum Abbild von Kontinuität, Tradition und gemeinsamer Geschichte und Krisenerfahrung von Volk und ebenjener Dynastie geworden sei.24
II.II. Position und Ansatz dieser Arbeit
Sowohl Hastings, Beumann, Graus und auch Ehlers führen Punkte an, die ich argumentativ gänzlich nachvollziehen kann und nicht abstreiten würde. Gleichzeitig wurde zu Beginn dieser Arbeit angekündigt, dass hier über bestehende Ansätze, von denen es auch noch reichlich weitere als diejenigen der vier erwähnten Autoren gibt, für den Sonderfall Flandern hinaus gegangen werden soll. Daher wird im Folgenden nun noch einmal die These konkretisiert, um anschließend auf die Aspekte, inhaltlich und auf Flandern bezogen, einzugehen:
1. Die Macht der Städte
Ein wohlhabendes, für das eigene Auskommen selbst verantwortliches und fähiges Stadtwesen in Flandern verfügt über einen erheblichen wirtschaftlichen Hebel gegenüber dem flandrischen Grafen, den sie zum eigenen Vorteil ausnutzen. Als Schmelzziegel von Produktion, Handel und Logistik in jedweder Form haben die Städte für den Grafen darüber hinaus strategische Bedeutung, denn ohne Unterstützung der Städte ist die tatsächliche Souveränität der Grafschaft nach außen hin nicht zu gewährleisten, weil dies ohne deren Waffen, Soldaten, Versorgung und Finanzierung nicht denkbar wäre. Dieses Übergewicht geht gleichzeitig mit einer unvergleichlichen Zahl an Einwohnern und einem hohen Urbanisierungsgrad einher. Daraus resultiert ein städtebürgerliches Selbstbewusstsein der ganzen Region.
2. Monopolregion und Peripherie gleichermaßen
Flandern, sowie auch die übrigen Niederlande, liegen aus Sicht der Einflussnehmer und Anspruchssteller England, Frankreich und dem deutschen Römischen Reich peripher, insofern als dass einerseits die Herrschaftszentren der Hegemonialmächte in einiger Entfernung liegen, viel mehr aber noch deren tatsächliche Gebiets- und Kulturmittelpunkte. Außerdem werden die Niederlande nordwestlich nur von der Nordsee begrenzt und bilden im Südosten zeitweise den jeweils äußersten Rand französischer und römisch-deutscher Lehensbesitzungen. Weder betrachten sie selbst sich, noch werden sie durch die umliegenden Reiche als deren Kernland betrachtet und haben daher leichteres Spiel äußeren Einflüssen zu entgehen. Insbesondere deshalb, weil sie trotz ihrer peripheren Lage für sich selbst ein eigenes Zentrum von Wirtschaft, Kultur und Sprache sind. Auch dies fördert den Eigenes-Fremdes-Gegensatz und damit eine vornationale Identität.
3. Regionaltypische Sprache und (Arbeits-)Kultur
Die beiden zuerst erwähnten Punkte bedingen den dritten und werden durch ihn bedingt. Daher soll der Punkt Sprache und Kultur nicht verschwiegen werden, aber in der Analyse etwas weniger Aufmerksamkeit erhalten. Die Abgelegenheit von anderen (Kultur- und )Sprachräumen, gewissermaßen auch die Position Flanderns zwischen ebendiesen und die spezifischen Anforderungen einer besonders herausfordernden naturräumlichen Umgebung, kreieren eine eigene Sprache, sowie eine regionaltypische Arbeitskultur, die sich im Wesentlichen durch Landgewinnung, Deichbau, Viehwirtschaft, Handwerk und Binnen-, sowie Seeschifffahrt ausdrückt und überregional erkannt und anerkannt wird.
III. Auftreten pränationaler Indikatoren in Flandern (c.1300-c.1385)
Die ausformulierte These wird in diesem Teil der Arbeit inhaltlich geprüft und untersucht, indem auf die 90 Jahre von Widerstand und Krieg in und um Flandern geschaut wird, um konkrete Ereignisse mit den pränationalen Indikatoren verknüpfen zu können und um dabei zu versuchen, deren markanten Einfluss auf den Verlauf der flandrisch-flämischen Geschichte zu bekräftigen. Jeden einzelnen Aufstand tiefgehend zu analysieren würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, jedoch möchte ich alle bedeutenden Aufstände und Auflehnungen gegen fremde Besatzer zumindest erwähnen und kurz erklären, wenngleich ich nicht jedem Beispiel dieselbe Aufmerksamkeit schenken kann.
III.I. Französische Besatzung und Sporenschlacht (1297-1302)
Im Jahr 1300, das den inhaltlichen Beginn der hier durchgeführten Untersuchung markiert, ereignete sich in Flandern eine Auseinandersetzung, die das Abhängigkeitsverhältnis des flandrischen Grafen von seinen Städten zu der Zeit klar präsentiert.
Graf Gui de Dampierre von Flandern erhielt sein Lehen ursprünglich vom französischen König und hatte in den vergangenen Jahren seit 1294 versucht, seine Souveränität gegenüber der französischen Krone auszuweiten, indem er sich stattdessen dem englischen König angenähert und ihn als Oberlehnsherren über Flandern anerkannt hatte, was sich allerdings als fatal erwies, da König Philipp IV. dann 1297 allen englischen Schutzbekundungen zum Trotze in Flandern einfiel und Graf Gui de Dampierre von Flandern und seinen Sohn Robert, sowie viele adlige Flamen Gefangen nahm.25
Glaubt man der Chronique des Pays-Bas erhoben sich im selben Jahr, als der französische Statthalter James de Saint-Pol gerade in Paris war, die unteren Schichten der Brügger Stadtgesellschaft unter der Führung eines Jehan Biede und zogen nach Malle, um es einzunehmen und zu plündern. Anschließend seien die Massen wieder nach Brügge zurückgekehrt.26 Und dies blieb nicht die einzige Gegenwehr in Reaktion auf Frankreichs Bemühungen die Region zu unterwerfen.
Denn schon 1301 erfolgte eine weitere Revolte in Brügge. Zwar standen die reichen Patrizier Brügges den französischen Besatzern Flanderns tendenziell kollaborativ gegenüber, jedoch schlossen sich erneut die in deutlicher Überzahl befindlichen, einfacheren Schichten der Kaufmanns-, Handwerks- und Gewerbetreibendengilden der Widerstandsbewegung der Grafstreuen an, auch weil Graf Gui den Gilden zuvor eine Partizipation am Stadtgouvernement als Gegengewicht zu den Patriziern ermöglicht hatte. Graf Gui selbst hatte Interesse daran, die Macht der Franzosentreuen unter den städtischen Eliten langfristig zu untergraben.27
An dieser Stelle findet also eine Zusammenarbeit zwischen flandrischen Arbeitern und dem flandrischen Grafen statt, wobei sich erstere schlicht durch ihren eigenen Grafen besser vertreten zu sehen schienen als durch die französischen Besatzer. Dennoch bleibt die Vermutung im Raum, dass eine grundsätzliche Aversion gegenüber den Franzosen vorherrschte. Diese wird, wie wir sehen werden, auch kontinuierlich aufrechterhalten werden.
Der Gegensatz von Königstreuen und Grafstreuen, das heißt von profranzösischen Flamen und antifranzösischen Flamen, wird in der zeitgenössischen Quelle der Annales Gandenses eines anonymen Autors deutlich, indem dieser, als er über das Jahr 1302 berichtet, von „Liliardi“28 spricht und damit, abgeleitet von der französischen Lilie, die Königstreuen in Abgrenzung zu den Grafstreuen bezeichnet. Der ebenfalls zeitgenössische Autor Lodewijk van Velthern geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet die Grafstreuen als Liebaarte, das auf den Löwen im flandrischen Wappen anspielt, während die Königstreuen auch Liliarde sind.29
Nun ist dies allein sicherlich noch kein Zeichen pränationaler Identität, ist die Begriffswahl doch nach wie vor stark auf die Herrschenden oder Anspruchsteller jeweiliger Gebiete bezogen, dennoch bilden die teils niederländisch formulierten Äußerungen der beiden Quelltexte zumindest sprachlich eine wahrgenommene Affinität gegenüber der flämischen Gruppe bei gleichzeitiger Aversion gegenüber der französisch-orientierten Gruppe. Es wird ein Fremdenbild geschaffen und offenbar eine unterschiedliche Bewertung der Herkunft vorgenommen.
Um nun den Bogen zur Bedeutung der Städte in diesem Konflikt zu schlagen, muss erwähnt werden, dass es diese sogenannten Löwen und Lilien nicht nur in Brügge gab, sondern sich dieser Gegensatz auch in anderen Städten und sogar kleineren Kommunen Flanderns bemerkbar machte, sich aber letztendlich wieder in Brügge entlud.30
Der Webergildenführer Peter Conink31 organisierte zu Beginn des Jahres 1302 ein Ereignis, das später Brügger Mette genannt werden würde und bei dem die ansässige königlichfranzösische Garnison größtenteils ermordet worden ist.32
Die Annales Gandenses beschreibt die Ausgangslage: „Around mid-winter [1301, Peter der Weberführer] made a powerful impression on the weavers, fullers, and other commoners, attracting them by his eloquence [...]. As a result, the king’s chief officer, the aldermen, and the patricians of Bruges dared not to touch him or his associates. Towards the end of winter, when spring was breaking, the envoys from Bruges were unable to conclude their law suit in the king’s court against the count of Saint-Pol and his brother; nor could they recover their liberties and privileges; they returned angrily and indignantly to Flanders.”33
Bei aller Ablehnung gegenüber den Franzosen, schienen die Brügger also zunächst zumindest mit den neuen Herren zu verhandeln, um ihre traditionellen Rechte zu bewahren, was ihnen aber nicht gelang. Versuchten sie nur das Beste aus der Besatzungszeit zu machen und sich bis zur erhofften Rückkehr ihres alten Grafen über Wasser zu halten oder waren es am Ende gar nur die städtischen Privilegien, nicht etwa die Vorstellung eines gemeinsamen, freien Flanderns, das die Städte gegen die Franzosen trieb?
Laut den Genter Annalen schien der Frust über die Benachteiligung unter den Franzosen jedenfalls so groß gewesen zu sein, dass Peter Conink, als er von der erfolglosen Verhandlung erfahren hatte, alle Befehle zum Abriss der Festung Brügges durch den Statthalter James de Saint-Pol für nichtig erklärt habe, was die Königstreuen aus der Stadt getrieben habe.34
Und auch in Gent seien im Frühjahr 1302 aufgrund der Steuerlast, die beschlossen worden sei, um die Geschenke der Städte an den Statthalter zu bezahlen, Tumulte los gebrochen, nachdem die Besatzer unzufriedene, streikende Arbeiter mit dem Tod bedroht hätten, würden sie nicht ihrem Gewerbe nachgehen. Sie hätten nach einiger Zeit im Geheimen die Waffen erhoben und die Garnison, sowie viele Patrizier und Hochrangige, sofern sie sich nicht unterwarfen, ermordet.35
Die Arbeiter, nicht die Eliten, nicht der Graf selbst, wendeten sich gewaltsam gegen die ausländischen Besatzer und trugen wenig später unter Mithilfe gräflicher Familienmitglieder bei der Schlacht von Kortrijk am 11. Juni 1302 entscheidend zum Sieg über ein überlegenes, französisches Ritterheer bei. Dabei stellten die flämischen Kommunen und Städte das Heer36, ohne das die gräfliche Heerleitung nicht einmal die Schlacht hätte antreten können. Die Folge waren eine deutliche rechtliche Berücksichtigung und Schutz der Gilden durch die Grafschaft, sowie die vorläufige Verbannung königstreuer Patrizier unter Beschlagnahmung ihrer Besitztümer, wenngleich jene 1305, nach dem Tod Graf Guis und einem Friedensschluss mit Frankreich durch Robert III. Graf von Flandern, teilweise wieder zurückkehrten und Schlüsselrollen in den Städten zurückgewannen.37
Allerdings, so argumentiert David Nicholas, sei es nicht etwa so gewesen, dass die Gilden nicht hierarchisch organisiert und die Gildenführer einfache Handwerker gewesen seien.
Das Gegenteil war der Fall und von einer Demokratisierung in den Städten nach dem Sieg über Frankreich könne keine Rede sein. Die Analogie zum 19. Jahrhundert scheint angesichts der revoltierenden einfachen Bürger fast perfekt, wäre es nicht die Wiedereinsetzung des eigenen Grafen, das die Revoltierenden zum Ziel gehabt hätten. Bei aller Macht, bei allem entscheidenden Einfluss, den die Städter und einfachen Arbeiter bei der Befreiung ihres Landes hatten, war es offenbar doch nie ihr Ziel eine Städterepublik oder sogar eine flandrische Republik zu gründen. Dies, so macht es zumindest den Anschein, verhielt sich zeitweise anders, als der flämische Aufstand 20 Jahre später ausbrach.
III.II. Flämischer Aufstand (1322/23-1328)
Die Entschädigungsleistungen, die der neue Graf Robert III. nach dem Krieg an Frankreich leistete, waren so immens, dass die erforderliche Steuerpolitik wieder neue Gräben zwischen Graf und Städten zog, sodass Robert III. 1312 in Gent eine grafstreue Stadtregierung einsetzte, die 1319 zumindest wieder ein wenig partizipativer geworden ist, aber der Stadt gleichzeitig auch ein Sonderprivileg als einzige Stätte der Kleiderproduktion im Umkreis von 8km gewährte.38
Es ist davon auszugehen, dass er die Einnahmen Gents durch die Monopolstellung erhöhen und somit den Druck der Steuerlast senken wollte. Es zeigt sich also, dass zwar die Vertreibung der Franzosen durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Graf und Städten sicherlich als standesübergreifendes, flämisches Gemeinschaftswerk betrachtet werden kann39, das möglicherweise so etwas wie pränationale Ressentiments gegenüber den Lilien geschürt hat, jedoch scheint kurze Zeit später jener flämische Geist unter der ächzenden Steuerlast in Folge des Friedensschlusses mit Frankreich in Schall und Rauch vergangen zu sein und man haderte mit dem Grafen, auch wenn er ein Flame war.
Hinzu kamen auch wirtschaftliche Talfahrten im Vergleich früherer Jahre, da der schwelende Englisch-Französische Konflikt und der damit einhergehende geringere Wollimport aus England seit Ende des 13. Jahrhunderts mit einer geringeren Nachfrage nach flandrischer Kleidung im Mittelmeerraum einhergingen und so die Einnahmen rapide absanken. So herrschte im Zeitraum der Besatzung hohe Erwerbslosigkeit.40 Dies förderte sicherlich den Griff zur Waffe.
Bei allem Groll gegenüber den gräflichen Steuerforderungen blieb die grundsätzliche Aversion gegenüber Frankreich unter den Städtern und Bauern aber nach 1302 bestehen. In den Jahren 1309, 1311 und 1316 hatte es immer wieder kleinere Unruhen und Revolten gegeben, die Graf Robert III., wie oben bereits erwähnt, zumindest zu lindern versuchte. Als er aber 1322 starb und der französisch gesinnte, weil dort aufgewachsene, Ludwig II. von Nevers als Graf Ludwig I. von Flandern die Regentschaft übernahm, brach 1323 ein unvergleichlicher Aufstand los, diesmal gegen den eigenen Fürsten, statt als Abwehrkampf gegen konkrete, französische Invasoren.
Ludwig I. war fahnentreu gegenüber dem französischen König, wie allerdings auch im 1320 festgelegten Vertrag zwischen Robert und dem französischen König manifestiert.41 Er schaffte es jedenfalls kurzfristig noch einmal die Wogen zu glätten, dabei halfen ihm neben seinem Onkel Graf Robert von Cassel auch städtische Vertreter aus Brügge, Gent und Ypern.42 Schon im Spätsommer 1324 aber, wenige Monate nach der erfolgten Besänftigung, erhob sich zunächst die Bauernschaft erneut, dann aber auch wieder Teile der Stadtbevölkerung, unter anderem Brügges.43
In der Chronicon comitum Flandrensium beschreibt der Autor die Abgaben, die die Städte 1324 dem Grafen leisten mussten wie folgt:
„Now that the count had returned from Flanders the aldermen and councillors hat to make good their promise of a gift to the count. To pay for it, they taxed the commoners [ populares ] at rates that sparked great grumbling among them.”44
Es war also nicht nur die francophile Einstellung Ludwigs I., sondern eben auch die Steuerlast, die zum Aufstand führten.
Die Anciennes Chroniques de Flandre führt den Aufstand einzig auf einen Nikolaas Zannekin zurück, was offensichtlich nicht der gesamten Tragweite des übergreifenden Widerstandes entspricht:
„Clais [ Nikolaas ] Sannequin [ Zannekin ] [...] declared and insisted that the governors of Flanders did not govern the country at all according to ancient customs. In a short space of time, he attracted great numbers of commoners to his side [.]. They began murdering and putting to death the chief officers and governors of the country [.].”45
Zu Beginn des Jahres 1325 ging Robert von Cassel dann pflichtbewusst rücksichtslos gegen die Aufrührer in Brügge unter Leitung jenes Nikolaas Zannekin vor, was eine Spirale der Gewalt und eine Eskalation des Aufstands zur Folge hatte.46 Im selben Jahr versuchten Weber in Gent die städtische Regierung, die bisher noch dem französisch gesinnten Grafen zugetan war, zum Seitenwechsel zu bringen, hatten aber keinen wirklichen Erfolg.47
Jenseits der Genter Stadtmauern brodelte jedoch eine Aufstandsbewegung, die das zwischenzeitliche Ziel einer autonomen Kommune gegen die Herrschaft eines Grafen formulierte48, zumindest, wenn man den Erwähnung der Chronicon Flandrensium Glauben schenkt, und beträchtliche militärische Erfolge und eine zunehmende Ausbreitung erfuhr:
„And the commoners rebelled [...] in the territories of Brabant, Bruges, Veurne, Berg-op-Zoom, and elsewhere. They elected captains for their fortresses and against the law formed squadrons. They marched out and captured all the councilors, aldermen, lords, and tax collectors. Once the lords had fled, they destroyed their homes.”49
Dies setzte Graf Ludwig I. nun erheblich unter Druck. Gent und Ypern blieben jedenfalls noch loyal und am 24. März 1325 gelang es von dort entsandten städtischen Vertretern und Robert von Cassel einen vorläufigen Waffenstillstand mit den Aufständischen zu schließen. Ein Frieden blieb aber aus und der Kampf ging im selben Jahr weiter.
Es tat sich sogar zu, dass das eigentlich aufständische Kortrijk eine Gesandtschaft aus Brügge im Angesicht nahender gräflicher Soldaten kurzerhand festsetzte und einen Schulterschluss mit Ludwig I. erwartete. Als dann aber eine Brügger Miliz anrückte, um die Gesandtschaft zu befreien und das gräfliche Heer daraufhin überstürzt Feuer in der naheliegenden Vorstadt legte, schlugen die Flammen auf die Kortrijker Altstadt über, was zu einem plötzlichen Umschwung der Stadtbevölkerung gegen die Soldaten des Grafen führte. Die Situation eskalierte in einer Straßenschlacht zwischen Bürgern und Soldaten, wobei viele Adelige und Grafstreue getötet wurden und der Graf Ludwig I. selbst in Gefangenschaft landete.50 Das am nächsten Tag eintreffende Heer der Brügger wurde dann wiederum freudig von der Miliz Kortrijks empfangen und ihm wurde die Brügger Gesandtschaft offenbart und ausgehändigt. Zeitgleich belagerten Aufständische Ypern51, wo sich die verbliebenen Bürger dem Aufstand augenblicklich anschlossen, franzosentreue Patrizier aber schon vorher geflohen sind.52
Die Chronicon comitum Flandrensium dazu:
„While this revolt was gaining strength, Clais [ Nikolaas ] Zannekin gathered the people of Veurne and ordered them to advance on Ypres to rouse the people to revolt and take over the city. On hearing this and being afraid of their commoners, the patricians secretly fled the city and left Flanders altogether.”53
Alle Kommunen Flanderns, bis auf Gent und sein Umland, waren im offenen Aufstand gegen den französisch gesinnten Grafen von Flandern, der nun auch noch in ihrer Gewalt war.
Die Revolte kann bis dato als bäuerlich-städtischer, anti-französischer, flämischer Volksaufstands verstanden werden, zeitgleich aber auch als antidynastische Bewegung, die Staat und Souveränität jenseits von gräflicher, gottgegebener Herrschaft denkt. Sie forciert eine pränationale Gemeinschaft, eben die Kommune, einfacher Bauern, Handwerker und Händler, verbunden durch eine flämische milieuspezifische Sprache, ähnlichen Stand, gemeinsame Arbeitskultur54, in Abgrenzung zum Französisch ihres Grafen oder den francophilen Patriziern der Städte und deren elitärer Lebensart. Diese angestrebte Volksautonomie entspricht auch dem Nationenkriterium Hastings, wenn dieser schreibt „it [die Nation] possesses or claims the right to political identity and autonomy as a people, together with the control of specific territory [... ].“55
Das anfängliche Glück des Aufstands aber wendete sich letztlich doch gegen seine Urheber und letztere wiederum vor allem gegen die ursprüngliche Idee. Denn am 30. Juni 1325 wurde der ehemalig grafstreue Robert von Cassel statt Ludwig I. als Regent Flanderns eingesetzt, weil er jüngst massive Verwerfungen mit letzterem zu beklagen hatte und außerdem im Abwehrkampf gegen Frankreich 20 Jahre zuvor treu an der Seite der flandrischen Städte gestanden hatte.56
Gent, aus dessen Mitte ein Gegenkandidat, nämlich der aus Kortrijk geflohene Johann von Namur, ernannt worden ist, wurde bald nach Robert von Cassels Regentschaftsübernahme militärisch konfrontiert.57 Auch wenn Erfolge zunächst geliefert werden konnten, schaffte es Gent immer wieder sich gegen Infiltration, Anstachlung und militärischen Druck zu behaupten.
Das Ziel einer vereinten flämischen Kommune also noch nicht erreicht, sahen sich die Aufständischen, scheinbar so kurz vor ihrem Ziel, der Intervention des französischen Königs Karls IV. des Schönen Ende 1325 gegenüber (der Nachfolger Philipps IV. des Schönen, Philipp V. starb bereits 1322), der dann in den kommenden Monaten einen harten Frieden gegen die Aufständischen durchsetzen konnte, welcher sie stark belastete und Graf Ludwig I. wieder einsetzte.
Trotz allem begann Brügge 1327 erneut mit Kampfhandlungen gegen Gent, woraufhin den Städtern eine päpstliche Exkommunizierung drohte, bevor es 1328 ein letztes Mal offen gegen Graf Ludwig revoltierte. Die Aufständischen wurden in der Folge dann mehrmals exkommuniziert, zunehmend geschwächt, besiegt und im Spätsommer 1328 durch Philipp VI. von Frankreich zur Aufgabe gezwungen.58 Er habe, so die Chronik, die Bedürfnisse der Aufständischen missachtet und stattdessen deren Dörfer verbrannt und ihre Kinder und Frauen ermordet, um ein Zeichen zu setzen.59
Mit den Rädelsführern sei man wie folgt verfahren:
„he was tied to a cart and led naked through all the streets of Bruges. He was burnt little by little with a red-hot poker and then dragged to the scaffold, where his back and limbs were broken. He was then beheaded, put on a wheel, and suspended with this wheel on another hangman’s noose, high above for his followers to gaze upon him in awe; thus he received a punishment equal to the crimes he had committed.”60
Die Flamen waren also offen bereit dazu das päpstliche Urteil zugunsten einer eigenen Autonomie zu missachten, was zweifellos für ein erhebliches Selbst- und Existenzbewusstsein spricht und hier definitiv als pränational einzuordnen ist. Sie bemerkten den Zusammenhang von Religion und Staat und wollten ihn scheinbar bewusst überwinden.61
Grund dafür, dass die aufständischen Städte Flanderns überhaupt derart lange erfolgreich sein konnten und sich diverse Male gegen ihre Feinde, zu Beginn des 14., aber auch im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts durchsetzen konnten, kann auch auf die enorme Einwohnerzahl zurückgeführt werden, die in diesem Zeitraum für Brügge etwa bei 46000 und für Gent bei etwa 64000 lag.62
Hinzu kam ein bereits erwähntes Netz aus verschiedenen Gilden, in Flandern insbesondere den Bogen- und Armbrustgilden, die laut Laura Crombie der Hauptgrund für den Sieg des flandrischen Städteheers bei Kortrijk 1302 waren.63
Die Ressourcen menschlicher und materieller Art, die die Städte schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts bereitstellten, scheinen ein Grundpfeiler ihrer Fähigkeit gewesen zu sein, sich gegen unliebsame Grafen, aber auch gegen äußere Usurpatoren zur Wehr zu setzen und verschafften der flämischen Gemeinschaft aus Bauern, Städtern und, der Hierarchie entsprechend, teils auch Patriziern, die Mittel ihre eigene Identität und Rechtsvorstellung zu wahren und das eigene Schicksal zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
Dass aber während der bisher vorgestellten Aufstände und Unruhen immer wieder einzelne Städte die Fronten wechselten und mal zum Aufstand, mal zum französisch gesinnten Grafen hielten, wässert die Fürsprache einer möglichen pränationalen Dynamik hingegen auf.
Andererseits, so argumentiert auch Graus64, definiert sich die mittelalterliche Vorform der späteren Nation nicht durch Linearität, sondern durch Brüche und Kristallisation an Schlüsselereignissen, derer es in der flandrischen Geschichte sicher einige gibt, wenn auch wenige so glänzend sein mögen, wie der Sieg 1302, der immerhin das weitere Fortbestehen der Grafschaft Flandern besiegelte.
Besiegelt aber wurde, um die Geschichte des Hauses Dampierres weiter zu führen, auch das Ende Ludwigs I., als er 1346 in den Wirren des Hundertjährigen Krieges auf Seiten der Franzosen auf dem Schlachtfeld von Crecy starb.65 Dem vorweg gegangen war aber eine massive Einmischung des englischen Königs 1336 in die Grafschaft Flandern, um diese zum Verbündeten für den nahenden Krieg mit Frankreich zu gewinnen.
Der englische Eduard III. wollte von dort aus mit seiner Invasionsarmee operieren, als er aber den Grafen, Ludwig I., nicht als Bündnispartner gewinnen konnte, setzte er die flandrischen Webergilden der Städte Gent, Brügge und Ypern mit einem Exportverbot für billige, englische Wolle wirtschaftlich unter Druck, die wiederum kurzerhand ihren Grafen und diejenigen vertrieben, die zu ihm hielten und 30.000 englische Soldaten in Flandern aufmarschieren ließen.66
Gründe sich gegen Frankreich zu wenden, hatten die Flamen nach den leidhaften Erfahrungen, die sich an die Niederlage von 1328 anknüpften, genug und der Aufstand der flämischen Massen gegen die französischen Unterdrücker dürfte in seiner inhaltlichen Gestalt, aber auch in seiner eigenen Kulturwerdung, weil er Tradition und Erinnerung wurde67, als pränationale Dynamik verstanden werden.
III.III. Flandern im Hundertjährigen Krieg bis Crecy (1337-1346)
Flandern war, wie im Folgenden deutlich wird, von Beginn an in die englisch-französischen Auseinandersetzungen im Rahmen des Hundertjährigen Krieges während des 14. Jahrhunderts involviert und wird noch vor dessen vorläufigem ersten Friedensschluss 1386 an Burgund fallen und im neuen großburgundischen Staat aufgehen. Daher lohnt sich auch in dieser Zeit der Umbrüche der Blick auf die flandrischen Städte.
Ohne nun in dieser Arbeit zu sehr auf die Ursprünge des Hundertjährigen Krieges einzugehen, soll doch erwähnt sein, dass das Konfliktpotenzial zwischen den heute gemeinhin England (zunächst Haus Plantagenet, später Lancaster) und Frankreich (zunächst Haus Capet, später Valois) genannten Kontrahenten seit Beginn des 13. Jahrhunderts in erster Linie in den beidseitig umfangreichen Territorialbesitzungen68 im Gebiet des heutigen Frankreichs lag.
Nach Eroberungskriegen durch Valois bis 1224 waren alle englischen Besitzungen bis auf Aquitanien unter Oberherrschaft des Hauses Capet gelangt.69 Dabei muss sich vor Augen geführt werden, dass hier nicht zwei Nationalstaaten miteinander gerungen haben, sondern feudale Lehensbeziehungen Grundlage von Gebietsherrschaft waren und die Lehnsherren ihre Hausmacht tendenziell ausweiten wollten.
1254 erkannte Ludwig IX. von Frankreich jedenfalls den englischen König Heinrich III. als seinen Vasallen in Aquitanien an.70 1259 wurde dann endgültig die Aufgabe aller Ansprüche auf die meisten französischen Besitzungen durch Heinrich III. erklärt, der im Gegenzug jedoch Aquitanien wieder seinem Haus unterordnen durfte.
Jedoch war damit keine langfristige Lösung gefunden worden und schon in den 1270er Jahren, unter den neuen französischen Königen Philipp III. und dem hier schon bekannten Philipp IV., brachen neue Feindseligkeiten mit England aus.71 Diese sollten noch lange schwelen und nur ein Vorgeplänkel zum großen Konflikt darstellen.
1328, das Jahr, in dem der flämische Aufstand vorerst niedergeschlagen und im Keim erstickt worden war, war das Todesjahr des letzten Vertreters des französischen Hauses Capet, Karl IV. Der Enkel des ehemaligen Königs Philipp IV., der einst Flandern besetzt hatte und in der Sporenschlacht von Kortrijk vernichtend geschlagen worden war, war Philipp von Valois, Spross eines anderen Adelshauses. Da dieser Philipp von Valois aber der nächste Verwandte des verstorbenen Karls IV. war, folgte er ihm als Philipp VI. schließlich ohne große Widerstände auf den Thron.72
Er stärkte seit 1328 den Einfluss und die Autorität der französischen Krone in Flandern. Jedoch sahen vor allem Gent und Brügge den englischen König Edward III. als möglichen Verbündeten gegen diese Fremdherrschaft an.73
1337 ordnete Philipp VI. die Konfiszierung der englischen Gascogne, also Aquitaniens an74, womit der Krieg im Grunde genommen ausbrach.
In Flandern hatten Gents Gilden, die sich im flämischen Aufstand noch den francophilen Aristokraten der Stadt unterlegen sahen, inzwischen rapide an Macht und Zahl gewonnen75 und sicherlich ihren Beitrag zum politischen Kurswechsel zugunsten Englands beigetragen, da sie im Dezember 1337 unter der Führung eines Jacob van Artevelde gegen den Grafen und seine Statthalter revoltierten.76 Gleichzeitig hatten die Gilden dabei bereits gegeneinander um die Macht in der städtischen Regierung gerungen und die Revolte dieser Tage, stand in einem anderen Licht und war von anderer Gestalt als diejenigen der Jahre 1323-1328.77
Wie bereits beschrieben, hatte Edward III. im Vorfeld gezielt die Wollexporte nach Flandern boykottiert, um die Webergilden zu Ungunsten der Patrizier und anderer Gilden auf seine Seite zu ziehen. Flandern sollte dann auch der Ausgangspunkt der aktiven Kampfhandlungen sein78, offensichtlich ist dabei die Brückenkopffunktion, die es einnehmen würde - die ehemaligen englischen Besitzungen in Nordfrankreich waren ja schon lange nicht mehr in eigener Hand.
Dieser Umstand überschneidet sich mit der in der These geäußerten Vermutung, dass die Peripheriestellung Flanderns vorteilhafte Auswirkungen auf die flämische Unabhängigkeit hat, denn hatte man Edward III. einmal im Lande, konnte man ihn selbst mit Mitteln und Soldaten der Monopolregion unterstützen und die eigenen Anliegen über das Medium England vertreten lassen, eben weil Edward III. selbst auf Flandern angewiesen war. Läge Flandern nicht so östlich abgelegen von Frankreich an der Küste, wäre diese relativ sichere Brückenkopffunktion natürlicherweise nicht gegeben.
Aber auch die Macht der Städte und dem voran gehend die Bedeutung der zahlreichen und viele Mitglieder zählenden Gilden, samt kulturellem, milieuspezifischen Bewusstsein als Arbeiterschaft, trugen zur eigenen Souveränität bei, da man ja den unliebsamen Grafen kurzerhand vertreiben konnte. Diese Arbeit hat bisher schon des Öfteren aufgezeigt, dass die wenigen Eliten in der Regel keine absolute Herrschaft über die Massen der Arbeitsstätten ausüben konnten.
1338 jedenfalls landete Edward III. mit tausenden Soldaten in Antwerpen, jedoch haben hoher Unterhalt und Ziellosigkeit in der eigentlichen Operation der Invasionsarmee den Wind aus den Segeln genommen, sodass kein Kampf stattfand, sondern Edward III. die geografische Nähe zum deutschen Römischen Reich nutzte und mit Kaiser Ludwig IV. in diplomatischen Austausch trat.79
1339 sagte der zunächst auf Neutralität bedachte Van Artevelde in Gent Edward III. seine Unterstützung zu.80
Erst im Spätsommer 1339 begann sich das englisch-flämische Herr Richtung Cambrai fortzubewegen. Es belagerte die Stadt und verheerte das Umland, lockte damit das französische Heer an, das jedoch am 23. Oktober bei Buironfosse nicht den Fehler beging in die englische Formation zu marschieren. Da zogen die mit England verbündeten Flamen, da keine Schlacht stattfand, unverrichteter Dinge ab. Die französische Heerführung aber blieb besonnen und wollte die Zeit für sich spielen lassen, so blieb ein Waffengang aus.81
Edward III., der zwar schon die Kampfhandlungen begonnen hatte, hatte noch keinen Anspruch auf den französischen Thron gestellt, tat dies dann aber in einer denkbar günstigen Lage, nämlich 1340 inmitten seiner potenziellen Fürsprecher in Gent, womit er umgehend sein Bündnis festigte. Sollte Edward sich behaupten, würden die aufständischen flämischen Städte nicht als Rebellen gegen den französischen Thron betrachtet werden.82 Ein Bündnis der Ablehnung gegenüber den in Frankreich herrschenden Valois war geschmiedet worden.
Doch als Edward III. dann bald wieder in England war, wurden die Engländer in den südlichen Niederlanden unter Druck gesetzt und erst die Schlacht bei Sluys am 24. Juni 1340, bei der ein Großteil der französischen Flotte und 15000 Mann Soldaten und Matrosen vernichtet worden waren, schenkte den Engländern und ihren Verbündeten eine Atempause.
Diese versuchten sie mit der Belagerung Tournais im selben Jahr für sich zu nutzen, konnten aber wieder aufgrund der langen Belagerungszeit und der hohen Unterhalts- und Versorgungskosten keinen wirklichen Erfolg erzielen und es wurde ein vorläufiger Waffenstillstand mit Frankreich geschlossen, der wohl im Sinne beider Parteien gewesen sein dürfte.83 Laut Prestwich sei diese Dynamik ein Vorgeschmack für noch folgendes Scheitern gewesen, „such as that at Reims in 1359. The capture of Calais in 1347 and of Rouen in 1419 were rare successes.“84
Es folgten ab 1342 noch weitere, fast belanglose Kämpfe in der Bretagne ehe, wieder Friedensverhandlungen stattfanden, die aber verworfen wurden und offensichtlich eine Entscheidungsschlacht erforderten.85
Diese folgte dann auch bald mit der am 26. August 1346 stattfindenden Schlacht von Crecy, bei der Ludwig I. Graf von Flandern nebst vieler anderer Adeliger aus Frankreich und anderen europäischen Verbündeten starb86 und die Engländer einen bedeutenden Sieg vom Felde trugen, aus dem ein fünfjähriger Waffenstillstand resultierte.87 Sein Sohn Ludwig von Male, ab 1346 Ludwig II. von Flandern, sollte der letzte in Flandern herrschende Vertreter des Hauses Dampierre sein, ehe Flandern dann 1384 an Burgund übergehen würde.88
III.IV. Die Herrschaft Ludwigs II. Graf von Flandern (1346-1384)
Graf Ludwigs II. Herrschaft war ebenfalls von diversen Widerständen geprägt, fand sie doch trotz Crecy noch in vollem Umfang während des Hundertjährigen Krieges statt. Vor den großen Revolten zwischen 1379 und 1385 aber war er in diverse kleinere Angelegenheiten im Umgang mit den mächtigsten Städten Flanderns verwickelt.
So wollte er ab 1348 deren Handlungsspielraum unterminieren, indem er die innerstädtischen Gilden gegeneinander und Dörfer gegen ihre Städte aufstachelte, was zu zahlreichen Machtkämpfen in Ypern, Kortrijk und Gent führte. Zwar konnte Gent der gräflichen Restriktion dennoch widerstehen, jedoch gingen sie letztendlich als Verlierer aus dem Konflikt. Erst 1360 würden die Städte ihre Rechte wiedererlangen, indem sie sich in einem breiten Bündnis aller Gilden organisierten.89
Kurz zuvor aber war Ludwig II. am 17. Juli 1359, abseits der Schlachtfelder des großen englisch-französischen Krieges, in einen Zwischenfall in Brügge verwickelt, der noch nicht auf gemeinsame Anstrengungen der Handwerker hindeutete.
Anders als noch 1323-1328 waren die Gilden wie erwähnt inzwischen zu erbitterten Rivalen geworden, weil sie nun selbst Einfluss und Stimmrechte in der städtischen Regierung erkämpft hatten.90
Der florentinische Chronist Matteo Villani berichtet erstaunt über die Zustände in Flandern Mitte des 14. Jahrhunderts. Nun habe nämlich Graf Ludwig II. die Bürger Brügges zusammengerufen und hat Recht sprechen wollen als sich ein Schuster gegen ihn erhoben und einen generellen Aufstand angezettelt habe. Die Webergilde habe eine derartige Machtergreifung nicht hinnehmen wollen und zu einer Gegenrevolte ermutigt, mit dem Ergebnis, dass sich die Brügger Handwerker gegenseitig auf dem Marktplatz niedergemacht hätten. Im Angesicht der Toten und Verwundeten hätten sie sich schlagartig dazu entschieden, drei Handwerker aus den verschiedenen Gilden die Stadtregierung übernehmen zu lassen, um den Streit beizulegen. Bei all der Aufruhr sei dem Grafen keinerlei Schaden zugefügt worden und keine der Aktionen sei gegen ihn gerichtet gewesen. Innerhalb kürzester Zeit habe sich die Bürgerschaft selbst ohne weiteres Blutvergießen befriedet.91
Diese Szene führt im Kontrast zu den Ereignissen im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts beinahe erschreckend vor Augen, wie die Erfolge der flandrischen Handwerker und Gilden letztendlich dazu geführt haben, dass sie einer gemeinsamen Idee von flämischer, unabhängiger Kommune mit einem Grafen nach eigenem Gusto den Wind aus den Segeln genommen haben. Graf Ludwig II. war sicherlich nicht sonderlich beliebt, doch die Rivalität der machtbewussten Arbeiter überschattete zunächst ein wenig den horizontalen soziostrukturellen Konflikt, sowie auch die Unzufriedenheit mit dem Grafen.
Kurz nach diesem Vorfall aber, so ist in der Cronica weiter zu lesen, habe Graf Ludwig II. den schicksalhaften Plan gefasst, seine Tochter mit dem Herzog von Burgund zu vermählen als eine Revolte in Ypern losgebrochen sei und er von den Eliten darum gebeten worden sei diese zu beenden und Recht zu sprechen. Diese Bitte habe er aufgrund der Hochzeitsvorbereitungen mit einer Gegenbitte auf zeitlichen Aufschub ausgeschlagen und sei dafür verspottet worden.92 Dies deutet darauf hin, dass es nach wie vor brodelte in Flandern und der Graf, in seine dynastischen Pläne verwickelt, geriet zwischen die Fronten seiner Städte und seiner Getreuen, was wiederum nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Aufstände sein würde.
Denn schon in den Jahren 1364 und 1368 revoltierte Gent erneut93, in den 1370er Jahren befand er sich im offenen Krieg mit einigen seiner Städte94, nachdem Flandern von 1368 bis 1372 stark von der Pest heimgesucht worden war.95
1379 löste der Sohn des Jacob van Artevelde, Philipp, einen Krieg der Städte, insbesondere Gents, gegen den Grafen Ludwig II. aus, doch handelte es sich hierbei weniger um einen völkischen Aufstand einfacher Arbeiter alter Manier (1323-1328)96, sondern die Städte waren, wie bereits angeklungen ist, inzwischen schon generell partizipativer regiert, sodass Ansprüche konkret von der Stadtregierung an den Grafen gestellt und notfalls militärisch untermauert wurden. Das Bild entrechteter Gilden in großen, landesweiten Massenaufständen, sowohl gegen Stadtaristokratie als auch gegen den Grafen, greift hier nicht mehr.
Und hier verlässt das Bild der Revolten auch bereits das Feld der pränationalen Aufstände gegen äußere Feinde und nicht-flämische Grafen. Vielmehr steuert die flandrische Protestkultur, das zeigt die Regentschaftszeit Ludwigs II. und die von der Flämischen Revolte stark abweichende Zielsetzung der Städte ab den späten 1330er Jahren, in eine Richtung, die von ökonomischen Interessen, rationalen Machtkämpfen einflussreicher Gildenführer, sowie von vorkapitalistisch handelnden Stadtregierungen geprägt ist.
1384 starb Ludwig II. von Flandern, der seine Grafschaft, aber auch Wallonisch Flandern mit Lille, Douai und Orchies, darüber hinaus Artois, Rethel, Nevers, die Freigrafschaft Burgund und die Städte Antwerpen und Mechelen an seine mit dem burgundischen Herzog verheiratete Tochter Margarete vererbte, woraufhin alle diese Besitztümer an das Herzogtum Burgund fielen und eine neue Ära für Flandern eingeläutet wurde.97
IV. Fazit
Was blieb also 1384 von den Bewegungen des frühen 14. Jahrhunderts in Flandern? Hatte es je so etwas wie eine gemeinschaftliche, bürgerliche Anstrengung einfacher Flamen zur identitären Abgrenzung nach außen gegeben? In gesellschaftlich-politischer Hinsicht war das bis Mitte der 1330er Jahre wohl der Fall und nie mehr als 1302, als man sich für den eigenen flämischen Grafen Gui de Dampierre gegen die französischen Besatzer erhob und sie bei Kortrijk aus dem Land jagte.
Der Flämische Aufstand von 1323-1328 rückte dann noch ein gänzlich neues Verlangen in den Vordergrund: Zu der Aversion gegenüber dem francophilen Grafen kam nämlich die kurzzeitige Idee ganz ohne einen Grafen als Freie Kommune Flandern einfacher Arbeiter bestehen zu können. Dies wurde aber, vielleicht aus realpolitischer legitimatorischer Notwendigkeit, vielleicht aufgrund fehlenden geopolitischen Selbstbewusstseins, als Option verworfen als man Robert von Cassel zum Grafen Flanderns als Alternative zu Ludwig I. berief. Verbreitungsmedien in hoher Stückzahl wie im 15. oder 16. Jahrhundert hatte es noch nicht gegeben, was ein Gemeinschaftsgefühl sicherlich hemmte.
Letztendlich jedenfalls konnte Flandern der Intervention des französischen Königs nichts entgegenhalten, doch sein Exempel, das er an den Flamen statuierte, feuerte den Franzosenhass sicherlich an. Und doch änderten sich bald die Zeiten, denn die Gilden und Zünfte strebten bald nach eigenem Einfluss in den Städten und arbeiteten dabei auch gegeneinander. Die Woll-Affäre Edwards III. von England schürte einen Aufruhr der Weber gegen Patrizier und andere Gilden, vertrieb Ludwig I. von Flandern und sorgte für den Schulterschluss der Städte mit England im Angesicht des nahenden Krieges. Hier nutze England Flandern als Brückenkopf und Flandern England als Medium zur Durchsetzung der eigenen antifranzösischen Interessen, was letztlich aber nur mäßig gelang und wohl auch schon stark ökonomisch, weniger identitär motiviert war.
Nach Crecy war Ludwig I. von Flandern zwar beseitigt, jedoch ließ sich Ludwig II. nicht davon abhalten in Flandern zu regieren und geriet ständig in Konflikte mit den Städten, während diese aber auch selbst von innerstädtischen Konflikten aufgefressen wurden, die immer weniger sozial oder pränational und immer mehr lokalpolitisch und ökonomisch verwurzelt waren. Die partizipativ, fast republikanisch regierten Städte, besonders deren Aristokraten und Gildenführer, hatten ihre Privilegien und ihren Reichtum in Rivalität mit anderen Städten und dem Grafen im Sinne und kein Interesse mehr an einem geeinten Flandern. Und auch die Aversion gegenüber Frankreich schien nicht mehr ausschlaggebend, wo es zum Ende hin ja dann auch Burgunder waren, die ins Land einfielen.
Die von mir kreierten Indikatoren für pränationale Erscheinungen während des 14. Jahrhunderts in Flandern waren zwar zu finden und hatten sicherlich über den gesamten Zeitraum hinweg eine Auswirkung auf die Proteste und Widerstände, doch wirkten sie sich nur zwischen 1297 und 1328 auf eine Weise aus, die man als pränationale flämische Unabhängigkeitsbewegung verstehen kann, die jedoch noch viel zu wenig idealisiert und mystifiziert und viel zu sehr situativ und auf einfache Bedürfnisse abgerichtet gewesen ist, als dass durch sie ein langer Atem in Richtung Flämischer Nation erzeugt werden konnte. Dennoch wirkte eben diese Zeit in der späteren nationalen Bewegung Belgiens auf eine eigene Weise weiter und wird daher in die spätere Volksidee inkorporiert.
Literaturverzeichnis
Beumann H., Zur Nationenbildung im Mittelalter. In: Otto Dann (Hrsg.), Nationalismus in vorindustrieller Zeit, München 1986, S. 21-23.
Clark C., Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600-1947, München 2007.
Cohn Jr. S.K., Lust for Liberty: The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425. Italy, France, and Flanders, Cambridge et al. 2008.
Cohn Jr. S.K., Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004.
Crombie L., Archery and crossbow guilds in medieval Flanders. 1300-1500, Woodbridge 2016.
Dumolyn J. et al., Social Groups, Political Power and Institutions II, c.1300-c.1500. In: Andrew Brown - Jan Dumolyn (Hrsg.), Medieval Bruges, c.850-1550, Cambridge 2018, S. 268.
Ehlers J., Der Hundertjährige Krieg, München 2009.
Ehlers J., Was sind und wie bilden sich nationes im mittelalterlichen Europa. In: Almut Bues - Rex Rexheuser (Hrsg.), Mittelalterliche nationes - neuzeitliche Nationen. Probleme der Nationenbildung in Europa, Wiesbaden 1995, S. 8-16.
Graus F., Nationale Deutungsmuster der Vergangenheit in spätmittelalterlichen Chroniken. In: Otto Dann (Hrsg.), Nationalismus in vorindustrieller Zeit, München 1986, S. 35f.
Günther K.H., Sizilianer, Flamen, Eidgenossen. Regionale Kommunen und das soziale Wissen um kommunale Conjuratio im Spätmittelalter, Stuttgart 2013.
Hastings A., The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge 1997.
Kershaw I., To Hell and Back. Europe 1914-1949, München 2016 (2015).
Kittell E.E., Death and taxes: mortmain payments and the authority of the Count in fourteenth-century Flanders. In: Continuity and Change 28 (2013) 2, Cambridge 2013, S. 197.
Neillands R., The Hundred Years War, London 2003 (1990).
Nicholas D., The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the Arteveldes, 1302-1390, Leiden 1987.
North M., Geschichte der Niederlande, München 2013 (1997).
Prestwich M., A Short History of the Hundred Years War, London - New York 2018.
Rosen G., Europa zwischen Restauration und Liberalismus. In: Gérard du Ry van Beest Holle (Hrsg.), Holle Universal Geschichte, Erlangen 1988, S. 536.
Stabel P. et al., Production, Markets and Socio-economic Structures I: c.1100-c.1320. In: Andrew Brown - Jan Dumolyn (Hrsg.), Medieval Bruges, c.850-1550, Cambridge 2018, S. 117f.
Wouters N., Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46, Zürich 2016.
Zolberg A.R., The Making of Flemings and Waloons: Belgium: 1830-1914. In: The Journal of Interdisciplinary History 5 (1974) 2, S. 183ff.
Quellenverzeichnis
Anciennes Chroniques de Flandre (in: Recueil des historiens des Gaules et de la France, XXII (Paris, 1894), pp. 418-19), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 38ff.
Annales Gandenses (ed. Hilda Johnstone (London, 1951), pp. 16-18), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 26f.
Annales Gandenses , übers. v. Frantz Funck-Brentano, hsrg. v. Alphonse Picard, Paris 1896.
Chronicon comitum Flandrensium (in: Corpus Chronicorum Flandriae, ed. J.-J. De Smet, Vol. I (Brussels, 1837), pp. 34-261), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 36-38.
Chronique des Pay-Bas, de France, etc. (in: Corpus Chronicorum Flandriae, ed. J.-J. de Smet, vol. III. (Brussels, 1856), pp. 121-2), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 25.
Cronica con la continuazione di Filippo Villani , (ed. Porta (Parma, 1995), 2 vols., II, Book Nine, chapter XXXVIII, pp. 338-40), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 95.
Cronica con la continuazione di Filippo Villani , (ed. Porta (Parma, 1995), 2 vols., II, Book Ten, chapter LXVI, pp. 536-7), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 96.
[...]
1 Vgl. North M., Geschichte der Niederlande, München 2013 (1997), S. 83.
2 Vgl. North, 2013, S. 33.
3 Vgl. North, 2013, S. 100ff; vgl. Wouters N., Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46, Zürich 2016, S. 3.
4 Vgl. North, 2013, S. 80ff; vgl. Rosen G., Europa zwischen Restauration und Liberalismus. In: Gérard du Ry van Beest Holle (Hrsg.), Holle Universal Geschichte, Erlangen 1988, S. 536.
5 Vgl. North, 2013, S. 42; vgl. Zolberg A.R., The Making of Flemings and Waloons: Belgium: 1830-1914. In: The Journal of Interdisciplinary History 5 (1974) 2, S. 183ff.
6 Vgl. North, 2013, S. 49; vgl. North, 2013, S. 94-101; vgl. Kershaw I., To Hell and Back. Europe 1914-1949, München 2016 (2015), S. 76.
7 Vgl. Clark C., Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600-1947, München 2007, S. 635: „Im Frühjahr 1848 [...] hatte König Friedrich Wilhelm IV. verkündet: ,Preußen geht fortan in Deutschland auf. “‘ - Großpreußen statt Deutschland war bis 1870 die nationale Vision preußischer Könige.
8 Vgl. Günther K.H., Sizilianer, Flamen, Eidgenossen. Regionale Kommunen und das soziale Wissen um kommunale Conjuratio im Spätmittelalter, Stuttgart 2013, S. 19.
9 Vgl. Ehlers J., Der Hundertjährige Krieg, München 2009, S. 7ff.
10 Vgl. Ehlers, 2009, S. 17-22.
11 Vgl. North, 2013, S. 9.
12 Vgl. Hastings A., The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge 1997, S.
13 Vgl. Hastings, 1997, S. 3.
14 Vgl. Hastings, 1997, S. 3f.
15 Vgl. Beumann H., Zur Nationenbildung im Mittelalter. In: Otto Dann (Hrsg.), Nationalismus in vorindustrieller Zeit, München 1986, S. 21.
16 Beumann, 1986, S. 22.
17 Vgl. Beumann, 1986, S. 22f.
18 Vgl. Beumann, 1986, S. 23.
19 Vgl. Graus F., Nationale Deutungsmuster der Vergangenheit in spätmittelalterlichen Chroniken. In: Otto Dann (Hrsg.), Nationalismus in vorindustrieller Zeit, München 1986, S. 35.
20 Graus, 1986, S. 36.
21 Vgl. Ehlers J., Was sind und wie bilden sich nationes im mittelalterlichen Europa. In: Almut Bues - Rex Rexheuser (Hrsg.), Mittelalterliche nationes - neuzeitliche Nationen. Probleme der Nationenbildung in Europa, Wiesbaden 1995, S. 8f.
22 Vgl. Ehlers, 1995, S. 10f.
23 Vgl. Ehlers, 1995, S. 12 bzw. S. 15.
24 Vgl. Ehlers, 1995, S. 15f.
25 Vgl. Günther, 2013, S. 50.
26 Vgl. Chronique des Pay-Bas, de France, etc., 1297, (in: Corpus Chronicorum Flandriae, ed. J.-J. de Smet, vol. III. (Brussels, 1856), pp. 121-2), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 25.
27 Vgl. Günther, 2013, S. 50f.
28 Annales Gandenses, 1302, übers. v. Frantz Funck-Brentano, hrsg. v. Alphonse Picard, Paris 1896, S. 22.
29 Vgl. Günther, 2013, S. 51.
30 Vgl. Günther, 2013, S. 52.
31 Vgl. Chronique des Pay-Bas, de France, etc., 1297, 2004, S. 25: Er sei laut Chronik schon 1297 zu ihrem stellvertretenden Herrscher gewählt worden, der, bis zur Rückkunft Graf Dampierres, Brügge leiten sollte: „They made a weaver named Peter their king. He was clever and skilled in the arts of war, because in his youth he had served in the military. Everyone promised to obey him as their lord until they could bring back Count Guy or one of his sons.”.
32 Vgl. Günther, 2013, S. 52.
33 Annales Gandenses, 1301, (ed. Hilda Johnstone (London, 1951), pp. 16-18), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 26.
34 Vgl. Annales Gandenses, 1301, 2004, S. 26.
35 Vgl. Annales Gandenses, 1302, 2004, S. 27.
36 Vgl. Günther, 2013, S. 52.
37 Vgl. Nicholas D., The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the Arteveldes, 1302-1390, Leiden 1987, S. 2.
38 Vgl. Nicholas, 1987, S. 2.
39 Vgl. Hastings, 1997, S. 3: „A long struggle against an external threat may also have a significant effect [auf Nationenbildung] [...]”.
40 Vgl. Stabel P. et al., Production, Markets and Socio-economic Structures I: c.1100-c.1320. In: Andrew Brown - Jan Dumolyn (Hrsg.), Medieval Bruges, c.850-1550, Cambridge 2018, S. 117f.
41 Vgl. Günther, 2013, S. 53f.
42 Vgl. Günther, 2013, S. 54f.
43 Vgl. Anciennes Chroniques de Flandre, 1324, (in: Recueil des historiens des Gaules et de la France, XXII (Paris, 1894), pp. 418-19), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 38.
44 Chronicon comitum Flandrensium, 1324, (in: Corpus Chronicorum Flandriae, ed. J.-J. De Smet, Vol. I (Brussels, 1837), pp. 34-261), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 36.
45 Anciennes Chroniques de Flandre, 1324, 2004, S. 38.
46 Vgl. Günther, 2013, S. 56f.
47 Vgl. Nicholas, 1987, S. 3f.
48 Vgl. Günther, 2013, S. 57.
49 Chronicon comitum Flandrensium, 1324, 2004, S. 36.
50 Vgl. Anciennes Chroniques de Flandre, 1325, 2004, S. 39: “Seeing many of their homes on fire and their town beginning to burn down, the residents of Courtrai rushed to arm themselves and launched a passionate attack against the count and his forces on all sides. [...]. [...] they captured Count Louis [...] and locked him up in the Belfry.”.
51 Vgl. Anciennes Chroniques de Flandre, 1324, 2004, S. 39.
52 Vgl. Günther, 2013, S. 57-59.
53 Chronicon comitum Flandrensium, 1325, 2004, S. 37.
54 Vgl. Dumolyn J. et al., Social Groups, Political Power and Institutions II, c.1300-c.1500. In: Andrew Brown - Jan Dumolyn (Hrsg.), Medieval Bruges, c.850-1550, Cambridge 2018, S. 268: “Their sign languages and practices — their banners, slogans, meetings, armed gatherings and strikes — came to dominate the processes and course of popular politics.”.
55 Vgl. Hastings, 1997, S. 3.
56 Vgl. Anciennes Chroniques de Flandre, 1324, 2004, S. 38 : “But it was said that he was rather pleased with the uprising and the troubles that ensued, whatever face he put on it, and so it seemed.” - Robert von Cassel hat unter Umständen nur seine Pflicht getan, war aber möglicherweise selbst nicht uninteressiert an einem Aufstand in Flandern.
57 Vgl. Günther, 2013, S. 59f.
58 Vgl. Günther, 2013, S. 61-65.
59 Vgl. Chronicon comitum Flandrensium, 1328, 2004, S. 37.
60 Chronicon comitum Flandrensium, 1328, 2004, S. 37f.
61 Vgl. Hastings, 1997, S. 3f: Für Hastings ist Religion immer Bestandteil der Nationenbildung und im Falle des Aufstands der Flamen scheint dies in ganz besonderer, nämlich umgekehrter, Weise der Fall zu sein.
62 Vgl. North, 2013, S. 11.
63 Vgl. Crombie L., Archery and crossbow guilds in medieval Flanders. 1300-1500, Woodbridge 2016, S. 22.
64 Vgl. Graus, 1986, S. 35.
65 Vgl. Ehlers, 2009, S. 23ff.
66 Vgl. Ehlers, 2009, S. 17f; vgl. Prestwich M., A Short History of the Hundred Years War, London - New York 2018, S. 10: Prestwich geht von deutlich weniger, 5000 Männern, aus, weil die Überfahrt von England eine immense logistische Herausforderung bei einem Einsatz von allein etwa 13000 Matrosen gewesen sei.
67 Vgl. Hastings, 1997, S. 3f; vgl. Ehlers, 1995, S. 15f: Sowohl Hastings als auch Ehlers spielen immer wieder auf die Bedeutung von Tradition und gemeinsamer Erfahrung als Kern der kulturellen Verknüpfung einer Gruppe an. Man kann sicherlich davon sprechen, dass die Flamen eine Kultur des Widerstands entwickelten, mindestens seit 1300, auf jeden Fall aber während und, bei entsprechendem Bedarf, nach der Flämischen Revolte 1323-1328.
68 Vgl. Neillands R., The Hundred Years War, London 2003 (1990), S. 6-16.
69 Vgl. Neillands, 2003, S. 20.
70 Vgl. Neillands, 2003, S. 21.
71 Vgl. Neillands, 2003, S. 23.
72 Vgl. Prestwich, 2018, S. 1.
73 Vgl. Prestwich, 2018, S. 3.
74 Vgl. Prestwich, 2018, S. 1.
75 Vgl. Nicholas, 1987, S. 5.
76 Vgl. Prestwich, 2018, S. 13.
77 Vgl. Cohn Jr. S.K., Lust for Liberty: The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425. Italy, France, and Flanders, Cambridge et al. 2008, S. 56.
78 Vgl. Prestwich, 2018, S. 9.
79 Vgl. Prestwich, 2018, S. 10.
80 Vgl. Prestwich, 2018, S. 13.
81 Vgl. Prestwich, 2018, S. 11.
82 Vgl. Prestwich, 2018, S. 4.
83 Vgl. Prestwich, 2018, S. 15.
84 Prestwich, 2018, S. 15.
85 Vgl. Prestwich, 2018, S. 16f.
86 Vgl. Prestwich, 2018, S. 28.
87 Vgl. Ehlers, 2009, S. 23ff.
88 Vgl. North, 2013, S. 9.
89 Vgl. Cohn Jr., 2008, S. 57.
90 Vgl. Cohn Jr. S.K., Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 94.
91 Vgl. Cronica con la continuazione di Filippo Villani, 1359, (ed. Porta (Parma, 1995), 2 vols., II, Book Nine, chapter XXXVIII, pp. 338-40), übers. v. Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 95.
92 Vgl. Cronica con la continuazione di Filippo Villani, 1360, (ed. Porta (Parma, 1995), 2 vols., II, Book Ten, chapter LXVI, pp. 536-7), übers. v . Samuel K. Cohn Jr. In: Samuel K. Cohn Jr. (Hrsg.), Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester 2004, S. 96.
93 Vgl. Cohn Jr., 2008, S. 78.
94 Vgl. Kittell E.E., Death and taxes: mortmain payments and the authority of the Count in fourteenth-century Flanders. In: Continuity and Change 28 (2013) 2, Cambridge 2013, S. 197.
95 Vgl. Kittell, 2013, S. 189.
96 Vgl. Cohn Jr., 2008, S. 36.
97 Vgl. North, 2013, S. 9.
- Quote paper
- Tom-Leonard Haselhorst (Author), 2023, Flanderns Städte proben den Aufstand (1297-1384), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1555816