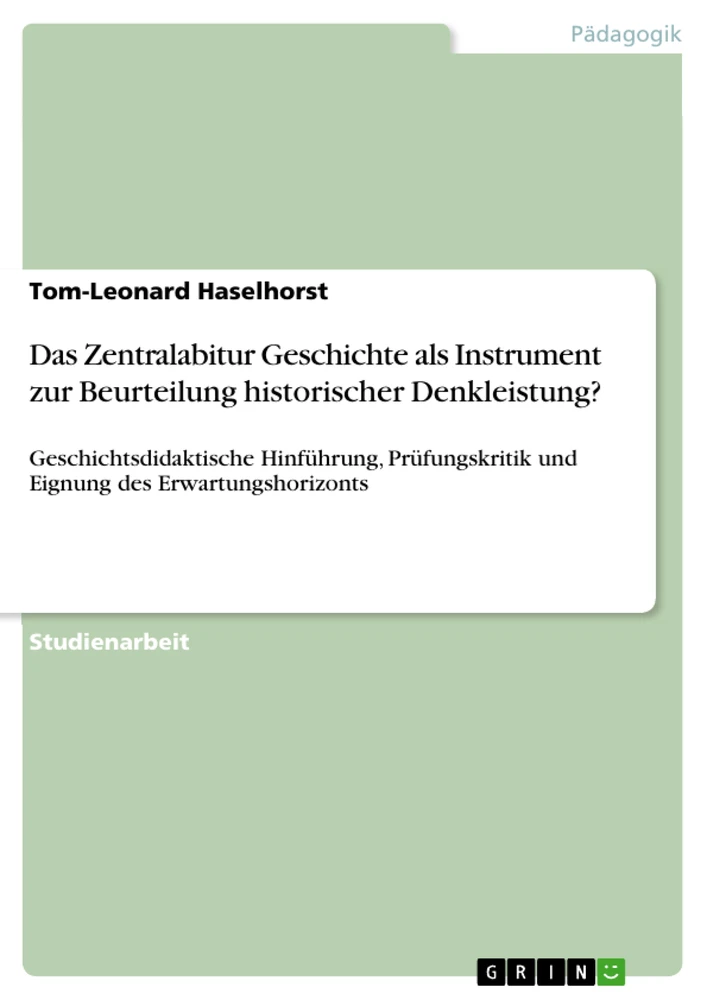Diese Arbeit befasst sich ausführlich mit der Eignung des in NRW praktizierten Zentralabiturs im Fach Geschichte zur Messung von historischer Lern- oder Denkleistung. Dabei führt sie zunächst theoretisch hin, behandelt dann die Gestalt einer Zentralabiturprüfung hinsichtlich der vorher aufgestellten, geschichtsdidaktischen Standards und fokussiert zuletzt auf die im Zentralabitur angewandten Erwartungshorizonte.
Die Frage nach der Leistungsbewertung im Schulfach Geschichte mag sich für all diejenigen möglicherweise nicht stellen, die dem für Laien naheliegenden Irrtum aufsitzen, im Umgang mit Vergangenheit gehe es schlichtweg um den Erwerb allgemeingültigen, gesicherten geschichtlichen Wissens. In diesem Zusammenhang scheint die dann angeführte Trias aus Zahlen – Daten – Fakten allgegenwärtig und hinsichtlich der Messung von Schüler- bzw. Schülerinnenleistung im Geschichtsunterricht oberster Orientierungspunkt zu sein; etwa, wenn als Lernziel des Faches Geschichte in erster Linie die korrekte Beantwortung einer exemplarischen Frage wie Wann begann die Französische Revolution? angenommen oder sogar erwartet wird. Nun soll sich diese Arbeit nicht in Mutmaßungen darüber verlieren, welche Erwartung von einer breiten Öffentlichkeit möglicherweise an den Geschichtsunterricht und seinen Zweck gestellt wird – dies ist indes Bestandteil anderer anregender Beiträge.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung – Was bleibt von der Didaktik in der Leistungsbeurteilung?
- II. Historisches Denken als theoretische Grundlage aktueller Lehrpläne des Faches Geschichte
- II.I. Lernziel: Historische Orientierung/Historische (Wert-)Urteilskraft
- II.II. Lernbausteine: Die Kompetenzbereiche der FUER-Gruppe
- III. Das FUER-Modell im KLP und sein Niederschlag im Zentralabitur
- IV. Die Zentralabiturprüfung GE GK HT 3 (NRW, 2020): Gestalt, Aufgabenkultur und Erwartungshorizont
- IV.I. Gestalt des Materials und Aufgabenkultur
- IV.II. Aufgabenqualität
- IV.III. Erwartungshorizont: Konzept und Kritik
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Zentralabiturs Geschichte in Nordrhein-Westfalen zur Beurteilung historischer Denkleistung. Sie analysiert den Widerspruch zwischen den in der Geschichtsdidaktik formulierten Zielen und dem praktischen Ablauf der Abiturprüfung. Die Arbeit beleuchtet, inwiefern das Abitur die im Unterricht angestrebten Kompetenzen tatsächlich erfasst.
- Historische Denkleistung und Kompetenzbegriff
- Analyse des FUER-Modells und seiner Umsetzung im Lehrplan
- Kritik des Erwartungshorizonts der Zentralabiturprüfung
- Vergleich zwischen didaktischen Idealen und prüfungspraktischer Realität
- Diskussion möglicher Alternativen der Leistungsbeurteilung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung – Was bleibt von der Didaktik in der Leistungsbeurteilung?: Die Einleitung problematisiert die gängige Auffassung, Geschichtsunterricht ziele primär auf den Erwerb von Faktenwissen ab. Sie stellt die Frage, wie historische Denkleistung, die über das reine Faktenwissen hinausgeht, adäquat geprüft werden kann. Der Autor verweist auf die Arbeiten von Thünemann, der die Fähigkeit zur Bildung eines historischen Werturteils als zentrales Lernziel hervorhebt, welches auf fundiertem Faktenwissen basiert, aber durch Kontextualisierung und Reflexion erweitert wird. Die Einleitung zeigt den Widerspruch zwischen dem Ideal eines kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts und der oft faktenorientierten Leistungsbeurteilung auf und kündigt die zentrale Fragestellung der Arbeit an: die kritische Auseinandersetzung mit dem Zentralabitur als Instrument zur Messung historischer Denkleistung.
II. Historisches Denken als theoretische Grundlage aktueller Lehrpläne des Faches Geschichte: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt die Konzepte des historischen Denkens und Geschichtsbewusstseins, die in aktuellen Lehrplänen verankert sind. Der Fokus liegt auf dem Kompetenzbegriff und dem FUER-Modell, welches die Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zum Ziel hat. Die Kapitelteile II.I und II.II untersuchen das Lernziel der historischen Orientierung/Urteilskraft sowie die Kompetenzbereiche des FUER-Modells im Detail, wobei der Bezug zu aktuellen Lehrplänen hergestellt wird. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung von Kontextualisierung, Reflexion und der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Geschichtsdeutungen.
Schlüsselwörter
Zentralabitur, Geschichtsdidaktik, Historisches Denken, Kompetenzorientierung, FUER-Modell, Werturteilsfähigkeit, Leistungsbeurteilung, Erwartungshorizont, Prüfungsaufgaben, Kompetenzmessung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text untersucht die Eignung des Zentralabiturs Geschichte in Nordrhein-Westfalen zur Beurteilung historischer Denkleistung und analysiert den Widerspruch zwischen den Zielen der Geschichtsdidaktik und dem Ablauf der Abiturprüfung.
Welche Lernziele werden im Zusammenhang mit historischem Denken genannt?
Das Lernziel der historischen Orientierung/Historischen (Wert-)Urteilskraft wird besonders hervorgehoben.
Was ist das FUER-Modell und welche Rolle spielt es in diesem Kontext?
Das FUER-Modell ist ein zentrales Element aktueller Lehrpläne und wird als Lernbaustein zur Entwicklung von Kompetenzen im Bereich des historischen Denkens betrachtet. Es ist ein Modell, das die Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zum Ziel hat.
Wie wird das Zentralabitur GE GK HT 3 (NRW, 2020) im Text behandelt?
Der Text analysiert die Gestalt, Aufgabenkultur und den Erwartungshorizont der Zentralabiturprüfung und unterzieht diese einer kritischen Bewertung.
Welche Kritikpunkte werden am Erwartungshorizont der Zentralabiturprüfung geäußert?
Der Text kritisiert das Konzept des Erwartungshorizonts, ohne jedoch konkrete Kritikpunkte im Auszug zu nennen. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass eine Kritik erfolgt.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Textes relevant?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Zentralabitur, Geschichtsdidaktik, Historisches Denken, Kompetenzorientierung, FUER-Modell, Werturteilsfähigkeit, Leistungsbeurteilung, Erwartungshorizont, Prüfungsaufgaben und Kompetenzmessung.
Was wird in der Einleitung des Textes problematisiert?
Die Einleitung problematisiert die gängige Auffassung, dass Geschichtsunterricht primär auf den Erwerb von Faktenwissen abzielt, und stellt die Frage nach einer adäquaten Prüfung historischer Denkleistung.
Welche Aspekte des kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts werden betont?
Der Text unterstreicht die Bedeutung von Kontextualisierung, Reflexion und der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Geschichtsdeutungen.
Was wird im zweiten Kapitel als theoretische Grundlage dargestellt?
Im zweiten Kapitel werden die Konzepte des historischen Denkens und Geschichtsbewusstseins, die in aktuellen Lehrplänen verankert sind, sowie der Kompetenzbegriff und das FUER-Modell als theoretische Grundlagen dargelegt.
Welche zentrale Fragestellung wird im Text behandelt?
Die zentrale Fragestellung ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Zentralabitur als Instrument zur Messung historischer Denkleistung.
- Arbeit zitieren
- Tom-Leonard Haselhorst (Autor:in), 2024, Das Zentralabitur Geschichte als Instrument zur Beurteilung historischer Denkleistung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1556293