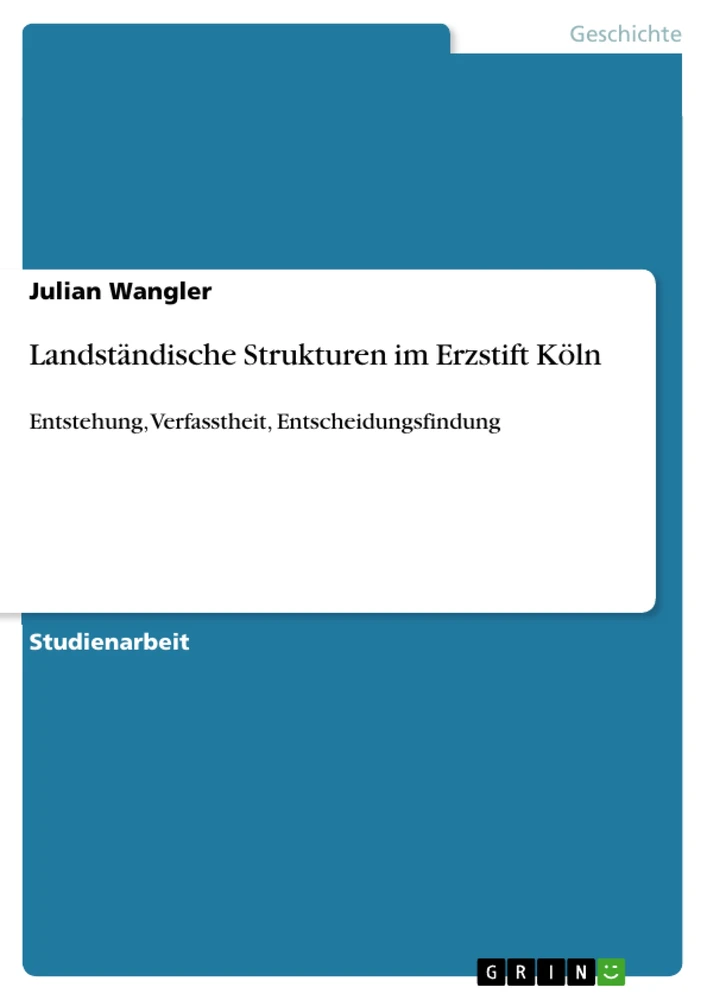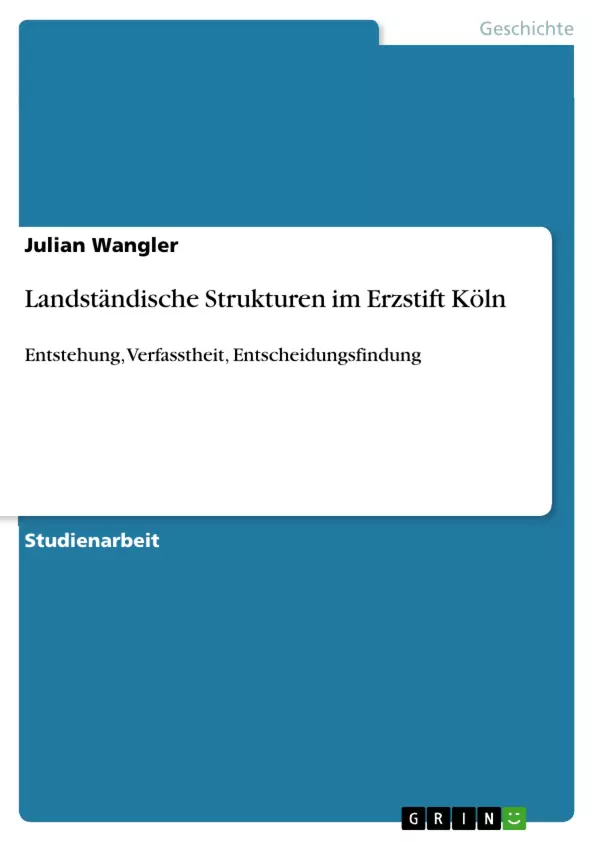Die vorliegende Hausarbeit möchte das Prinzip der Entstehung und Verfassung von Landständen in geistlichen Staaten exemplarisch am Beispiel des Erzstifts Köln illustrieren sowie deren Mitwirkung im politischen Prozess des Territoriums, vornehmlich auf den Landtagen. Dabei wird der bisherige Forschungsstand zu diesem Thema zusammengefasst. In einem zweiten Schritt sollen, ergänzend zu diesen allgemeinen Erkenntnissen zwei konkrete historische Ereignisse dargestellt werden, die sich mit der Auseinandersetzung von Landständen und Landesherrn befassen. Im Zentrum stehen dabei folgende Forschungsfragen: Wie nahmen sich Stellung und Einfluss der Landstände aus? Wie war ihr Verhältnis zum Kurfürsten und inwiefern haben sie ihn in seiner Verfügungsgewalt gebunden? Zu welchen Gelegenheiten war ihre Macht womöglich besonders stark? Wie könnte die historische Leistung der Landstände aussehen? Diesen Fragen soll nicht zuletzt in der Schlussbetrachtung Rechnung getragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Erzstift Köln
- Landstände
- Entstehung
- Verfassung
- Domkapitel
- Grafenkurie
- Ritterschaft
- Städte
- Politische Mitwirkung
- Landtagseinberufung
- Landtagseröffnung
- Geschäftsgang
- Entscheidungsfindung
- Konflikte zwischen Landesherr und Landständen
- Der Sturz Erzbischof Ruprechts
- Der Steuerstreit unter Erzbischof Josef Clemens
- Schlussbetrachtung: Bedeutung der Landstände?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Entstehung, Verfassung und politische Mitwirkung der Landstände im Erzstift Köln. Dabei wird der bisherige Forschungsstand zum Thema zusammengefasst und durch die Darstellung von zwei konkreten historischen Ereignissen - dem Sturz Erzbischof Ruprechts und dem Steuerstreit unter Erzbischof Josef Clemens - illustriert.
- Die Entstehung und Entwicklung der Landstände im Erzstift Köln.
- Die Verfassung der Landstände und ihre interne Struktur.
- Die Mitwirkung der Landstände im politischen Prozess des Erzstifts, insbesondere auf den Landtagen.
- Die Konflikte zwischen dem Kurfürsten und den Landständen.
- Die historische Bedeutung der Landstände für das Erzstift Köln.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas und die Forschungslücke, die diese Arbeit schließen möchte. Sie führt die Forschungsfragen ein, denen die Arbeit nachgeht.
- Das Kapitel „Das Erzstift Köln“ bietet eine kurze Vorstellung des Territoriums, seiner Struktur und seiner Bedeutung im Heiligen Römischen Reich.
- Das Kapitel „Landstände“ befasst sich mit der Entstehung, Verfassung und den Strukturen der Landstände im Erzstift Köln. Es beleuchtet die Rolle des Domkapitels, der Grafenkurie, der Ritterschaft und der Städte.
- Im Kapitel „Politische Mitwirkung“ wird der Einfluss der Landstände auf den politischen Prozess im Erzstift analysiert. Dabei werden die Einberufung, Eröffnung und der Geschäftsgang der Landtage sowie die Entscheidungsfindungsprozesse beleuchtet.
- Das Kapitel „Konflikte zwischen Landesherr und Landständen“ schildert zwei konkrete historische Ereignisse, die die Auseinandersetzung zwischen dem Kurfürsten und den Landständen im Erzstift Köln veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Landstände, Erzstift Köln, Kurfürst, Politische Mitwirkung, Landtage, Konflikte, Verfassung, Entstehung, Finanzpolitik, Steuerstreit, Reichsdeputationshauptschluss, Erblandesvereinigung.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Landstände im Erzstift Köln?
Die Landstände waren eine politische Körperschaft, die den Kurfürsten bei wichtigen Entscheidungen, insbesondere in Finanz- und Steuerfragen, mitbestimmte.
Aus welchen Gruppen setzten sich die Landstände zusammen?
Sie bestanden aus dem Domkapitel, der Grafenkurie, der Ritterschaft und den Vertretern der Städte.
Welche Macht hatten die Landstände gegenüber dem Kurfürsten?
Durch ihr Bewilligungsrecht für Steuern konnten sie die Verfügungsgewalt des Landesherrn erheblich binden, was oft zu politischen Konflikten führte.
Was war der Anlass für den Sturz Erzbischof Ruprechts?
Der Sturz ist ein historisches Beispiel für die Machtprobe zwischen den Landständen und einem Landesherrn, der deren Rechte missachtete.
Wie lief ein Landtag im Erzstift Köln ab?
Die Arbeit beschreibt den formalen Prozess von der Einberufung über die Eröffnung bis hin zum Geschäftsgang und der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung.
- Citation du texte
- Julian Wangler (Auteur), 2007, Landständische Strukturen im Erzstift Köln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155631