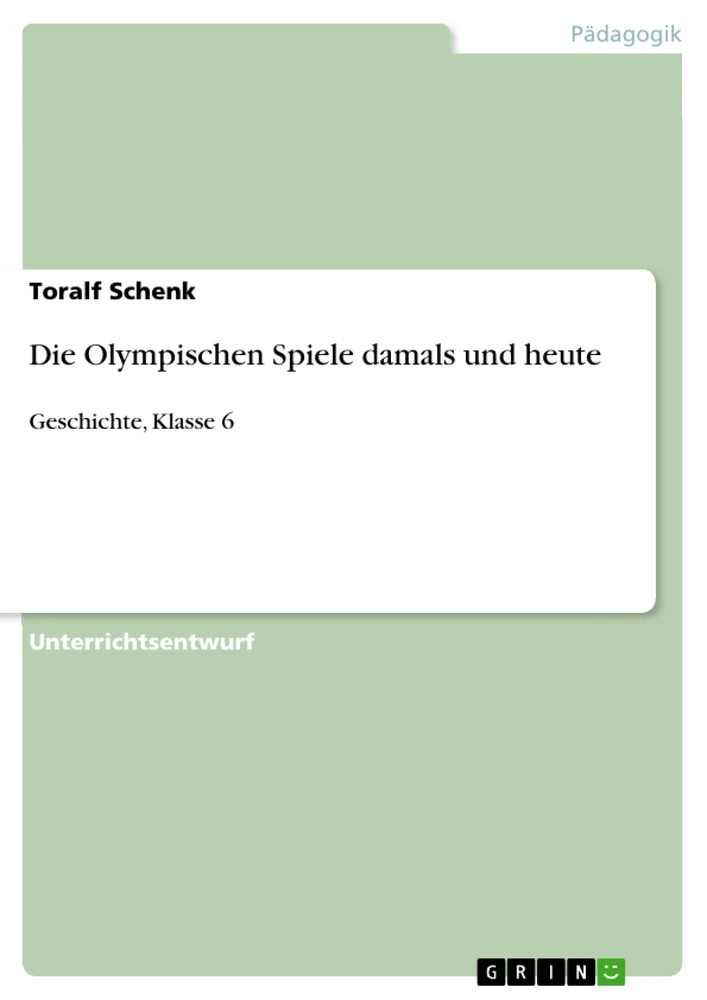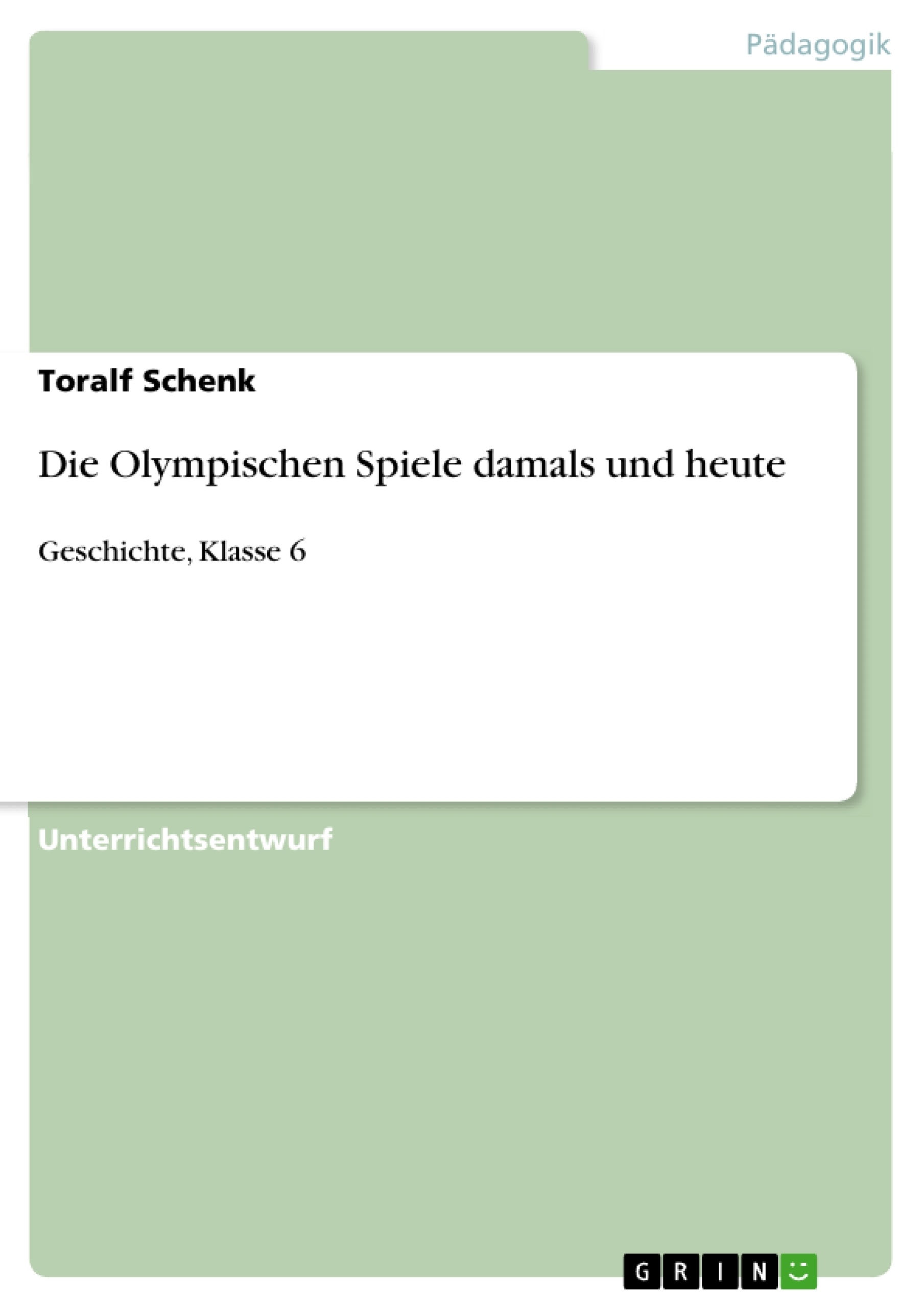„Welcome back“ konnte man 2004 überall in Athen lesen. Die Spiele kehrten nach fast 3000 Jahren wieder an ihren Ursprung zurück, wo sie 1896 durch Pierre de Coubertin neu begründet wurden. Über zwei Wochen kämpften Athleten aus 202 Nationen und in 303 verschiedenen Wettkäpfen um das begehrte Edelmetall und diesmal auch um den Olivenkranz, den jeder der drei Erstplazierten als Anerkennung für seine Leistung bekam – wie damals im alten Olympia. Doch ist das alles, was von den Spielen der Antike übrig geblieben ist? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es eines Rückblickes in die Olympischen Spiele der Antike. Dieser Rückgriff erweist sich für den Unterricht als lukrativ, da die Schüler noch unter den Eindrücken der wenige Tage zuvor beendeten Olympischen Spiele der Neuzeit stehen, über die sie durch die Informationsflut aller Medien Informationen beziehen konnten und dazu auch durch den Geschichtsunterricht angehalten wurden. Damit kann der Forderung des Lehrplans nach einer „lebensverbundenen Gestaltung des Unterrichts“ Rechung getragen werden, indem sowohl an die „Erfahrungswelt der Schüler“ angeknüpft, als auch auf „aktuelle Gegebenheiten und Ereignisse Bezug genommen wird“. Ausgehend von diesem aktuellen und präsenten Eindrücken bietet es sich an, auf die Ursprünge der Olympischen Spiele zurückzublicken und Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Nachfolgende fachwissenschaftliche Überlegungen zum Unterrichtsgegenstand der „Olympischen Spiele“ finden im Unterricht unter Berücksichtigung des Leistungsvermögens der Klassenstufe 6 Anwendung.
Wenn ein Schüler auch rein gar nichts über die Antike wüsste, so wüsste er gleichwohl, was die Olympischen Spiele sind und dass sie ein Erbe der Alten Griechen darstellen. Doch sowenig sich unsere kulturellen Verbindungen zu Griechenland auf dieses sportliche Großereignis reduzieren lassen, sowenig war Olympia in der Antike nur ein Austragungsort sportlicher Wettkämpfe. Doch woher beziehen wir unsere Kenntnisse? Vor allem durch haptische Quellen, wie Vasen, Plastiken oder Skulpturen, werden wir auf das sportliche Großereignis im antiken Griechenland neugierig gemacht. Schriftliche Quelle stehen uns nur im begrenzten Rahmen zur Verfügung und sind erst ab der Zeit der Klassik (5.Jh.v.Chr.) uns zugänglich bzw. überliefert. Ausgehend von dieser Tatsache sollte es den Schülern bewusst gemacht werden, dass wir nur wenig fundierte und nachgewiesene Kenntnisse über den Ursprung der Olympischen Spiele der Antike besitzen.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Innere Situation
- Äußere Situation
- Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen
- Stellung der Stunde in der Stoffeinheit
- Auswahl und Begründung der Inhalte
- Auswahl und Begründung der Lernziele
- Begründung der didaktischen Stufung des Unterrichts und des gewählten Methodenkonzeptes
- Geplanter Unterrichtsverlauf
- Literaturverzeichnis
- Eigenständigkeitserklärung
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Stundenentwurf zur Lehrprobe im Fach Geschichte behandelt die Olympischen Spiele in ihrer historischen Entwicklung und zeitgenössischen Bedeutung. Er setzt sich zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit den wichtigsten Aspekten der antiken Spiele und ihren modernen Weiterentwicklungen vertraut zu machen.
- Die Entstehung und Bedeutung der Olympischen Spiele im antiken Griechenland
- Die Wiederbelebung der Olympischen Spiele im 19. Jahrhundert
- Die Olympischen Spiele im 20. und 21. Jahrhundert und ihre Bedeutung für die internationale Gemeinschaft
- Die Rolle von Sport und Politik bei den Olympischen Spielen
- Die Entwicklung und Bedeutung der Olympischen Spiele für Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Bedingungsanalyse
Die Bedingungsanalyse beschreibt die innere Situation der Klasse 6b, welche sich durch ein hohes Lernniveau und aktives Interesse am Fach Geschichte auszeichnet. Es wird festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht engagiert mitarbeiten und kritisch am Unterrichtsstoff teilnehmen. Der Entwurf berücksichtigt auch die äußere Situation und die räumlichen Gegebenheiten des Klassenraums.
Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen
Dieser Abschnitt erläutert die Stellung der Stunde im Stoffkontext, begründet die Auswahl der Inhalte und Lernziele sowie die didaktische Stufung des Unterrichts. Die Auswahl der Unterrichtsmethoden wie Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Diskussionen wird im Hinblick auf die Bedürfnisse der Lerngruppe und die Inhalte des Themas gerechtfertigt.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ursprünge der Olympischen Spiele in der Antike?
Die Spiele entstanden vor fast 3000 Jahren in Olympia, Griechenland. Sie waren nicht nur sportliche Wettkämpfe, sondern auch religiöse Ereignisse zu Ehren von Zeus.
Wer begründete die Olympischen Spiele der Neuzeit?
Pierre de Coubertin begründete die modernen Spiele im Jahr 1896, woraufhin sie erstmals wieder in Athen stattfanden.
Welche Quellen geben uns Auskunft über die antiken Spiele?
Kenntnisse stammen vor allem aus haptischen Quellen wie Vasen, Plastiken und Skulpturen. Schriftliche Quellen sind erst ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. in begrenztem Umfang verfügbar.
Welche Rolle spielt die Politik bei den Olympischen Spielen?
Der Unterrichtsentwurf thematisiert die Verbindung von Sport und Politik sowohl in der Antike (z.B. der heilige Waffenstillstand) als auch in der Moderne (internationale Gemeinschaft).
Warum ist das Thema für den Geschichtsunterricht in Klasse 6 relevant?
Es ermöglicht eine lebensverbundene Gestaltung des Unterrichts, da Schüler durch aktuelle Medienberichte über moderne Spiele Vorwissen mitbringen, an das historisch angeknüpft werden kann.
- Quote paper
- Toralf Schenk (Author), 2004, Die Olympischen Spiele damals und heute , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155655