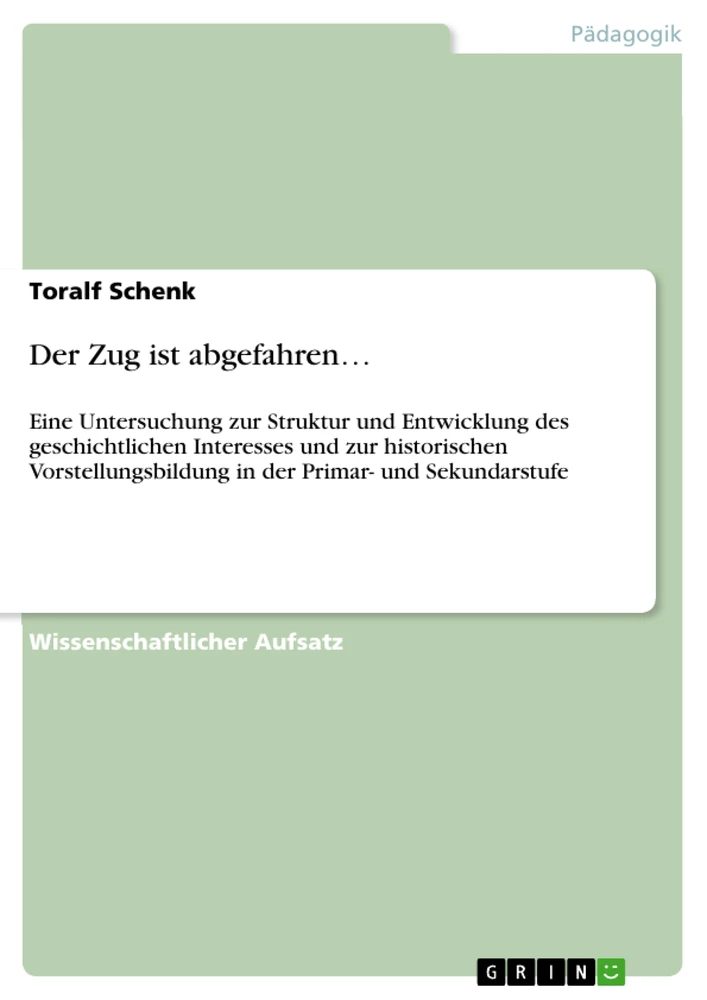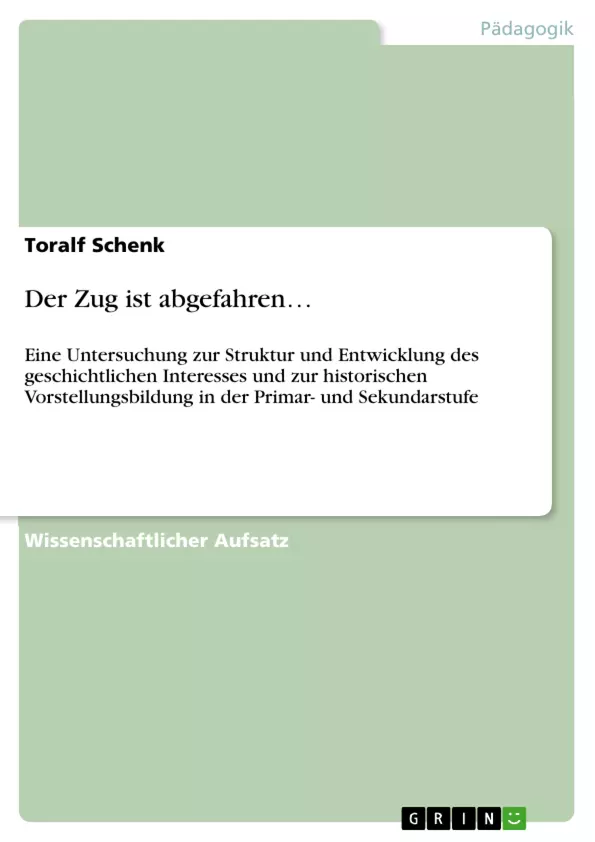Dass man im Unterricht schon immer mit Langeweile zu kämpfen hatte, beschrieb bereits August Herrmann Niemeyer in seinen „Grundsätzen der Erziehung und des Unterrichts.“ Darin heißt es: „Langweilig zu sein – hat man sehr wahr gesagt – ist die ärgste Sünde des Unterrichts.“ Jeder, der schon selbst unterrichtet hat, weiß, dass die Freude am Lernen von vielen Faktoren abhängt u.a. von der Person des Lehrers, dem Stundenthema, der Konzeption des Unterrichts.
Die Vorstellung eines Grundschülers von Geschichte ist fantasiegeladen und emotional. Genau diese soll nach Vorgaben des Thüringer Lehrplanes ab Klasse 5 aufgegriffen werden. Doch warum kann es trotz dieser Forderung dazu kommen, dass bereits nach zwei Jahren Unterrichtserfahrung Schüler Langeweile im Fach Geschichte verspüren? Genügt der Geschichtsunterricht, den die Schüler in ihren Anfangsjahren erleben, der Forderung „interessant“ zu sein nicht? Natürlich gibt es auch Schüler, die Geschichte in der 6. Klasse wie folgt bewerten: „Geschichte ist sehr interessant und macht Spaß.“
In einer Interviewstudie befragte ich die Schüler nach einem konkreten Ereignis, das sie als initialzündend für ihr Interesse an der Geschichte benennen würden. Als konkrete Schlüsselerlebnisse benannten sie u.a. eine Urlaubsreise nach Ägypten, den Besuch von Ritterfestspielen auf der Leuchtenburg, Gespräche mit dem Opa über seine Kindheit, den Kinobesuch oder die Lektüre zu einem Historiendrama, Situationen die sie außerhalb der Schule erlebten.
Aus diesem Problemsaufriss stellen sich Fragen an die Unterrichtspraxis. Bietet der Geschichtsunterricht nicht genügend Raum zur Interessenentwicklung? Welche schulischen Einflussfaktoren fördern oder hemmen die Interessenentwicklung? Welche Vorstellung haben Schüler von der Vergangenheit und welche Möglichkeit bietet ihnen der Unterricht, diese mit einzubringen? Gibt es typische Schlüsselsituationen bei Kindern, die Auslöser waren, Interesse für Geschichte zu empfinden? Werden vorhandene Interessen der Schüler im Geschichtsunterricht berücksichtigt und gefördert? Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt meiner Dissertation, deren erste Zwischenergebnisse im Folgenden vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen und Fragestellung
- Begriffsklärung und Forschungstraditionen
- Der Interessenbegriff
- Grundannahmen und Ergebnisse der pädagogisch-psychologischen Interessenforschung
- Traditionen der historischen Interessenforschung im Rahmen aktueller Fragen der Geschichtsdidaktik
- Voruntersuchungen und Hypothesenbildung
- Die Voruntersuchung
- Die Interviewstudie
- Erhebungsinstrument und Erkenntnisinteresse
- Das Autonomie- Erleben
- Soziale Eingebundenheit
- Förderung des Kompetenzerlebens
- Instruktionsqualität
- Interesse der Lehrenden
- Inhaltliche Relevanz
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation untersucht die Struktur und Entwicklung des geschichtlichen Interesses sowie die historische Vorstellungsbildung von Schülern im Primar- und Sekundarstufenbereich. Sie befasst sich mit der Frage, wie Schülergeschichte erleben und welche Faktoren die Entwicklung von historischem Interesse fördern oder hemmen.
- Die Bedeutung des Interesses für den Lernprozess und die Unterrichtsqualität.
- Die Entwicklung und Bedeutung des geschichtlichen Interesses bei Schülern.
- Die Rolle des Unterrichts in der Förderung von historischem Interesse.
- Die Relevanz des "Autonomie-Erlebens", "Sozialen Eingebundenheit", "Förderung des Kompetenzerlebens", "Instruktionsqualität" und des Interesses der Lehrenden für die Entwicklung von historischem Interesse.
- Die Vorstellung von Vergangenheit bei Schülern und die Möglichkeit, diese im Unterricht einzubringen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Dissertation stellt die Ausgangssituation und die Fragestellung der Arbeit dar. Es zeigt auf, dass Schüler häufig negative Erfahrungen mit Geschichtsunterricht machen und sich nicht für Geschichte interessieren. Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff "Interesse" und die verschiedenen Forschungstraditionen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier werden wichtige theoretische Ansätze und Definitionen vorgestellt, die für die weitere Untersuchung relevant sind. Das dritte Kapitel geht auf die Forschungstraditionen der historischen Interessenforschung im Rahmen aktueller Fragen der Geschichtsdidaktik ein. Das vierte Kapitel beschreibt die ersten Ergebnisse der Voruntersuchungen zu Interessenbereichen der Schüler im Fach Geschichte und bietet Einblicke in ihre Vorstellung von Vergangenheit. Das fünfte Kapitel stellt das Messinstrument der Studie vor, das verschiedene Aspekte wie das Autonomie-Erleben, soziale Eingebundenheit, Förderung des Kompetenzerlebens, Instruktionsqualität, das Interesse der Lehrenden und die inhaltliche Relevanz berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Geschichtliches Interesse, historische Vorstellungsbildung, Interessenentwicklung, Unterrichtsqualität, Schülermotivation, Geschichtsdidaktik, empirische Unterrichtsforschung, Autonomie-Erleben, soziale Eingebundenheit, Kompetenzerleben, Instruktionsqualität, Interesse der Lehrenden, inhaltliche Relevanz, Voruntersuchung, Interviewstudie, Messinstrument.
Häufig gestellte Fragen
Warum empfinden viele Schüler Langeweile im Geschichtsunterricht?
Langeweile entsteht oft, wenn der Unterricht keinen Raum für die fantasiegeladenen Vorstellungen der Schüler bietet oder wenn die inhaltliche Relevanz und das Autonomie-Erleben der Lernenden zu kurz kommen.
Was sind typische Schlüsselerlebnisse für historisches Interesse?
Schüler benennen oft Erlebnisse außerhalb der Schule als Initialzündung, wie Urlaubsreisen (z.B. nach Ägypten), Besuche von Ritterfestspielen, Gespräche mit Großeltern über die Vergangenheit oder historische Filme und Romane.
Welche schulischen Faktoren fördern das Interesse an Geschichte?
Wichtige Faktoren sind das Erleben von Autonomie, die soziale Eingebundenheit in der Klasse, die Förderung des Kompetenzerlebens sowie eine hohe Instruktionsqualität und das sichtbare Interesse der Lehrkraft am Fach.
Wie unterscheiden sich die Geschichtsvorstellungen von Grundschülern?
Die Vorstellungen von Grundschülern sind oft stark emotional und fantasiegeprägt. Ein guter Geschichtsunterricht sollte diese emotionalen Zugänge ab der 5. Klasse aufgreifen und weiterentwickeln.
Was ist das Ziel der historischen Interessenforschung?
Sie untersucht, wie historisches Interesse entsteht, welche Faktoren es hemmen oder fördern und wie der Geschichtsunterricht gestaltet sein muss, um Schüler nachhaltig für die Vergangenheit zu motivieren.
- Citar trabajo
- Toralf Schenk (Autor), 2007, Der Zug ist abgefahren…, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155669