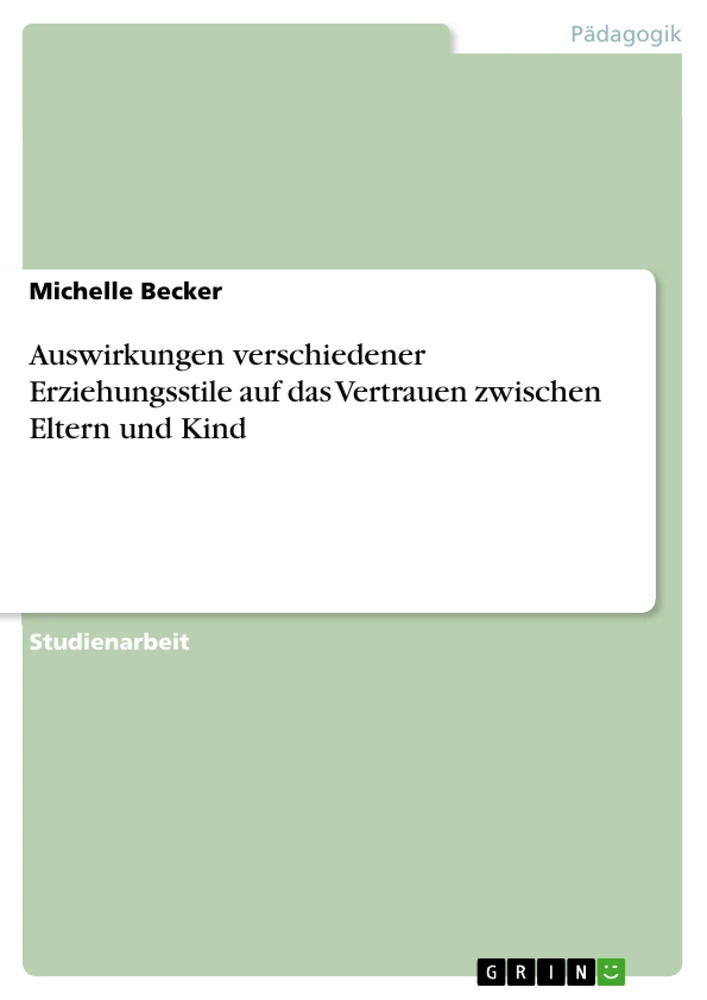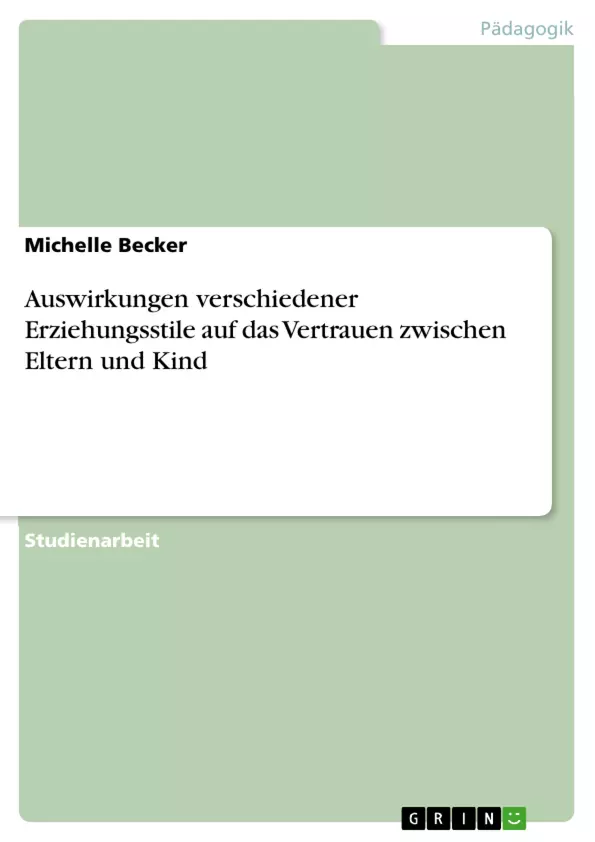Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie unterschiedliche Erziehungsstile das Vertrauen zwischen Eltern und ihren Kindern beeinflussen. Dabei wird untersucht, welche Ansätze besonders förderlich für die Entwicklung eines stabilen Vertrauensverhältnisses zwischen Vormund und Nachwuchs sein können.
Um Verständnis zu schaffen, erfolgen zunächst einige Begriffsannäherungen, um für die Arbeit relevante Begriffe und ihre Definitionen verständlich zu machen.
Anschließend folgt der Hauptteil, in dem es zunächst allgemein um das Vertrauen geht, wie und wann dieses hergestellt wird, wie es gewahrt wird, welche Vorteile und Risiken es mit sich bringt, in welchen Aspekten Vertrauen eine Rolle spielt und welche Vertrauensformen es gibt. Hier wird vor allem auf den Text „Vertrauen“, geschrieben von Sabine Wagenblass im Jahr 2018, Bezug genommen.
Anknüpfend daran wird im Anschluss das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern thematisiert und inhaltlich auf die erste Stufe des psychosozialen Modells von Erikson Bezug genommen. Des Weiteren wird darauf eingegangen, welche Rolle das Vertrauen spielt, wie Eltern das Vertrauen ihres Kindes gewinnen können und weshalb dies für die Beziehung und die Entwicklung relevant ist. Gestützt wird sich hier auf verschiedene Quellen, vor allem aber auf die Inhalte des Buches „Vertrauen in der pädagogischen Beziehung“, geschrieben von Martin Schweer und herausgegeben im Jahr 1996.
Im Anschluss wird das Kernthema dieser Arbeit behandelt und auf die drei Erziehungsstile (demokratisch, laissez-faire und autoritär) nach Kurt Lewin eingegangen und deren Zusammenhänge zur Thematik untersucht.
Zunächst wird eine kurze allgemeine Auskunft über Kurt Lewin und seine Theorie gegeben und anschließend auf jeden einzelnen der drei Erziehungsstile eingegangen. Dabei erfolgt zuerst eine Beschreibung der Merkmale des jeweiligen Erziehungsstils. Daraufhin werden die allgemeinen Auswirkungen des jeweiligen Erziehungsstils und dessen Auswirkungen auf das Vertrauen zwischen Eltern und ihren Kindern untersucht und auf mögliche Folgen hingewiesen. Nach Untersuchung eines Stils folgen eine kurze Zusammenfassung und Wertung dessen. Bezogen wird sich großteils auf verschiedene Artikel des Soziologen Jens Bohlken, aber auch auf andere wissenschaftliche Quellen.
Abschließend folgen eine Zusammenfassung und Auswertung der herausgearbeiteten Erkenntnisse, sowie schlussendlich ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 2.1. Kind
- 2.2. Eltern
- 2.3. Erziehungsstile
- 3. Vertrauen
- 4. Vertrauen zwischen Eltern und Kind unter Anwendung der Erziehungsstile nach Kurt Lewin
- 4.1. Autoritärer Erziehungsstil
- 4.2. Laissez-faire Erziehungsstil
- 4.3. Demokratischer Erziehungsstil
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Erziehungsstile auf das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind. Ziel ist es, die Auswirkungen autoritärer, laissez-faire und demokratischer Erziehungsstile auf die Entwicklung von Vertrauen zu analysieren und den am besten geeigneten Stil zur Förderung eines positiven Eltern-Kind-Verhältnisses zu identifizieren.
- Definition und Abgrenzung relevanter Begriffe (Kind, Eltern, Erziehungsstil)
- Theorie des Vertrauens und dessen Bedeutung in der Eltern-Kind-Beziehung
- Analyse der drei Erziehungsstile nach Kurt Lewin
- Auswirkungen der Erziehungsstile auf das Vertrauen zwischen Eltern und Kind
- Bewertung der verschiedenen Erziehungsstile im Hinblick auf Vertrauensbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Familie für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und die Rolle des Vertrauens in der Eltern-Kind-Beziehung. Sie begründet die Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit, der mit Begriffsdefinitionen beginnt, um anschließend das Vertrauen im Allgemeinen und in der Eltern-Kind-Dynamik zu erörtern, bevor die Kernfrage nach dem Einfluss verschiedener Erziehungsstile auf das Vertrauen behandelt wird.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel dient der Klärung zentraler Begriffe. „Kind“ wird auf den Zeitraum von der Geburt bis zur Volljährigkeit eingegrenzt. „Eltern“ werden als die rechtlichen Erziehungsberechtigten definiert, unabhängig von Geschlecht und biologischer Verwandtschaft. „Erziehungsstil“ wird als ein wiederkehrendes Verhaltensmuster der Erziehenden beschrieben, das auf deren Einstellungen und Haltungen zum Kind basiert und dessen Entwicklung maßgeblich beeinflusst.
3. Vertrauen: Aufbauend auf Wagenblass (2018), wird Vertrauen als essentielles Element sozialer Beziehungen definiert, das Komplexität reduziert und Erwartungen stabilisiert. Verschiedene Vertrauensformen werden vorgestellt, wobei das persönliche Vertrauen, basierend auf Intimität und Gegenseitigkeit, für die Eltern-Kind-Beziehung zentral ist. Der Aufbau und die Pflege von Vertrauen werden angesprochen, mit Reziprozität als wichtigem Faktor.
4. Vertrauen zwischen Eltern und Kind unter Anwendung der Erziehungsstile nach Kurt Lewin: Dieses Kapitel analysiert die drei Erziehungsstile Lewins (autoritär, laissez-faire, demokratisch) und deren Auswirkungen auf das Eltern-Kind-Vertrauen. Es beinhaltet die Beschreibung der jeweiligen Stile, deren allgemeine Auswirkungen und spezifische Einflüsse auf das Vertrauensverhältnis, inklusive möglicher Folgen. Jeder Stil wird einzeln untersucht, zusammengefasst und bewertet, unter Bezugnahme auf verschiedene wissenschaftliche Quellen.
Schlüsselwörter
Vertrauen, Erziehungsstile, Eltern-Kind-Beziehung, Kurt Lewin, autoritär, laissez-faire, demokratisch, Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisation.
Häufig gestellte Fragen zu: Language Preview (Erziehungsstile und Vertrauen)
Was ist der Fokus dieser Language Preview?
Diese Language Preview gibt einen Überblick über eine Arbeit, die den Einfluss verschiedener Erziehungsstile auf das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind untersucht. Sie umfasst Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition relevanter Begriffe (Kind, Eltern, Erziehungsstil), die Theorie des Vertrauens in der Eltern-Kind-Beziehung, eine Analyse der Erziehungsstile nach Kurt Lewin (autoritär, laissez-faire, demokratisch) und deren Auswirkungen auf das Vertrauen.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Ziel ist es, die Auswirkungen autoritärer, Laissez-faire und demokratischer Erziehungsstile auf die Entwicklung von Vertrauen zu analysieren und den am besten geeigneten Stil zur Förderung eines positiven Eltern-Kind-Verhältnisses zu identifizieren.
Wie werden die zentralen Begriffe definiert?
"Kind" wird auf den Zeitraum von der Geburt bis zur Volljährigkeit eingegrenzt. "Eltern" werden als die rechtlichen Erziehungsberechtigten definiert. "Erziehungsstil" wird als ein wiederkehrendes Verhaltensmuster der Erziehenden beschrieben, das die Entwicklung des Kindes beeinflusst.
Welche Rolle spielt Vertrauen in der Eltern-Kind-Beziehung?
Vertrauen wird als essentielles Element sozialer Beziehungen und besonders wichtig für eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung betrachtet. Es reduziert Komplexität und stabilisiert Erwartungen.
Welche Erziehungsstile werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die drei Erziehungsstile nach Kurt Lewin: autoritär, Laissez-faire und demokratisch.
Wie beeinflussen die Erziehungsstile das Vertrauen?
Die Arbeit untersucht, wie sich jeder der drei Erziehungsstile auf den Aufbau und die Entwicklung von Vertrauen zwischen Eltern und Kind auswirkt, inklusive möglicher positiver und negativer Folgen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Vertrauen, Erziehungsstile, Eltern-Kind-Beziehung, Kurt Lewin, autoritär, laissez-faire, demokratisch, Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisation.
- Arbeit zitieren
- Michelle Becker (Autor:in), 2024, Auswirkungen verschiedener Erziehungsstile auf das Vertrauen zwischen Eltern und Kind, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1557547