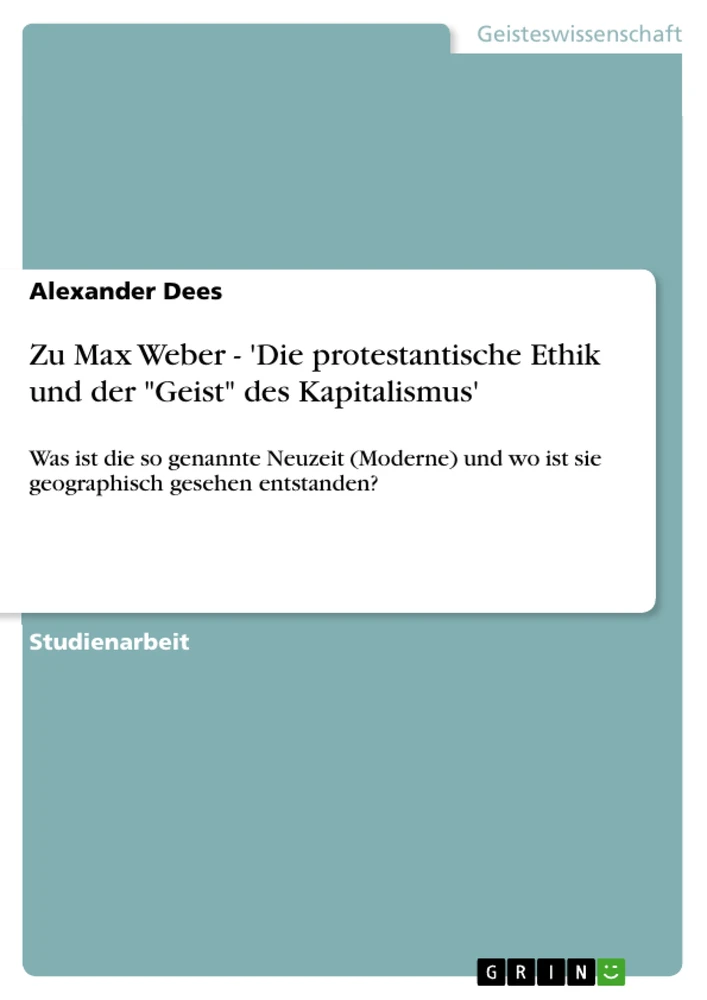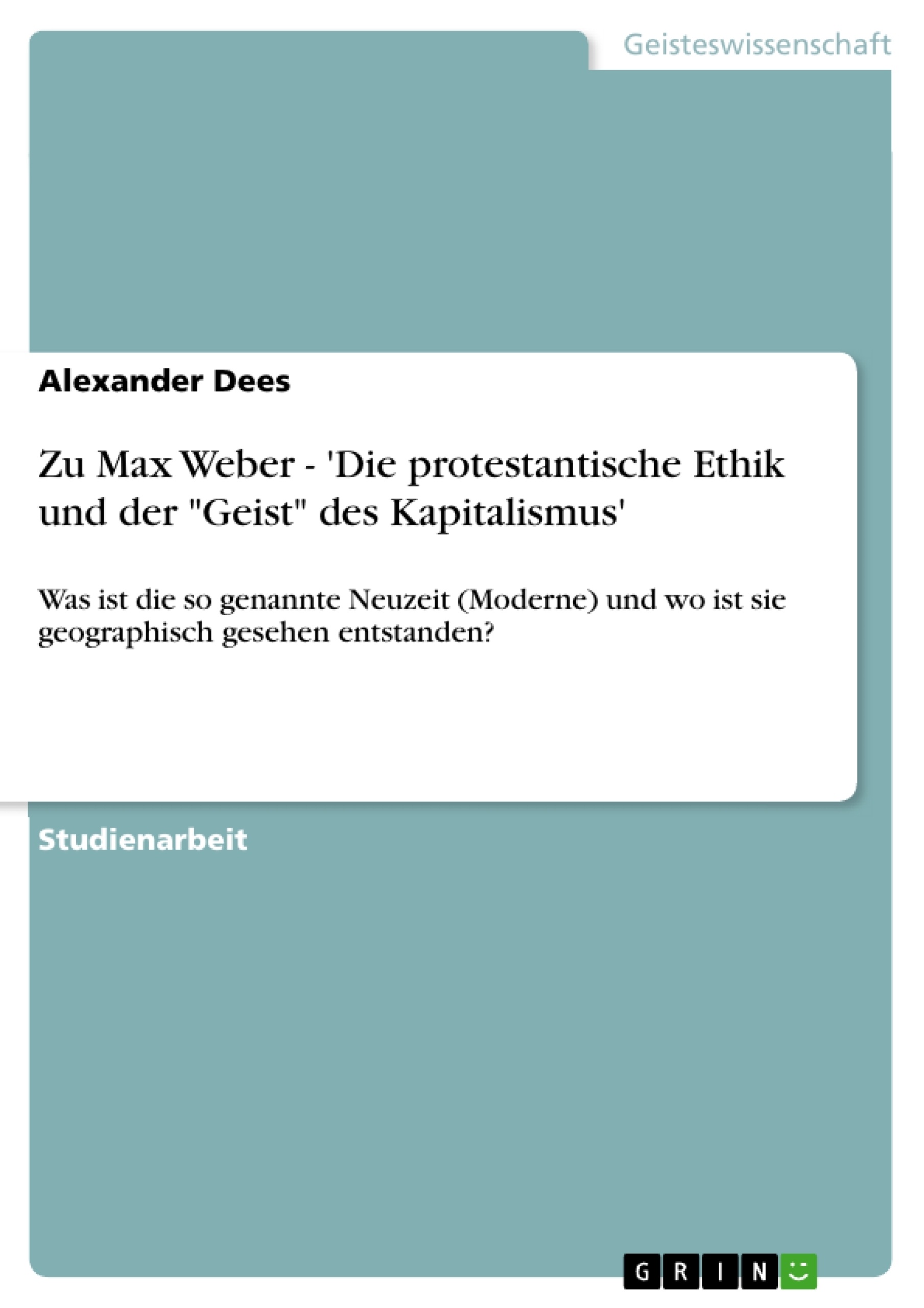Max Weber versucht in seinem Buch „Die protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus“ die Frage zu klären, was die so genannte Neuzeit
(Moderne) ist und wo sie geographisch gesehen entstanden ist. Seine
Überlegungen und Forschungen haben ergeben, dass gerade die Menschen
in Westeuropa (Okzident) sich zu einer modernen Gesellschaft, vor allem in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Staat und Religion, entwickelt haben. Er konstatiert, dass sich die moderne Gesellschaft im Wesentlichen an der Rationalität aufbaut, die sich in allen gesellschaftlichen Bereichen und Funktionen wieder findet. Der Alltag des Menschen wird bestimmt durch sein rationales Handeln, sowohl im beruflichen wie im privaten Bereich. Dabei
stellt Max Weber fest, dass das rationale Handeln nur gelingen kann, wenn
eine bestimmte Ordnung und Systematisierung in der Gesellschaft
vorherrscht. Diese tragen dazu bei das gesamte rationale System zu einer
Effektivitätssteigerung zu führt. Er zeigt dabei vor allem die Wichtigkeit der
Rationalität im gesamten Wirtschaftskreislauf auf, die den Kapitalismus als
finales Ziel beinhaltet.
In diesem Zusammenhang stellt sich Max Weber die Frage, warum
ausgerechnet Westeuropa prädestiniert ist für die ökonomische Rationalität
und nicht auch so genannte prämoderne Gesellschaften. Um diese Frage zu
beantworten, vergleicht er prämoderne Gesellschaften mit dem Okzident. Er
beschäftigt sich zum Beispiel mit chinesischen und indischen Gesellschaften.
Sein Ergebnis ist, dass in den prämodernen Gesellschaften die Ökonomie
vorwiegend den täglichen Bedarf des Menschen gedeckt hat, während im
modernen Kapitalismus das Streben nach Gewinn das inhärente Ziel ist. Es geht Max Weber hauptsächlich um die Klärung der Frage: Warum
entstand gerade im Okzident eine spezifisch moderne Gesellschaft mit
Folgen auf das Wirtschaftssystem? Warum dehnte sich speziell im Okzident
die Rationalität auf alle Lebensbereiche aus? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die protestantische Ethik
- Der Calvinismus
- Die rationale und religiöse Lebensführung
- Die Folgen
- Der Kapitalismus
- Die Entwicklung zur Industriegesellschaft
- Die Folgen für die gesellschaftlichen Strukturen
- Das Wertgerüst
- Die organisatorischen Strukturen einer Gesellschaft
- Kritik
- Die Kritik von Karl Fischer (1879-1975)
- Die Kritik von Felix Rachfahl (1867-1925)
- Zusammenfassende Kritik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Max Webers Werk „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ zielt darauf ab, die Entstehung der Neuzeit (Moderne) und deren geografische Konzentration im Westen zu erklären. Dabei analysiert Weber die Rolle der Rationalität in allen gesellschaftlichen Bereichen und argumentiert, dass sie die Entwicklung der modernen Gesellschaft im Wesentlichen prägt. Insbesondere untersucht er den Einfluss des Protestantismus, insbesondere des Calvinismus, auf die Entwicklung des modernen Kapitalismus.
- Die Rolle der Rationalität in der modernen Gesellschaft
- Die Bedeutung der protestantischen Ethik für die Entstehung des Kapitalismus
- Der Einfluss des Calvinismus auf die Berufsethik
- Die Bedeutung der innerweltlichen Askese für die Entwicklung des Kapitalismus
- Der Vergleich zwischen modernen und prämodernen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Entstehung der modernen Gesellschaft im Westen dar. Weber argumentiert, dass die Rationalität eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der modernen Gesellschaft spielt und dass diese Rationalität besonders im Westen, insbesondere im Bereich der Wirtschaft, deutlich wird.
Das zweite Kapitel beleuchtet die protestantische Ethik, insbesondere den Calvinismus, als Grundlage für die Entwicklung des Kapitalismus. Weber argumentiert, dass die Berufsethik, die von religiösen Glaubenssätzen geprägt ist, entscheidend für die Entstehung des Kapitalismus war. Er analysiert insbesondere das Dogma der Prädestinationslehre und dessen Auswirkungen auf die Lebensführung der Menschen.
Im dritten Kapitel wird der Kapitalismus als Resultat der protestantischen Ethik dargestellt. Weber analysiert, wie die innerweltliche Askese und die Suche nach Zeichen der Erlösung die Menschen zur rationalen Arbeit und zum Streben nach Gewinn führten.
Das vierte Kapitel widmet sich der Entwicklung zur Industriegesellschaft. Weber zeigt, wie die rationalisierte Arbeitsweise und die Organisation der Wirtschaft zu einer industriellen Produktion führten.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die Folgen der Industrialisierung für die gesellschaftlichen Strukturen. Weber analysiert, wie die modernen Gesellschaften durch neue Werte und Organisationsstrukturen geprägt wurden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Werkes sind: Protestantische Ethik, Kapitalismus, Rationalität, Innerweltliche Askese, Calvinismus, Prädestinationslehre, Moderne, Gesellschaft, Wirtschaft, Berufsethik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Max Webers Hauptthese in diesem Werk?
Weber argumentiert, dass die protestantische Ethik, insbesondere der Calvinismus, den "Geist" des modernen Kapitalismus durch rationale Lebensführung und innerweltliche Askese maßgeblich gefördert hat.
Was bedeutet "innerweltliche Askese"?
Es bezeichnet ein Leben, das auf Luxus verzichtet und stattdessen die Arbeit im Beruf als religiöse Pflicht und Weg zur Heilsgewissheit betrachtet.
Welche Rolle spielt die Prädestinationslehre?
Calvins Lehre besagt, dass Gott bereits festgelegt hat, wer erlöst wird. Wirtschaftlicher Erfolg wurde von den Gläubigen als Zeichen dafür gedeutet, zu den Auserwählten zu gehören.
Warum entstand der Kapitalismus laut Weber im Okzident?
Weil sich speziell in Westeuropa eine Form der ökonomischen Rationalität entwickelte, die über die reine Bedarfsdeckung hinausging und das Streben nach Gewinn zum Ziel machte.
Wie wird Webers Theorie kritisiert?
Die Arbeit erwähnt Kritiker wie Karl Fischer und Felix Rachfahl, die Webers historische Einordnungen und kausale Zusammenhänge infrage stellten.
- Quote paper
- Alexander Dees (Author), 2010, Zu Max Weber - 'Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155771