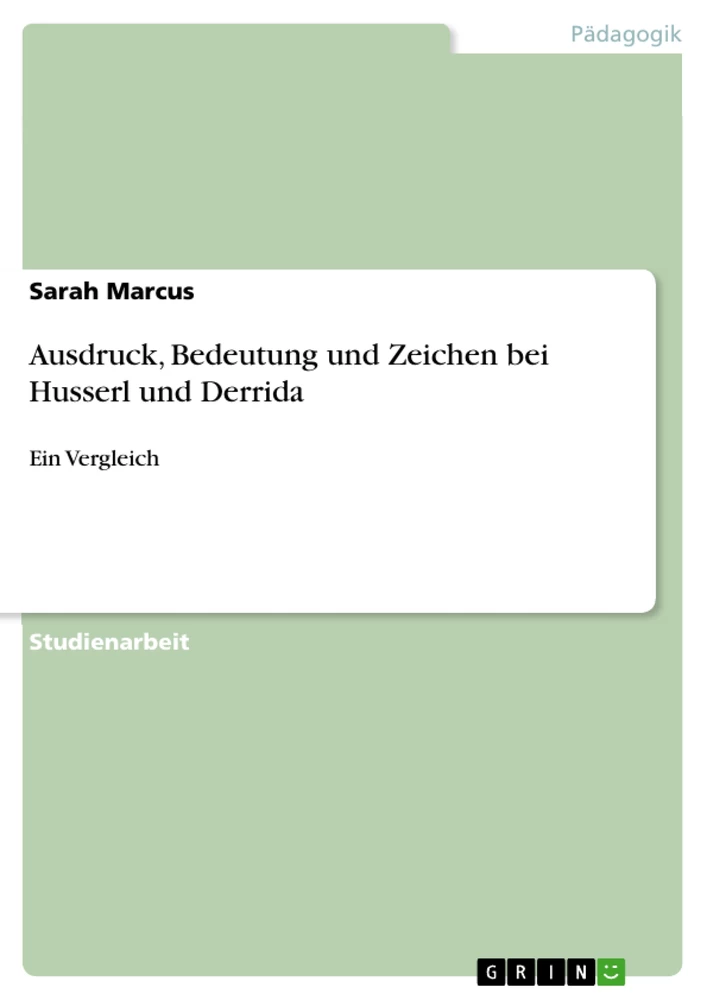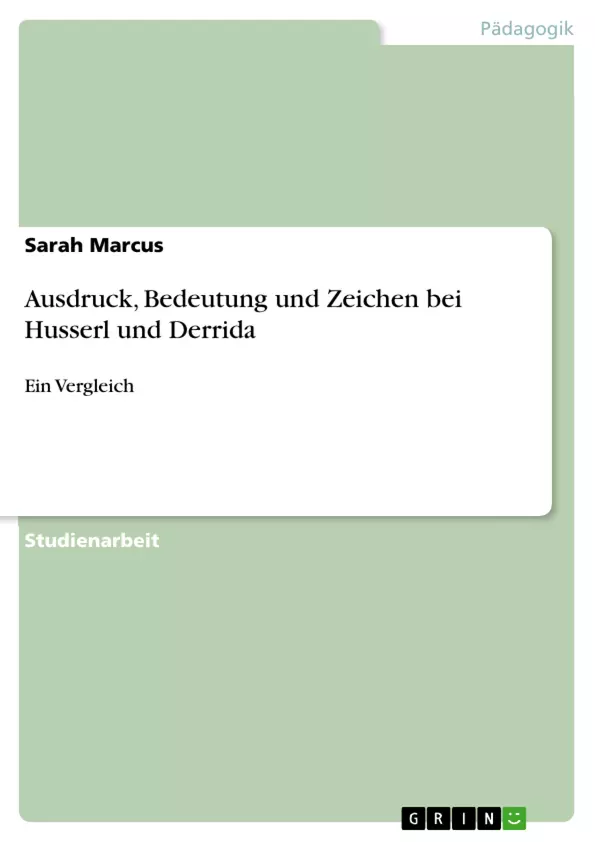Die Phänomenologie, eine der wichtigsten philosophischen Strömungen des 20. Jahrhunderts, wurde von Husserl geprägt und Derrida gehört zu den wesentlichen Vertretern dieser philosophischen Strömung. Die Analyse von Begriffen ist ein wichtiges Kennzeichen der Phänomenologie, die das Subjekt als ein Sein betrachtet, das sozial und kulturell in der Welt eingebettet ist. Somit steht die Phänomenologie mit den Human- und Sozialwissenschaften in Verbindung. Ebenfalls spielt der Skeptizismus eine Rolle.
Husserl beschäftigten eine Reihe erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Grundlagenprobleme; seine Überlegungen zu diesen Problemen führen zu seinem ersten Hauptwerk, den logischen Untersuchungen, die 1900-1901 erschienen sind. Die Analyse der ersten fünf Kapitel von deren ersten Teil soll Grundlage dieser Arbeit sein.
Die erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Fragen betreffen die kognitive Natur des Wahrnehmens, Glaubens, Urteilens und Erkennens; das alles sind psychische Phänomene. In diesem Fall kann man die Psychologie als theoretische Grundlegung der Logik betrachten. Das kann dadurch gezeigt werden, dass die Seele bei Husserl ein wichtiger Bestandteil in seinen Argumentationen ist, da sie den Menschen das reflektieren lässt, was zu seinem Erkenntnisgewinn führt und woraus bedeutende Folgerungen gezogen werden. Die Psychologie ist eine Erfahrungswissenschaft, die die faktische Natur des Bewusstseins erforscht; die Logik hingegen erforscht ideale Strukturen und Gesetze, sie ist also von Gewissheit und Exaktheit geprägt. Husserl sucht den Weg über eine Theorie der Erfahrung, die am „unmittelbaren Bewusstseinserleben“ ansetzt. Dabei ist die möglichst genaue Beschreibung des Tatbestandes für ihn von Bedeutung. Hussels radikale Fragerichtung stellt nicht die Welt in ihrer Existenz in Frage, sondern die Aussagen über sie. Dass auch hier wieder die Phänomenologie zum Vorschein kommt, wird durch folgendes Zitat von Jean-F. Lyotard gezeigt: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die wesentlichen Unterscheidungen von Ausdruck, Bedeutung, Zeichen und Anzeichen bei Husserl (logische Untersuchungen, erster Teil, § 1-5)
- 1.1 Warum die Termini Ausdruck und Zeichen nicht gleichzusetzen sind
- 1.2 Das Verhältnis von Anzeige, Anzeichen und Bedeutung
- 1.3 Die Rolle der Assoziation
- 2. Die kritische Auseinandersetzung Derridas mit dem ersten Teil der logischen Untersuchungen von Husserl § 1-5
- 2.1 Erstes Kapitel: Das Zeichen und die Zeichen
- 2.2 Zweites Kapitel: Die Reduktion des Anzeichens
- 2.3 Drittes Kapitel: Das Bedeuten als Selbstgespräch (Teil A)
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht Husserls und Derridas Verständnis von Ausdruck, Bedeutung und Zeichen, basierend auf den ersten fünf Paragraphen des ersten Teils von Husserls „Logischen Untersuchungen“. Die Zielsetzung besteht darin, die wesentlichen Unterscheidungen zwischen diesen Begriffen bei Husserl zu analysieren und Derridas kritische Auseinandersetzung damit zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Derrida Husserls Argumentation dekonstruiert und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
- Unterscheidung von Ausdruck, Bedeutung, Zeichen und Anzeichen bei Husserl
- Derridas Kritik an Husserls Konzept des Zeichens
- Die Rolle der Assoziation im Verständnis von Bedeutung
- Der Einfluss der deutschen Terminologie auf Derridas Interpretation
- Vergleich der phänomenologischen und dekonstruktivistischen Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Kontext der Arbeit dar. Sie beschreibt die Bedeutung der Phänomenologie im 20. Jahrhundert, wobei Husserl und Derrida als zentrale Vertreter genannt werden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der ersten fünf Kapitel des ersten Teils von Husserls „Logischen Untersuchungen“ und Derridas kritische Auseinandersetzung damit. Die erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Fragen im Werk Husserls, insbesondere die Rolle der Psychologie als Grundlage der Logik, werden ebenfalls angesprochen. Die Einleitung betont die Bedeutung von Husserls genauer Beschreibung des „unmittelbaren Bewusstseinserlebens“ und stellt dies in Bezug zu Lyotards Definition der Phänomenologie.
1. Die wesentlichen Unterscheidungen von Ausdruck, Bedeutung, Zeichen und Anzeichen bei Husserl (logische Untersuchungen, erster Teil, § 1-5): Dieses Kapitel analysiert Husserls Unterscheidung zwischen Ausdruck und Zeichen. Husserl warnt vor der Gleichsetzung beider Begriffe, da nicht jedes Zeichen eine Bedeutung ausdrückt. Er unterscheidet zwischen bedeutungsvollen und bedeutungslosen Zeichen. Die Analyse beleuchtet das Verhältnis von Anzeige und Anzeichen im Zusammenhang mit Bedeutung, wobei Anzeichen als eine besondere Art von Zeichen definiert werden, die nur dann etwas ausdrücken, wenn sie eine zusätzliche Bedeutungsfunktion erfüllen. Der Unterschied zwischen Anzeichen und Ausdruck wird anhand des Beispiels des einsamen Seelenlebens erläutert, in dem Ausdrücke ihre Bedeutungsfunktion unabhängig von der Funktion als Anzeichen entfalten. Sprachliche Zeichen werden im Kontext des psychischen Erlebens als Ausdruck verstanden.
2. Die kritische Auseinandersetzung Derridas mit dem ersten Teil der logischen Untersuchungen von Husserl § 1-5: Dieses Kapitel befasst sich mit Derridas Dekonstruktion von Husserls Argumentation in den ersten fünf Paragraphen der „Logischen Untersuchungen“. Derrida versucht, Husserls Beweisführungen aufzuschlüsseln und seine Vorgehensweise zu hinterfragen, wobei er Husserl in den meisten Punkten zustimmt und dessen Gedanken als Grundlage für seine eigenen nutzt. Die Analyse konzentriert sich auf die ersten drei Kapitel von Derridas Werk, um dessen Denkweise nachzuvollziehen. Ein weiterer Aspekt ist die Untersuchung, wie Derrida mit den deutschen Termini Husserls umgeht und welche Schwierigkeiten die Übersetzung ins Französische mit sich bringt.
Schlüsselwörter
Husserl, Derrida, Phänomenologie, Dekonstruktivismus, Logische Untersuchungen, Ausdruck, Bedeutung, Zeichen, Anzeichen, Anzeige, Assoziation, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Psychologie, Sprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich Husserl und Derrida
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Auffassungen von Edmund Husserl und Jacques Derrida bezüglich Ausdruck, Bedeutung und Zeichen. Die Analyse basiert auf den ersten fünf Paragraphen des ersten Teils von Husserls „Logischen Untersuchungen“ und Derridas kritischer Auseinandersetzung damit. Im Mittelpunkt steht die Dekonstruktion von Husserls Argumentation durch Derrida und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht die Unterscheidung von Ausdruck, Bedeutung, Zeichen und Anzeichen bei Husserl, Derridas Kritik an Husserls Zeichenkonzept, die Rolle der Assoziation im Verständnis von Bedeutung, den Einfluss der deutschen Terminologie auf Derridas Interpretation und einen Vergleich der phänomenologischen und dekonstruktivistischen Ansätze.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Hauptkapitel und einen Schlussteil. Das erste Kapitel analysiert Husserls Unterscheidung zwischen Ausdruck, Bedeutung, Zeichen und Anzeichen. Das zweite Kapitel behandelt Derridas kritische Auseinandersetzung mit Husserls Argumentation. Die Einleitung bietet einen Kontext und die Zusammenfassung der Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse zusammen. Schlüsselwörter am Ende helfen bei der Recherche.
Was ist Husserls zentrale These bezüglich Ausdruck, Bedeutung, Zeichen und Anzeichen?
Husserl warnt vor der Gleichsetzung von Ausdruck und Zeichen, da nicht jedes Zeichen eine Bedeutung ausdrückt. Er unterscheidet zwischen bedeutungsvollen und bedeutungslosen Zeichen und beleuchtet das Verhältnis von Anzeige und Anzeichen im Zusammenhang mit Bedeutung. Anzeichen werden als eine besondere Art von Zeichen definiert, die nur dann etwas ausdrücken, wenn sie eine zusätzliche Bedeutungsfunktion erfüllen. Sprachliche Zeichen werden im Kontext des psychischen Erlebens als Ausdruck verstanden.
Wie geht Derrida mit Husserls Argumentation um?
Derrida dekonstruiert Husserls Argumentation, indem er dessen Beweisführungen aufschlüsselt und hinterfragt. Obwohl er Husserl in den meisten Punkten zustimmt und dessen Gedanken als Grundlage nutzt, analysiert er kritisch dessen Vorgehensweise. Die Arbeit untersucht auch, wie Derrida mit der deutschen Terminologie Husserls umgeht und welche Schwierigkeiten die Übersetzung ins Französische mit sich bringt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die primäre Quelle ist der erste Teil der „Logischen Untersuchungen“ von Husserl (insbesondere die Paragraphen 1-5). Die Arbeit bezieht sich außerdem auf Derridas kritische Auseinandersetzung mit diesem Werk. Die Einleitung erwähnt die Bedeutung der Phänomenologie im 20. Jahrhundert und verweist auf Lyotards Definition der Phänomenologie.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Husserl, Derrida, Phänomenologie, Dekonstruktivismus, Logische Untersuchungen, Ausdruck, Bedeutung, Zeichen, Anzeichen, Anzeige, Assoziation, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Psychologie und Sprache.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die Phänomenologie Husserls und den Dekonstruktivismus Derridas interessieren, insbesondere im Hinblick auf deren Auseinandersetzung mit dem Thema Zeichen und Bedeutung. Sie ist relevant für Studierende und Wissenschaftler der Philosophie, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft.
- Citar trabajo
- Sarah Marcus (Autor), 2010, Ausdruck, Bedeutung und Zeichen bei Husserl und Derrida , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155828